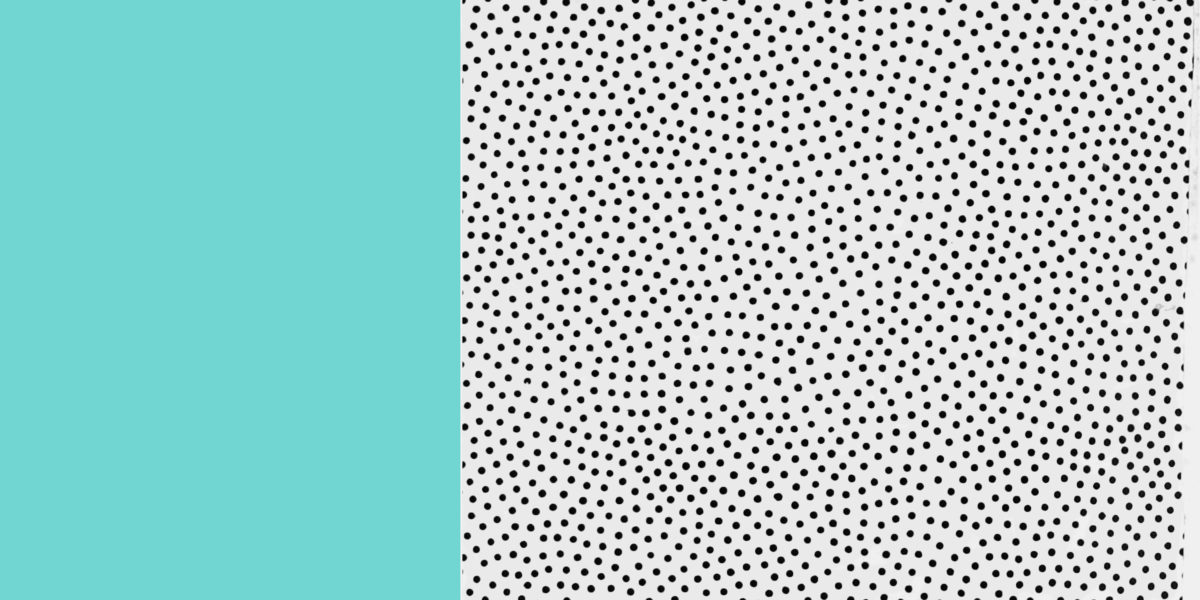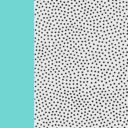Zum 30. Mauerfall-Jubiläum am 9. November 2019 versammeln wir im Logbuch Suhrkamp Beiträge zu diesem Themenschwerpunkt. Eröffnet wird die Reihe mit Fotografien von Andreas Rost, die vor allem im Frühjahr 1990 in Berlin, Leipzig und Dresden entstanden sind. Es folgen ein Text von Emma Braslavsky und ein Langgedicht von Angela Krauß. Steffen Mau blickt anschließend auf seine Lektüre von Lutz Seilers Kruso zurück, Bodo Mrozek führt mit Ilko-Sascha Kowalczuk ein Gespräch über den »Sound der Wende«, und mit den Beiträgen von Deniz Utlu und Wolfram Höll beschließen wir die Serie.
Seit meinem Theatererstling Und dann, also seit ich künstlerisch in Erscheinung getreten bin, bekomme ich die Gelegenheit, mich zu den Jubiläen der Wendezeit zu äußern. Der Plural ist hier angebracht: 25 Jahre Mauerfall, ein Jahr später 25 Jahre Wiedervereinigung, und nun das Ganze nochmal mit der 30. (Auch in meinem Brotberuf als Hörspielregisseur ist das übrigens Thema: »Lasst uns doch was zur Wiedervereinigung senden / produzieren!«. Um einen etwas anderen Akzent zu setzen, haben wir ein Feature gemacht über West-Berlin, über das Künstler-Biotop, das mit der Wende verschwand: Das also ist der Westen).
Das ist natürlich kein Zufall. Und dann stellt eine Familie in den Mittelpunkt, in der Wendezeit, und erzählt von einem dreifachen Verlust: Ein ganzes Land geht verloren, der Vater verliert dadurch seinen Beruf, und die Mutter ist weg. Vor allem aber erzählt Und dann auch die Geschichte eines Aufbruchs: Davon, sich nicht über den Verlust definieren zu lassen, davon, sich eine eigene Identität zu schaffen. Am Beispiel der Russlanddeutschen, die jetzt, in der Nachwendezeit, nach Ostdeutschland kommen. Im Stück heißt es:
Und die Russen
sind nicht
wie die Russen
die den Kopf
eingezogen haben
in den Panzer die
in dem Panzer
heimgezogen sind
nein
die Russen
sind Deutschrussen
Russen die Deutsche sind
aber kein deutsch sprechen
die Russen sondern
russisch
die Deutschen
sagt Vater
und ich verstehe
nicht.
Das Verwirrspiel um »Russen« und »Deutsche« hat natürlich mit der Erzählperspektive des Stückes zu tun: Es spricht ein Kind, für das diese Verhältnisse schwer zu durchschauen sind. Das literarische Spiel mit »deutsch/russisch« Sprechen legt aber etwas anderes nahe: Ja, es gibt einen dreifachen Verlust (»die Russlanddeutschen« haben einen Teil ihrer deutschen Kultur in Russland »verloren«; »die« Deutschrussen werden in Deutschland einen Teil ihrer russischen Identität verlieren; gleichzeitig ziehen die russischen Streitkräfte der ehemaligen DDR ab). Aber anstatt diesen Verlust als etwas Negatives aufzufassen, sich davon definieren zu lassen, nehmen sie sie als Bausteine, als Legoklötze mit verschiedenen Farben und Formen, aus denen sich neue Dinge bauen lassen. Und eine neue Identität.
»Die« Deutschen in Russland in Deutschland sollen so natürlich nicht realistisch porträtiert werden; nein, viel besser, sie werden ein poetisches Prinzip. Hey, dafür schreibt man schließlich Literatur und keine Artikel. Und wer wissen will, wie es mit den Deutschen und Russen und Vätern und Kindern weitergeht, der lese einfach das Buch, so.
Eigentlich war mit Und dann für mich alles gesagt, oder besser geschrieben, was ich zur Wendezeit sagen und schreiben wollte. Vom Verlust erzählen, aber vor allem davon, sich nicht davon beherrschen zu lassen. Damit wollte ich natürlich auf Resonanz stoßen, also war es für mich existenziell, dass das Thema eben noch nicht abgeschlossen war. Und gleichzeitig habe ich gehofft, dass die Wendezeit eben doch bald einmal Geschichte wird. Und zwar im ganz und gar umgangssprachlichen Sinn: Dass wir uns nicht mehr davon bestimmen lassen im Denken und Handeln (so wie wir uns hoffentlich auch nicht mehr von den Kriegen gegen Napoleon bestimmen lassen). Und vielleicht war da sogar insgeheim die Hoffnung, mein Stück könnte dabei helfen (haha).
Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. In meinem vierten Theatertext, Disko wollte ich eigentlich ganz einfach ein Stück schreiben, ausgehend von Prinzipien aus Techno- und House-Musik (viertes Stück heißt: dazwischen waren zwei ohne Ost-Thematik!). Während der Arbeit am Text kam es zur sogenannten Flüchtlingskrise. Und da war das Prinzip »Disko« (Wer ist schon drinnen, wer noch draußen, wer darf rein, wer ist der Türsteher?), einfach zutreffend, um die Flüchtlinge außen vor zu lassen. Und es hat auch textlich eine starke Kraft, wenn nicht nur die feiernden Party-People »Around the World« singen, auf dem Tanzfloor, sondern auch eine Gruppe Flüchtlinge auf der Balkanroute.
Gleichzeitig hat auch eine andere Gruppe um Einlass gebeten ins Stück: die krakeleenden, AfD-wählenden, pegiphilen Ostdeutschen, die sich nur zu gern selbst als »Abgehängte« bezeichnen. Also gut. Dafür schreibt man schließlich Literatur.
Doch was war passiert? Die Städte blühten doch. Eine Ostdeutsche war Bundeskanzlerin. Die ehemalige PDS, hervorgegangen aus der Einheitspartei SED, hatte einen erstaunlichen Weg bis auf den Boden des Grundgesetzes hingelegt. Und dabei Teile der ostdeutschen Bevölkerung integriert in das demokratische System, in den Rechtstaat, und vor allem jene Leute, die wahrscheinlich am meisten Mühe damit hatten: Lehrer, Beamte, Intelligenzija, die ihre Lebenspläne und Ideen ganz an der SED ausgerichtet hatten. Das führte, wie in Thüringen unter Ministerpräsident Bodo Ramelow, dazu, dass man die »Linke« als Regierungspartei, als Volkspartei wahrnimmt. Oder dass sie, wie in anderen ostdeutschen Bundesländern, mehr und mehr Stimmen abgibt. Wahrscheinlich, weil sie einen Teil ihrer historischen Mission (oder besser Funktion), nämlich die Integration des Ostens, erfüllt hat, und nun nur noch eine einfache linke Partei ist. Sicherlich aber keine ostdeutsche Protestpartei mehr. Denn wozu protestieren, oder wogegen?
Das sehen leider nicht alle so. Petra Köpping – als SPD-Ministerin sicher keine Rechte – fasst hier das so zusammen in ihrem Titel »Integriert doch erstmal uns! Streitschrift für den Osten«. In den vergangenen Jahren wurde sie aktiviert und zementiert, eine ostdeutsche Opfermentalität, schlimmer noch: Opferidentität. Wir sind die Abgehängten, wir sind die Benachteiligten. Schlimmer deshalb, weil man ja so auch gar nicht nach Besserung, nach Veränderung streben kann, wenn es eben Teil der Identität ist – weil es sonst die Identität bedrohen würde.
Und das alles wird abgeholt und befeuert von Nazis wie Björn Höcke und anderen aus Westdeutschland importierten Protagonisten der AfD. In einer perversen Umdeutung von Sätzen und Aktionsformen der friedlichen Revolution (»Wir sind das Volk!« war schließlich die Forderung nach Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit, noch vor dem nationalen Getaumel). Höcke, Gauland und Co. tun alles dafür, diese drei Dinge zu untergraben.
Wenn man das so aufschreibt, wird einem erst so richtig bewusst, wie absurd das Auftreten der AfD ist, zumindest auf einer rationalen Ebene. Das ist aber letztlich völlig egal, da sie emotional nur eines zielt: auf den ostdeutschen Opferkult. Auf das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und das liest man auch sonst, in den Medien, von Politikern aller Parteien: Endlich »die Ostdeutschen« ernst nehmen, die »Sorgen der Bürger«. Völlig einverstanden. Nur müsste das etwas völlig anderes heißen.
Wer sich selber nur als Opfer, nur als Objekt definiert, ist nicht ernst zu nehmen. Jemanden ernst zu nehmen hieße, zuzuhören, vor allem aber auch zu widersprechen. Auf die Frage »Wer integriert eigentlich uns?« gibt es eine Antwort, »Integrier dich doch selbst.« Dieser kurze Dialog kommt so übrigens in Disko vor. Wieder ein Problem gelöst, wieder hat ein Stück die gesellschaftliche Debatte auf den Punkt gebracht, und nun können wir uns anderen Dingen widmen (haha).
»Nur ein Dschoooge« (=Joke=Witz) hätte man da jetzt gesagt, im Leipzig kurz nach der Wende. Ich jedenfalls werde mich in meinem fünften Stück mit abgehängten Männern in Ostdeutschland auseinandersetzen. Weil das Thema eben doch noch nicht erledigt ist, weder für die Gesellschaft noch für mich.
P.S.: »Und dann« läuft seit seiner Premiere 2013 ununterbrochen am Schauspiel Leipzig. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass das Stück, das in der Wendezeit spielt, offensichtlich dem Leipziger Publikum etwas erzählt. Nur was? Und wem? Den Ostdeutschen, den gebürtigen Leipzigern sicherlich etwas über Verlust (und Neuaufbau!). Das kommt hoffentlich aber auch bei den Zugezogenen an, den Student*innen aus Westdeutschland, den Künstler*innen, auch den Ingenieur*innen von Porsche.
Vor allem aber bin ich mir sicher, dass die Erzählform von Und dann, in ihrer Radikalität noch durch die Inszenierung von Regisseurin Claudia Bauer verstärkt, vor zehn Jahren keine Chance gehabt hätte. »Hypzig« wird als neues Berlin bezeichnet, mit extremem Bevölkerungswachstum, steigenden Wohnungspreisen und schwindenden Freiräumen als Konsequenz. Aber gleichzeitig hat sich die Stadt auch geöffnet, ist lebendiger, dynamischer geworden. Dank der Wessis, die zu »uns« gekommen sind.