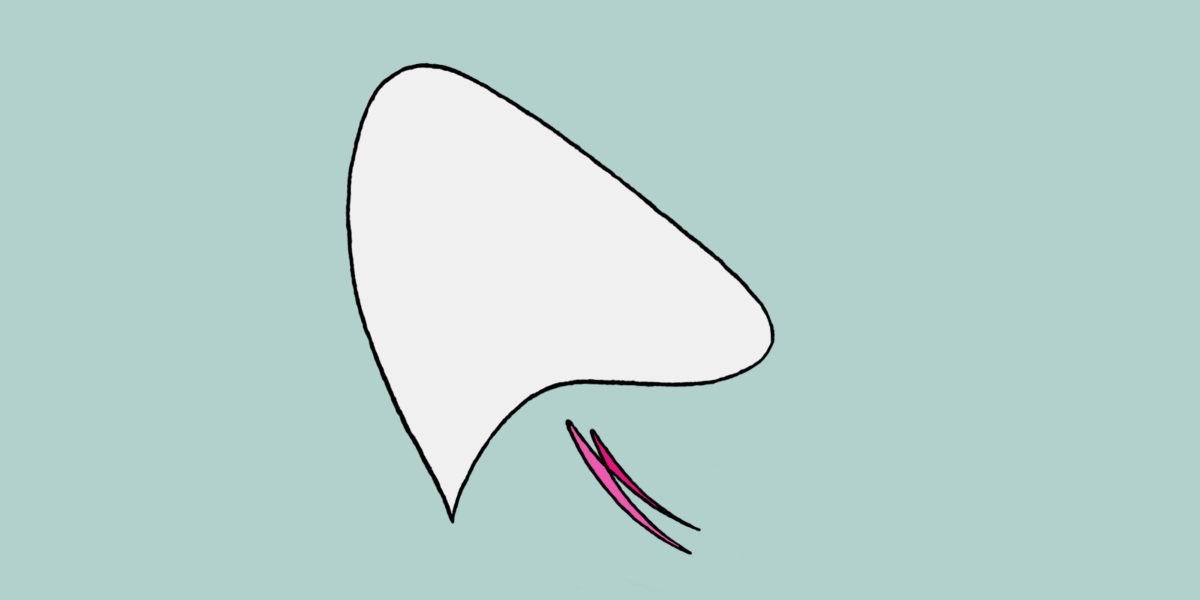Beim Wort »Parabel« mag man ein wenig erschaudern, als Dramatiker von heute. »Parabel«, das klingt nach Sternchenstück, das im Spielplan der Theater steht, weil es Abi-Prüfungsthema ist. Also nach Schullektüre. Nach Dramatik, die gerade komplex genug ist, und auch nicht mehr, damit sie sich in Aufsätzen erklären lässt – und zwar ohne dass ein Rest übrig bleibt. Eine saubere Bruchrechnung. Man denkt an Brecht, an Der gute Mensch von Sezuan, auch wenn man natürlich insgeheim neidisch ist auf die Eleganz der Denkbewegungen bei Brecht, auf das Tanzen der Gedanken. Eine Spielform des Theaters also, aus einer Zeit, als man noch an den Bildungsauftrag, die Bildungsmacht des Theaters glaubte. Sicherlich keine Form für die Zukunft. Und doch sitzt man in der Gegenwart und stellt fest, dass man gerade nichts anderes geschrieben hat als eine Parabel. Hilfe?
Disko war ein Auftragswerk für das Schauspiel Leipzig. Der Auftrag gab dabei so viel Freiheit wie nur irgend möglich: Es sollte ein Stück werden für die Wiedereröffnung der umgebauten Spielstätte Disko. Bei mir traf der Auftrag auf die große Lust, die musikalische Struktur von Techno- und House-Musik für die Bühne zu nutzen. Schon seit Jahren höre ich beim Schreiben Musik, die zwischen Repetition und Variation oszilliert, ob in der E-Variante der Minimal Music à la Philip Glass oder im U-Bereich mit Daft Punk oder Moderat. Um in einen Schreibflow zu kommen, um mich wach treiben zu lassen. Aber strukturell hat House eine große Gemeinsamkeit mit der Bühne: Und zwar die Simultanität. Im House ändert sich alle acht Takte etwas: Ein neues Element tritt auf, oder ein anderes tritt ab. Und während die Beine immer weiter tanzen im four-to-the-floor, da erlebt der Rest vom Körper, inklusive des Hirns am oberen Ende, immer neue Kombinationen.
Und auf der Bühne? Auch wenn die klassische Art, Theaterstücke zu setzen, etwas anderes behauptet, nämlich eine Linearität (A sagt etwas, dann auf der nächsten Zeile B, dann wieder A …), sind meistens auch mehrere Figuren gleichzeitig auf der Bühne, Simultanität also. Und genau das wollte ich in Disko machen: Eine Simultanität der Bühnenpräsenz der Figuren, dazu Texte und Figuren, die immer wieder neu kombiniert werden; und das Ganze sollte auch in einer Disko spielen, in diesem huis clos, dieser geschlossenen Gesellschaft, wo grundsätzlich eh immer alle auf der Tanzfläche sind oder zumindest vom Rand aus zuschauen.
Doch während ich schrieb, ist außerhalb meiner eigenen Schreibklause etwas ganz anderes passiert, wiederum quasi simultan: Die sogenannte »Flüchtlingskrise«, parallel dazu das Erstarken von Pegida und AfD. Und da wurde mir klar, was ich vor mir hatte: Was die Disko eigentlich für eine erzählerische Kraft hat, was für ein starkes Gleichnis sie sein kann. Die Disko als Festung Europa, die beileibe nicht jeden hereinlässt und wo selbst Einheimische den Eindruck haben können, nicht dazuzugehören (bzw. sich gern in diese Opferrolle hineinbegeben). Was ein Satz wie »Around the world«, die einzige Textzeile aus dem House-Track von Daft Punk, bedeuten kann, je nachdem, wer ihn sagt, ob es die feiernde Leistungsgesellschaft in der Disko ist oder ein Flüchtling, der seine Heimat verlassen muss. Also dann, Parabel eben (wobei ich mir das beim Schreiben selbst nicht gesagt habe, im Idealfall ist der Text klüger und raffinierter als der Autor und das, was er da wollte, und die Erkenntnis kommt dann erst später).
Eine Parabel, ein Gleichnis ist natürlich immer auch eine Gleichmachung, ein Runterbrechen; man kann auch durchaus sagen: Die Flüchtlingskrise mit einem Diskoabend erzählen, das ist mir zu blöd. Bei aller Vereinfachung: Glücklicherweise ist es nicht ganz so einfach, oder besser: eindimensional. Einerseits erlaubt es gerade eine klare Setzung, ganz andere Widerhaken, ganz andere Erzählebenen einzubauen. So sind die Texte in Disko vor allem von French-House-Musik aus den 90ern inspiriert, die hier wiederauftauchen. Die 90er sind doch längst Geschichte, längst tot, mag man meinen. Und wenn man dann aber sieht, wie Asylbewerberheime angegriffen werden und eine Opfermentalität gepflegt wird, diesmal mit rechtem Drall, dann sind die 90er doch wieder da, als untote Wiedergänger; und die AfD kann sich als größter Sampler überhaupt gebärden, der Sätze wie »Wir sind das Volk« mit demselben Wortlaut, aber völlig verdrehtem Sinn übernimmt. (Dabei kann Sampeln etwas Schönes sein. Andererseits erlaubt gerade das Sampeln, das Sprechen von ein und denselben Sätzen wie eben »Um die Welt« durch ganz verschiedene Figuren, aus ganz verschiedenen Warten und mit ganz verschiedenen Intentionen, erlaubt all das, den Diskurs zu verflüssigen. Und schlussendlich ist es auch gut, dass das Gleichnis nicht ganz aufgehen kann, nie ganz aufgeht; man wird sich immer über die Vereinfachung empören, und gerade das ist wichtig. Und manchmal ist ja auch die Realität empörend vereinfachend; so wie im Stück Disko am Schluss ein mörderischer Ausscheidungstanz steht, weil es die Dramaturgie fast schon gebietet (wie kommt man sonst raus aus dem Stück), so schien ja auch die Realität nur auf einen Moment wie den Mord in Chemnitz gewartet zu haben, wo man einen Flüchtling als Täter identifizieren konnte und dann aber auch der rechte Mob seine ganze Hässlichkeit endlich zeigen konnte, die erbärmliche Dramaturgie der Realität.
Und gerade hier scheint es sich für mich um ein Hauptproblem im Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise zu handeln: Das Denken, Sprechen, Handeln war von Anfang an extrem polarisiert. Ich bin persönlich mehr bei Angela Merkel als bei Boris Palmer und habe großen Respekt vor den Menschen, die versuchen, Flüchtlingen ganz konkret zu helfen. Aber gesamthaft gesehen gab es kaum einen Moment, kaum einen Echoraum, wo beispielsweise Platz für einen Satz war wie: »Ich weiß ganz einfach nicht, wie ich es finde, dass jetzt anscheinend viele Flüchtlinge kommen.« Der Afrika-Korrespondent der NZZ, David Signer, hat dazu geschrieben, die »Ambivalenz des Fremden« sei scheinbar schwer auszuhalten.
Und gerade hier liegt die Chance des Theaters. Es darf engagiert sein, es muss engagiert sein (das bin ich auch an mehreren Stellen in Disko); aber es hat vor allem auch die Möglichkeit, Ambivalenz darzustellen, noch einmal einen Schritt zurückzutreten, als Gemeinschaft zu sagen: Okay, da passiert gerade etwas mit uns, jetzt, hier, mit uns, mit anderen, und das verändert sich eben auch, wer alles zu wem gehört, das beginnt zu fließen. Auch wenn das Theater nicht mehr das Leitmedium sein mag, so gehen doch sehr unterschiedliche Menschen in die Aufführungen; und Theater hat hier die Chance, eine sinnstiftende, eine selbstreflektierende Erfahrung zu bieten, die ebendiese Gemeinschaft des Abends teilt. Und, man ahnt es schon, nichts anderes sollte eine Parabel ermöglichen.
Genau deswegen ist die Parabel vielleicht doch nicht nur ein Ding von gestern, sondern ein Ding, das von unserem Heute erzählt (und auch immer wieder erzählen wird, von immer neuen Heutes, ein Ding von morgen geradezu). Sternchenthema müssen solche Parabeln deswegen nicht werden. Aber die Kraft zu erzählen, im Jetzt, die könnten sie in ganz verschiedenen Hiers verwirklichen. Und sie können auch dem Theater helfen, ein Ding für die Zukunft zu bleiben. Denn Theater kann Unbekanntes erzählen, neue Perspektiven bieten, verstören, experimentieren usw. Und es kann auch Sachen auf den Punkt bringen, Sachen, die uns beschäftigen, und dabei helfen, ein »uns« überhaupt erst zu konstituieren, immer wieder auf Neues zu verweisen.
Zuerst erschienen in: Suhrkamp Theater Magazin 2020