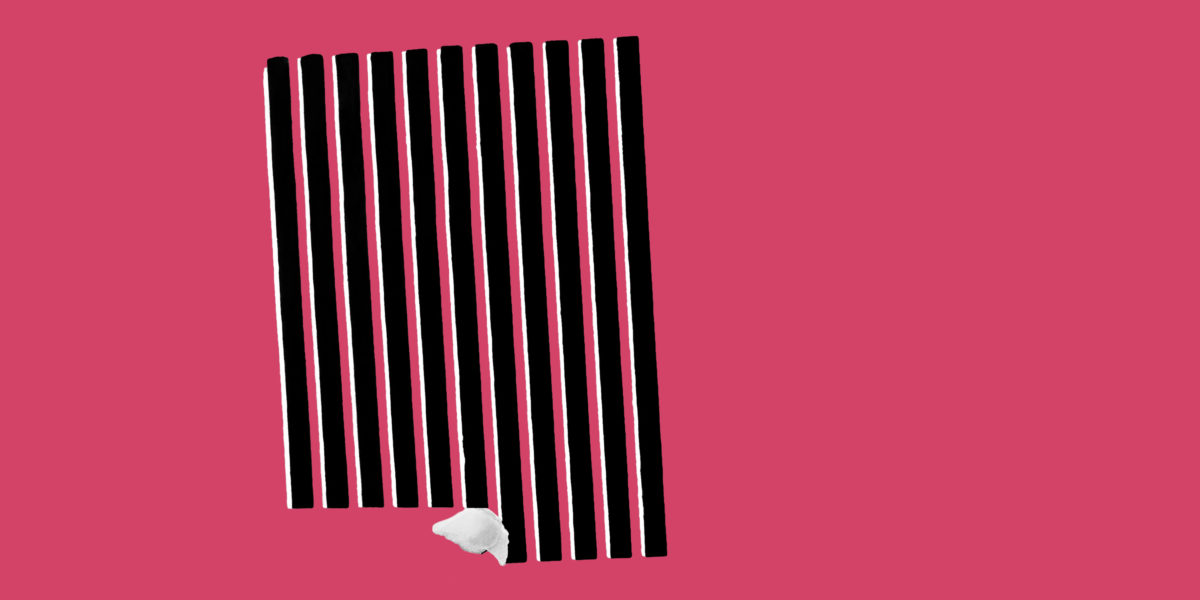Ulf hinterfragt. Ulf stellt unbequeme Thesen auf. Ulf liefert auch unbequeme Antworten. Jetzt nicht der. Sondern die. Und ja auch nicht Ulf, sondern eben ULF. Ein mitunter in der Allgegenwärtigkeit und Strapazierung als Kollektiv- und Festivalbezeichnung irritierendes Akronym. Irritation scheint letztlich das latente Konzept dieser Veranstaltung zu sein. Ein Wochenende lang fällt auf: dass das gut ist. Dass das irgendwie auch nicht so gut ist. Dass diese beiden Erkenntnisse am Ende zumindest in die Ratlosigkeit führen, abseits der bekannten Widerrede, dass es ja gar nicht so und nicht so schlimm ist mit jungen Menschen und der Literatur.
Das ist gut. Allein weil schon die Ortswahl irritiert, gegenläufig den Zentren von Literaturproduktion, -betrieb, -vermittlung. Weil weite Räume des Programms für Brüche mit dem vielgescholtenen Diktat von Bühne, Wasserglas und Podiumsgespräch zur Verfügung stehen. Weil diese Räume genutzt werden: für performative Lesungen, multimediale und -linguale Lesungen, ASMR-Lesungen, interaktive Buzzer-bei-Langeweile-Lesungen, Impro- und Dia-Lyrik, Lesungen, die eigentlich Übersetzungen von und in Gebärdensprache sind, ›Schwarmlesen‹, Sport-Lesungen, Lesungen beim Suppekochen, Choose-Your-Own-Adventures auf dem meta-kritischen Weg durch den Literaturbetrieb, Sofa- und Spritztour-Lesungen, Schnapslesungen, und dabei und danach wird einem ganz anders. Weil souverän und impulsiv engagierte, ambitionierte Texte gelesen werden. Weil intermedial paktiert wird, mit Podcast-Radio und den Unabhängigen Literaturzeitschriften. Weil die OrganisatorInnen nicht müde werden, auf die Probleme von unabhängiger Literaturvermittlung als prekärem Betätigungsfeld zu verweisen, auf die fehlende Anerkennung, auf die Hermetik und Uniform des Etablierten. Weil en détail und praxisnah zahllose modische und unmodische und immer relevante Themen von Schreiben, Vermitteln, Überleben von und mit Literatur diskutiert werden, Feminismus, Ableismus, Kapitalismus, queere Narrative, (Des-)Integration und Identitäten. Weil es einen KinderKunstRaum gibt, zwar keine Kinder, aber genügend Begeisterte aus dem übrigen Publikum. Weil ULF Literatur zum Festival macht, abseits der gewohnten Lesemarathons und mit schrecklich viel Spaß und Leidenschaft, Lyrik to go, Musik, Workshops, Installationen.
Das ist irgendwie auch nicht so gut. Weil dann doch recht oft ganz klassisch mit Wasserglas und Podiumsgespräch von der Bühne herab gelesen wird. Weil doch der schleppende, bekannte, ermüdende Mono-Ton vorhersehbarer Texte manchmal träge durch den Raum schwappt. Weil, ganz entgegen des Anspruchs der Niedrigschwelligkeit und Vermittlung an literaturferne Sphären, die Veranstaltung im etablierten Subkulturraum und für Nichtstudierende, -lernende, -rentnernde mehr als 20 Euro das Tagesticket stattfindet. Weil dadurch das Publikum, sofern es nicht ohnehin lesend oder organisierend eingebunden ist, doch nicht so fachfremd ist, wie man es sich im Rahmen unabhängiger Lesereihenkonzepte wünscht, die tagesabschließenden Partys ausgenommen, aber Literatur wird da nun nicht unbedingt vermittelt. Weil es doch ein straffes Netz ist, das sich hier lange-nicht-gesehen und bis-bald knüpft. Weil der Vorwurf ausbleibender Anerkennung und Förderung bei der Mäzenenliste von der Bundeskulturstiftung über das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bis zum Kulturreferat Nürnbergs zumindest entkräftet wird. Weil Lesungen und Texte, akut und allgemein, diskutiert werden mit selbstreferentiellem Klagenfurter Vokabular. Weil, während Kabeljau & Dorsch in ihrer Game-Show meta-kritisch die Wege durch den Betrieb inszenieren, ohne dass ihre AbenteurerInnen davon abkommen könnten, nebenan Peter Engstler Veteranengeschichten aus der gänzlich und wirklich unabhängigen Literaturvermittlung schildert. Weil vor Yamen Husseins Lyrik aus der Diktatur und über den Krieg in Syrien alle anderen Probleme des Schreibens und Literaturbetriebs zumindest blass, wo nicht lächerlich erscheinen.
Das alles irritiert, mag es auch nicht vorgesehen sein. Doch auch und vielleicht gerade wegen des Alles-irgendwie-auch-nicht-so-gut widerlegt ULF die phasenweise virulenten Sorgen um ein mögliches Ende von Literatur und Literaturproduktion in allen ihren Facetten, einfach, weil es das gibt. ULF zeigt auch: dass es weitergeht ist Arbeit, viel, und der prätentiöse Begriff des Kuratierens dann wohl doch angemessen, wenn man ihn denn beanspruchen will. Was hier passiert, in vier Tagen, in Nürnberg, ist ernstzunehmen als leidenschaftliches Engagement im literarischen Feld, auch wenn die Märtyrerpose nicht immer passt. Hier konstituiert sich eine neue Generation im Spiel mit aber auch nach den Maßgaben des Betriebs, mit neuen Stimmen, Ideen, Möglichkeiten und, man kann das nicht oft genug sagen: zu wenig Anerkennung ihres Willens, zumindest Teil zu sein. Die Souveränität in betrieblichen Handwerksweisen, soft skills und Vernetzung, die hier neben allem Fun, Party und Spektakel an den Tag gelegt wurde und über das Ereignis hinaus wird, nimmt zwar die Angst, dass hier nur ein Kreis engagierter, aber doch am eigenen oder fremden Anspruch scheiternder Literaturkunstenthusiasten zusammenkommt, deren Subszene ihrer konzeptuellen Kurzlebigkeit erliegt. Aber es lässt die Angst – oder doch eher das Bedenken – entstehen, dass es, bei allem Versprechen von Veränderung, Unabhängigkeit und Experiment, von subkultureller Barrierefreiheit und niedrigschwelliger Literaturvermittlung, abseits kosmetischer, nomineller, personeller Veränderung doch so weitergeht, so bleibt, wie es ist. Mögliches Fazit der jungliterarischen Feldforschung an ULF: Man kann sich sicher unsicher sein, über das, was man ohnehin wusste, fest im Glauben. Gar nicht so schlimm mit jungen Menschen und der Literatur – oder vielleicht nur ein bisschen und jedenfalls nicht so, wie man üblicherweise meint.