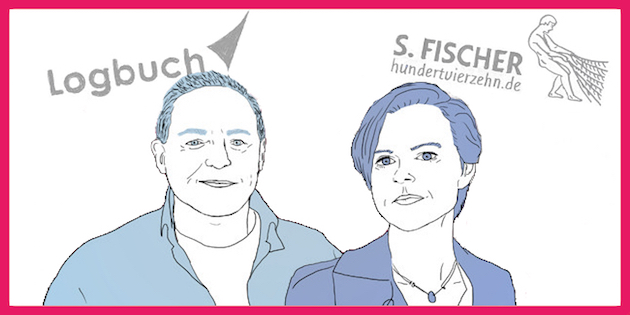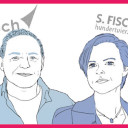Mit dem Projekt »Feminismen: Wie wir wurden, wie wir leben, was wir sind« von Thomas Meinecke und Antje Rávic Strubel setzen Logbuch Suhrkamp und S. Fischer Hundertvierzehn ihren im vergangenen Jahr begonnenen Austausch fort. Den Eröffnungsessays folgen ein Gespräch zwischen den beiden Schriftstellern sowie ein Text von Jennifer Clement. Am 25. Juni findet eine kommentierende Gesprächsrunde in Form eines Chats statt, an der u. a. Jörg Albrecht, Paul Brodowsky, Olga Grjasnowa und Senthuran Varatharajah teilnehmen und die auf beiden Internetseiten live verfolgt werden kann. Das Projekt wird in den nächsten Monaten mit Beiträgen u. a. von Rosa Liksom, Annika Reich & Katharina Grosse, Isabel Fargo Cole, Inga Humpe, Marion Detjen, Rachel Cusk und Christina von Braun fortgesetzt.
Lesen Sie den Eröffnungsessay Hart am Wind von Antje Rávic Strubel auf S. Fischer Hundertvierzehn.
Es war, glaube ich, im Zusammenhang des Erscheinens meines Romans Tomboy, 1998, dass ich mich zum ersten Mal öffentlich als Feministen bezeichnete. Das war damals (und ist es auch heute in vielen Kreisen noch), wenngleich es in Deutschland von 1976 bis 1999 eine frauenrechtliche Zeitschrift namens Der Feminist gab, eher unüblich. Nicht nur von der Wortwahl her, sondern auch im Hinblick auf die damit verbundene Tätigkeit. Es wirkte anrüchig, wenn Männer für die Sache der Frauen kämpften, wohingegen es als selbstverständlich gegolten hatte, wenn Studierende der Geisteswissenschaften für die Rechte ausgebeuteter Fabrikarbeiter eingetreten waren. (Für die sogenannte eigene Sache kämpfte die aufgeklärte Männerwelt Europas ja spätestens seit 1789 äußerst erfolgreich, nämlich gegen die Sache der von ihnen systematisch pathologisierten Frau.) Kurzum: Ein genetisch männlicher Feminist konnte nur ein Perverser sein. Der musste eine Frau sein wollen.
Ich aber hatte wenige Jahre zuvor durch meine Lektüre der großen feministischen Dekonstruktivistinnen, allen voran Silvia Bovenschen, die bereits in den 1970er Jahren mit ihrem Werk Die imaginierte Weiblichkeit brilliert hatte, nun aber, ganz aktuell, durch Judith Butlers wegweisendes Grundlagenwerk Gender Trouble, gelernt, dass wir ohnedies keine Frauen und Männer sind, sondern dies allenfalls sein tun. Geschlechtliche Identität ist kein Fixum, sondern eine dynamische Bewegung in einem sehr komplexen Geflecht gesellschaftlicher Verabredungen. Dazu gehören sogar die (klar: biologistisch) als biologisch eingestuften primären wie sekundären Sexualmerkmale. Als Schriftsteller hat mich diese philosophische Erkenntnis geprägt wie keine andere; ich schreibe meine Romane seit zwanzig Jahren auf dieser Grundlage und habe von Judith Butler gelernt, auch die durch ihren männlichen Ausgangspunkt kontaminierte Tätersprache, die allein wir zur Verfügung haben, mit zu thematisieren, zu dekonstruieren und problematisieren.
In diesem ästhetisch-politischen Spalt lassen sich diskursive Romane verfassen, die von anderen Dingen erzählen als jene, die von den großen männlichen, vermeintlich geschlossenen, auf jeden Fall sich als autonom inszenierenden Autor-Subjekten (oft als Genies bezeichnet) verfasst wurden (und weiterhin munter verfasst werden). Die große Binarität, wie sie dem an der Kategorie der Klasse orientierten politischen Denken und Schreiben anhaftete, wurde nun durch einen genauen Blick auf die kleinen Unterschiede, auf subtile Verschiebungen und Modulationen abgelöst, wofür sich die Kategorien von Race und Gender eher anboten. Wobei auch der Komplex Class nach wie vor eine Rolle spielt, solange Frauen um ein Viertel weniger Geld verdienen als Männer. (Dieses neue Denken fand in der sich zeitgleich abseits des klassischen Rock-Songs entwickelnden elektronischen Club-Musik einen berückend schönen, gleichsam ozeanischen Soundtrack.) So geriet ich über innovative feministische Theorie zum zwischenzeitlich verloren geglaubten Politischen zurück. Ich gefiel mir in der Rolle eines gerade eben nicht autonomen Subjekts und entwickelte meine eigene Poetik von diesem fließenden Standpunkt aus.
Butlers Begriff vom doing gender musste aber erst einmal begriffen, das heißt, im sprachlichen Alltag eingeschliffen werden. Dass ein Penis auch auf einen weiblichen Namen hören konnte, zum Beispiel, brachte mich zunächst noch zum Lachen (wenn es auch ein befreiendes Lachen war). Außerdem fiel es mir anfangs schwer, Transgender-Personen mit den Pronomen ihres selbst gewählten Geschlechts zu belegen.
Besonders anschaulich wurde das vor einiger Zeit nach dem Sieg der Kunstfigur Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest, die als Frau mit Bart oder als Mann im Kleid gesehen (respektive gelesen) werden konnte. Die Medien einigten sich mehrheitlich in permissiv affirmativer Attitüde auf den weiblichen Artikel, ich fand es aber fortschrittlicher, von einem Mann zu sprechen (einem Performer namens Tom Neuwirth aus Gmunden in Oberösterreich), der hier offensiv sogenannte Männlichkeit gebrochen und um Elemente landläufiger Weiblichkeit erweitert hatte. Es war ja schon lange tolerabel gewesen, dass Frauen öffentlich in Hosen auftraten, das Gegenteil aber, mit dem wir es in diesem Fall zu tun hatten, galt als anrüchig. Da redet man lieber von einer Sie, damit die eingeübten Kategorien bestehen bleiben.
Doch das ist logischerweise kaum im Sinne der Dekonstruktion. Und deshalb fand ich es auch regelrecht bedauernswert, dass sich das androgyne Topmodel Andrej Pejic kürzlich einer sogenannten geschlechtsangleichenden Operation unterzog und die bis dato revolutionär transgressive Karriere nun als Frau weiterführt. Andrej hatte sich schon immer als Frau, die in einem Männerkörper gefangen war, empfunden. Es scheint mir im persönlichen Leidensweg vieler Transsexueller begründet zu sein, dass sie die vermeintliche Überschreitung von Kategorien letztendlich immer wieder zu deren Bestätigung führte. (Hier lässt sich von einer Ironie des Schicksals sprechen.) Was sich aber in geschichtlicher Perspektive demnächst als weitgehend überflüssig erweisen könnte. Es war ja die Gesellschaft, welche die Einhaltung der Dichotomie einforderte. (Und im Iran werden heute Männer mit homosexuellem Begehren obrigkeitlich gezwungen, sich zu Frauen umoperieren zu lassen.)
Als jemand, der diese Phänomene ganz stark im kulturellen Kontext und damit als ästhetische wahrnimmt, finde ich jene Zwischenbereiche (ihrerseits eher als Scharniere zu betrachten), in denen sich die Gegensätze nicht auflösen, sondern zur Darstellung bringen, nämlich thematisieren und analysieren, besonders reizvolle politische Zonen. Als heteronormiert lebender Mann finde ich (abgesehen von den immensen Leistungen postkolonial verprellter afrikanischer Amerikaner in der von ihnen entwickelten höchsten Kulturtechnik des uneigentlichen Sprechens namens Signifyin’) größten Gefallen an den resignifizierenden und rekontextualisierenden Strategien sexuell andersdenkender Subkulturen.
Das war schon vor hundert Jahren Mae West so ergangen, die ihren eigenen Bühnenakt entlang der Patterns von Female Impersonators aus dem Vaudeville Circuit ausarbeitete. Später gab es, im vorwiegend nordamerikanischen Lavendeluntergrund, innovative Pastiche-Konzepte wie jenes des Theater of the Ridiculous, es gab Jack Smiths Flaming Creatures, Andy Warhols famose Factory, Camp, Glam, Disco mit genetisch maskulinen Diven wie Sylvester und Amanda Lear, dann die rein performative Voguing Culture in den schräg katholisch kodierten Ballrooms von Spanish Harlem, in denen Madonna einen Weg fand, ihre eigene (heteronormierte) Rolle in queerer Hipness neu zu choreographieren, und, last but not least, Judith Butler (über Jennie Livingstons Dokumentarfilm Paris is Burning) ihr beseeltes Modell für Doing Gender entdeckte: You Make Me Feel Mighty Real war schon einer der Super-Hits von Sylvester gewesen (im Jahr bevor die phallologische Rockmusik in einem fatalen Disco Sucks-Feldzug abermals ihr hässliches Haupt erhob).
Für mich schloss sich in diesen sehr sophisticated queeren Inszenierungen aus dem Underground auch der Kreis zu meiner frühen Lektüre der französischen Symbolisten und ihrem Kult elaborierter Künstlichkeit. Bereits als Oberschüler musste ich für viele Bücher, die mich ansprachen (von Walt Whitmans Leaves of Grass über Jean Genets Notre-Dame-des-Fleurs und Hubert Fichtes Detlevs Imitationen – Grünspan bis zu Rosa von Praunheims Sex und Karriere) in Schwulenbuchhandlungen gehen. Wobei es eine solche in meiner Heimatstadt Hamburg damals noch gar nicht gab; ich musste zunächst eine Frauenbuchhandlung namens Hälfte des Himmels aufsuchen, um mein special interest zu befriedigen (und konnte dann gleich auch Werke von Emma Goldman, Virginia Woolf, Anaïs Nin und Simone de Beauvoir mit nach Hause nehmen).
Im Jahr 2004 veröffentlichte ich meinen Roman Musik, dessen Protagonisten ein Geschwisterpaar sind, sie Schriftstellerin (also ging es hier ganz besonders um sogenanntes weibliches Schreiben, dem ich mich ganz klar selbst stark verpflichtet fühle), er Flugbegleiter, und zwar von heterosexuellem Begehren geleitet, in einem, seine Kollegen genetisch männlichen Geschlechts betreffend, überwiegend schwul kodierten Umfeld, was die literarische Versuchsanordnung dieses Romans im Lauf des Schreibens, von mir aus auch der Handlung (davon gibt es bei mir nicht so viel), sukzessive aufgehen ließ: Heterosexualität erschien plötzlich nicht mehr als selbstverständlich, sondern als das Andere der Homosexualität (was etymologisch ohnedies im Terminus angelegt ist).
Die Kuratoren der Ausstellung Das achte Feld – Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit 1960 (im Museum Ludwig, Köln) beauftragten mich zwei Jahre später mit einer entsprechenden Textaufgabe, die sich in einem die Ausstellung flankierenden Erzählungsband namens Feldforschung materialisierte. Ich erhielt einschlägige Auszeichnungen wie Hetero-Autor des Monats und bekannte mich stolz als Faghag. Oh nein, du bist keine Faghag, entgegneten mir meine schwulen Freunde, Faghags seien Frauen, die schwule Männer mögen. Für Männer sei dieser Begriff nicht vorgesehen. Ich reagierte trotzig: Lieber noch wollte ich kein Mann sein als kein(e) Faghag. (Es ist erst einige Wochen her, dass ich erfuhr, es kursiere jetzt ein Begriff zu dem, wozu ich mich bekenne: I am a Fagstag.)
Bevor ich zur Welt kam, ließen sich meine Eltern von dem die Schwangerschaft meiner Mutter begleitenden Arzt anhand meiner Herztöne erklären, sie würden eine Tochter bekommen. Tatsächlich wurde ich auch meine ersten Lebensjahre hindurch häufig als Mädchen eingestuft, das heißt angeredet (und wahrscheinlich entsprechend behandelt). Dies wird mich womöglich dazu gebracht haben, die von der Norm abweichende Anrede anzunehmen und ein polyvalentes Verhältnis zum Geschlechtlichen einzuüben. Die typischen Eigenschaften des aggressiv kämpferischen, stets um homosoziale Konkurrenz bemühten Jungen blieben mir jedenfalls völlig fremd. (Ich habe mich bis heute noch nie mit jemandem geprügelt.)
In der Pubertät entwickelte sich mein Körper zunächst nicht meinen Erwartungen entsprechend, und es entstand vielleicht sogar so etwas wie Gender Dysphoria, als ich beim Kauf einer neuen Jeans in die Frauenabteilung geschickt wurde. Ich betete nun allabendlich flehentlich darum, als Erwachsener ein richtiger Mann zu werden, und ich malte mir dazu eine Erscheinung aus, die so ziemlich dem aktuellen Bild vom Hipster entspricht, ein bisschen stämmiger, breitschultriger vielleicht, mehr wie ein Mississippi-Dampfer-Kapitän und unbedingt vollbärtig. Aber ach, ich sah aus wie ein Mädchen. Ironically ließe sich rückblickend behaupten: Ich war quasi ein weiblicher Transsexueller – ein in einem Frauenkörper gefangener Mann. Meine Eltern schienen ebenfalls besorgt zu sein und ließen mich in einem Judo-Club die elegante Art der Selbstverteidigung erlernen, und vielleicht war es (falls das wissenschaftlich so haltbar ist) das forcierte Mannschaftsrudern, zu dem sie mich als Nächstes schickten, das mir einen hinreichend maskulinen Körperbau verlieh. (Jedenfalls brauchte ich mir bis heute keinen Bart wachsen lassen.)
Im Wintersemester 2011/12 hatte ich an der Goethe-Universität Frankfurt am Main die Poetik-Dozentur inne. Meinem vom autonomen männlichen Subjekt abgefallenen Selbstverständnis folgend, bestritt ich sämtliche Vorlesungen aus Zitaten, von denen ich eines (es entstammte einer Magisterarbeit über meine Romane) auf die Rückseite der Buchausgabe zu diesen Vorlesungen (die den Titel Ich als Text trägt) setzen ließ, eine Zuschreibung, mit der ich diese Selbstauskunft beschließen möchte:
Hier stellt sich Meinecke explizit in die Tradition einer weiblichen Schreibperspektive: Immer wieder proklamiert er für seine Texte feministische Qualitäten wie Durchlässigkeit, Offenheit, Unabgeschlossenheit. Das sprachliche Material durch sich hindurchgehen lassen, Diskurse zusammenflechten, verweben, verknoten, aber auch: sich darin bzw. diese in sich selbst verwickeln lassen, verweist auf eine spezifisch weibliche Ästhetik des Textilen, auf eine Metaphorik des Flechtens, Knüpfens, Strickens, Webens, die unmittelbar mit rhizomatischen Netzwerkmetaphern wie z.B. des World Wide Web korrespondiert.
Illustration auf der Startseite: Katharina Schmidt