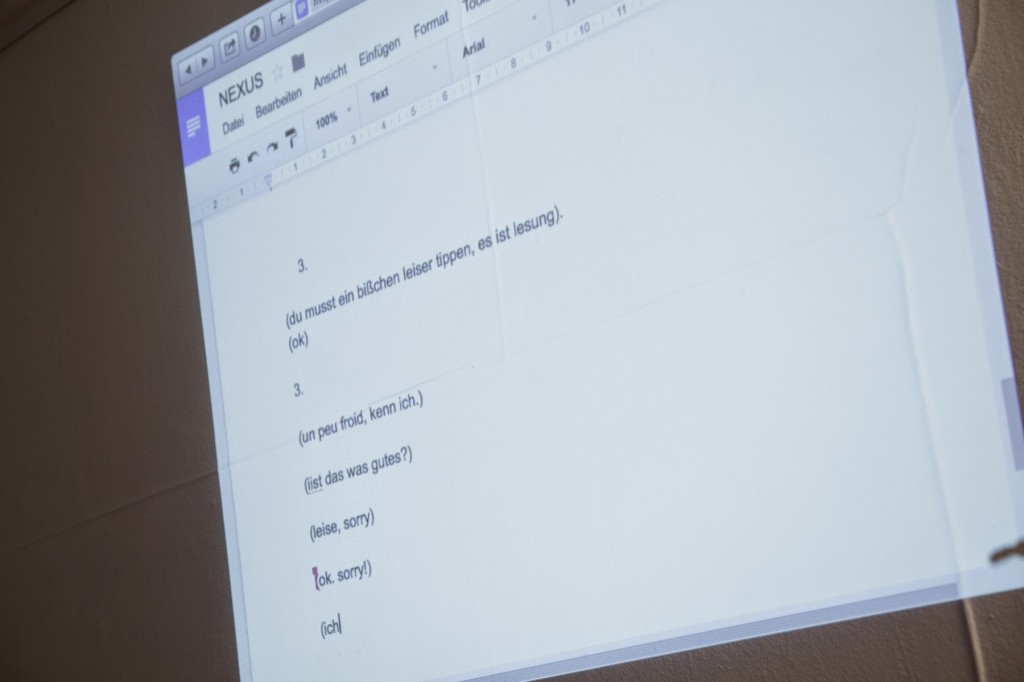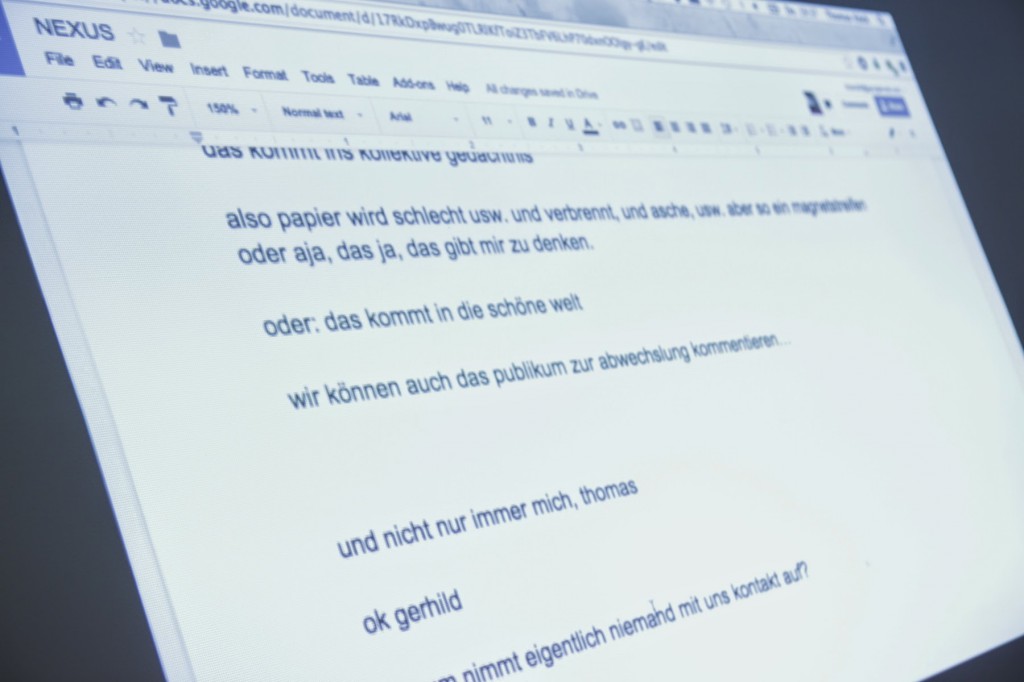Die ersten eigenen Begegnungen mit Literatur sind ja im Prinzip selten beglückend und meistens eher erschreckend. Mit einem Lehrplan aus dem letzten Jahrhundert ausgestattete PädagogInnen prügeln einem diese Marketingvokabel Weltliteratur ja immer noch eher in den Kopf hinein, anstatt zwischen mir und der Weltliteratur irgendwie zu vermitteln. Das endet dann meistens damit, dass man von der Literatur nichts mehr wissen möchte, wenn man erstmal mit der Welt zu tun hat und später, wenn man die Welt nicht mehr versteht, sich mühsam die ganze didaktisch verkaterte Literatur wieder zurücklesen muss, in der Hoffnung, dass da doch irgendwas Brauchbares drin steht. Man lernt nicht zu artikulieren, sondern zu schweigen, verliert jegliche Lust am Zeichen und kaum hat man einen eigenen Satz formuliert, schon steht der Kanon mit Skimaske und Sturmgewehr vor einem und prügelt einem wieder die Marketingvokabeln in den Kopf hinein. Das sind zumindest meine – zugegeben, vielleicht spezifisch österreichischen – Erfahrungen.
Ich habe auf jeden Fall die letzten Wochen viel über Literatur und Publikum gegrübelt. Und wie und ob man Literatur überhaupt auf diesen hässlichen Markt schmeißen soll und wofür überhaupt? Und ob man welche Form überhaupt veröffentlichen soll und darf? Und was dann die eigene Rolle ist und inwiefern sich diese Fragen alle ins eigene Schreiben hineinschreiben (dürfen) oder eben auch nicht? Oder ob man dann immer mit Beißschiene neben dem eigenen Text am Markt stehen muss und alle, die man am Markt nicht mag (also eigentlich alle, sind ja Konkurrenz), vom eigenen Text wegprügeln muss – damit man seine Kontexte schön sauber hält? Was natürlich nicht geht, es freuen sich doch alle immer andauernd darüber, endlich am Markt mitfeiern zu dürfen, wer will denn heutzutage noch irgendwen aus ideologischen Gründen verprügeln, es gibt ja schon Konzerte gegen Rechts – und man könnte ja selbst schon gleich der nächste sein, in Zeiten der finsteren Marktkrisen, da ist man doch erstmal froh überhaupt dabei zu sein und hofft, es zu bleiben. Zum einen habe ich mich das gefragt, als Autor, der schon oft gehört hat, sein Schreiben überfordere sein Publikum (das ja für den hier und jetzt gerade schreibenden Autor erst in einem verschwörerischen, finsteren Akt der Lektüre entsteht und nicht als homogene Masse mit einer statistischen Durchschnittsrezeptionsfähigkeit vorab existiert). Zum anderen weil ich im Kreuzberger Literaturhaus Lettrétage, ein Projekt namens ¿Comment! begleitet habe, als kommentierender »Profileser« (für hoffentlich zukünftige ¿Comments! bitte den Begriff dringend überdenken!) des Romans Tram 83 von dem in Graz lebenden Fiston Mwanza Mujila und als Live-Kommentator in der performativen Lesung mit Auszügen aus dem Buch Les Veilleurs, des in Paris lebenden Vincent Message.

Dissemenierte Bedeutungen von Ross Sutherlands Gedichten pflastern die Wände der Lettrétage. V. l. n. r.: Catherine Hales, Ross Sutherland, Konstantin Ames, Simone Kornappel
Die Lettrétage ist ja glücklicherweise seit längerer Zeit schon immer wieder darum bemüht, klassische Konzepte der Literaturvermittlung und den damit verbundenen, tradierten Autorschaftsbegriff insgesamt (dieser weiße Typ mit Tisch, Glas und Buch) durcheinanderzubringen, logisch also, dass auch ¿Comment! auf mehreren Ebenen klassische Formen der Literaturvermittlung erstmal in Klammern legt und nochmal einen eigenen Zugang sucht. Zum Beispiel der Publikumsbezug. Man überlegte nicht lange, was die target group interessieren könnte (kennt man ja am besten vom Kinder-/Jugendtheater, wo andauernd über die Köpfe der target group hinweg entschieden wird), sondern ließ sie selbstständig am (fremdsprachigen!) Text herausarbeiten, was sie interessierte. So kam es zu einem mehrmonatigen (mehrsprachigen!) Austausch zwischen verschiedenen Berliner SchülerInnen, den AutorInnen, den KuratorInnen und eben dem Literaturhaus Lettrétage. Sprache musste also angewandt werden, um die zeitgenössischen Texte und Codierungen von lebenden AutorInnen gemeinsam zu übersetzen. Die noch nicht ins Deutsche übertragenen Texte der neben Fiston und Vincent eingeladenen Autoren, der Lyriker Ross Sutherland (der gern mal Jean-Claude van Damme in seinen poems herbeizitiert) und Christian Prigent (und ja: die aufmerksamen LeserInnen haben es schon festgestellt – zeitgenössischer Theatertext war wieder rar gesät, muss hier festgehalten werden, in diesem Kommentar, von dem hier schreibenden Autor), wurden den SchülerInnen überlassen, die Erstübersetzungen anfertigten, Texte um- und weitererzählten, Zeichnungen anfertigten, found footage organisierten oder mit der Autokorrektur des Handys readymade-poetry anfertigten (über die hier ja auch schon berichtet wurde), und vor allem alles online dokumentierten und ihre Arbeiten gegenseitig kommentierten, bis sich auch die Autoren irgendwann einschalteten und mitkommentierten und so eine Diskussion über Literatur, Sprache und Vermittlung entstand, bei der die Texte dann irgendwann nur noch Stichwortgeber waren. Es hieß Fiston habe auf alle 120 Nachrichten persönlich und ausführlich geantwortet. Außerdem hieß es, dass es offensichtlich gar nicht so leicht war, diese Veranstaltung in den Berliner Schulen irgendwie unterzubekommen, die Lehrpläne seien vollgestopft, und viele PädagogInnen seien jetzt schon (da schon wieder:) überfordert.

Angewandte Zeichenkunde im Nexus Labor: v. l. n. r.: Karen Suender, Thomas Köck, Nadine Finsterbusch, Gerhild Steinbuch, Vincent Message, Valentin Tritschler, Denis Abrahams
Einige Schulen haben sich des Projekts dann glücklicherweise doch angenommen und damit dann die Lesungen ermöglicht, die als Abschluss den Autor samt Text inthronisierten – aus Liebe zum Zeichen. Auch hier galt: Es sollten explizit neue Lesungsformate ausgetestet werden, dafür wurden Jörg Albrecht, Simone Kornappel, Gerhild Steinbuch, Christian Filips als Kuratorinnen mit Performance-Erfahrung engagiert. Plötzlich war also die Lettrétage bis auf den letzten Stuhl voll mit pubertierenden Menschen, die darauf warteten, dass das gesamte Material, dass sich in den Monaten in den Kommentaren, Referenzen und Diskussionen angesammelt hatte, mit dem Originaltext zusammengeworfen, und in nicht-klassische Lesungsformate übersetzt wurde. So wurden zB Ross Sutherlands Materialberge, und Verweise zu einer eigenen den üblichen Lesungsraum per se blockierenden Installation, Vincent Messages Text wurde mitsamt seiner Hauptfigur »Nexus« von einem 7-köpfigen AutorInnen-Team seziert, während Gerhild Steinbuch und ich live über Publikum, Markt und Autorschaft texteten und so wunderbare, vielstimmige readymades entstanden, die jetzt in einem google drive schockgefroren der Weltöffentlichkeit für exakt 100 Jahre entzogen werden sollen. Der Unvollständigkeit halber folgt ein viel zu kurzer Auszug, der knapp 100 Seiten langen polyphonic-drive-poetry, die hier aus dem performativen drive gerissen keinen Sinn macht aber trotzdem hier und jetzt als falscher Eindruck präsentiert werden soll:
(…)
oh, tschuldige (hast du das öfter?)
(meinst du mich oder führst du selbstgespräche?)
(pst, ich hör grad die lesung, könnts ihr bitte später tippen?)
(ok sorry!)
(aber ich hab beim herfahren wirklich die ganze zeit drauf gewartet. einfach reinschießen. ach (pst!), das wär so schön!)
(aber ich schieß auf keinen. oder keinen andren menschen. ich bin schließlich nicht verrückt.)
wir können glaub ich wieder laut reden jetzt. ich glaub auch nicht, dass jemand, naja, oder du zumindest verrückt bist. also, glaub ich nicht.
ich denk mir grad: wir hätten zumindest einmal alle gemeinsam proben können, das ist ein ganz hartes multimetatasking, also was mir da jetzt alles in den kopf hineinschießt und jetzt noch deine erschießen vorstellungen dazu, und man muss immer gleich alles in der syntax korrekt formulieren, also die ganze zeit, cold-tipping sozusagen, jedes wort muss sitzen auf diesem schlechten stuhl, (was, damit du jetzt eine schöne geschichte erzählen kannst?) ich mach jetzt nexus-cold-tipping-bewusstseinsjoyce und tipp mir hier die finger wund, damit alles weitergeht und woandershin, man probt ja aber ohnehin nie was, oder man probt immer dasselbe, was dann ohnehin nicht eintritt, man probt immer einen ernstfall, den man ohnehin nicht durchzusetzen in der lage ist.
gefährlich ist auch: man ist ja gewohnt, wenn man so schreibt, seinen sachverstand unbewusst anzustoßen und ich merk, wie ich da jetzt reinrutsche, thomas, ich merk wie ich da jetzt in den sachverstand reinrutsche, gerhild (…)
Und sonst? Grumpy Cat schnaubte vorbei, die Musikerin Nadine Finsterbusch erstellte ein sehr charmantes Noise-Pop-Medley aus SchülerInnenkommentaren, Ross Sutherland präsentierte Gedichte über die Einsamkeit von SNES Charakteren und anderen halb-mythischen, halbrealen Ikonen aus TV und Medien, wie den Street Fighter Charakter Zangief oder den Multimilliardär Richard Branson (ein Faible, das der hier schreibende Autor übrigens teilt) und Fiston Mwanza der sowieso nicht einfach nur liest, sondern singt, schreit, tanzt, flucht, deliriert, tat dies mit Live-Kamera, schaltete also eine medialisierte Wand zwischen sich und das Publikum, vergrößerte sich dadurch allerdings auch riesenhaft, was die Wucht seiner Dekonstruktion des Post-Kolonialismus um nichts schmälerte. Ganz großes Kino, schöner Text und auf alle Fälle empfehlenswert. Später, im überfüllten Publikumsgespräch erklärte er dann noch: Kotzen ist sehr musikalisch. Bei Christian Prigent verwandelte sich die Lettrétage überhaupt in einen umwerfenden Poetry-Performance-Parcours, der an den Volksbühnen-Prater der 00er Jahre erinnerte. Mit Live-Sleeping, Wuttke-Smoking, nackter Haut und Publikumsüberforderung 10.0. Am Ende dann ein kurzes, charmantes »Wo bitte geht es hier zum Wasserglas?«. Die SchülerInnen waren natürlich insgesamt vollauf zufrieden, applaudierten glücklich und sprachen noch lange mit allen Beteiligten und sämtliche Befürchtungen, was wohl passieren würde, wenn man dem Autor sein Wasserglas wegnimmt, zerschlugen sich als Lehrplanängste und Marketingvokabeln. Ich war neidisch und dachte, ja, so ist das in Berlin. Angewandter Performanceunterricht schon in der Schule.

Fiston Mwanza Mujila, der eigentlich Saxophonist werden wollte, in der Live-Schaltung aus der Tram 83. Kamera: Jörg Albrecht
Das war eine recht schlaue Anmerkung, denn ich tue mir tatsächlich bis heute schwer, Zeichen zu verstehen bzw. versuche, die aus Selbstschutz, soweit möglich, durcheinanderzubringen, in Frage zu stellen, dahinterzusehen, und nicht auf den Ausdruck, sondern, ganz archäologisch, auf den Abdruck zu schauen, den so ein Zeichen hinterlässt. Das ist doch Lesen letztlich, als kulturelle Praxis, oder? Zeichenkunde. Kein bloßer Literatur- oder Sprachunterricht, sondern die Fähigkeit, Zeichen zu lesen, am Körper, auf der Straße, auf einem Foto, in der Musik, im Netz, im Stream, im Kino, in der Politik, in der Zeitung, sicher auch im Text, etc. und die Fähigkeit die Zeichen umzuschmeißen und sie umzupflanzen, oder? Also das sollte man ja idealerweise vermitteln als Literatur, oder? Zeichen, die man nicht versteht, sondern liest, Sinn, den man öffnet, nicht schließt.
Ich habe mir Literatur dann naturgemäß auch lieber über den Pop angeeignet. Das war ein anderes, geheimes Kapital, so wie Bitcoins. »Ich höre dich sagen / mehr leise als laut /Das haben sich die Jugendlichen / selbst aufgebaut« und in den drei Minuten, die so ein Song dauert, lernte man dort alles was man fürs Überleben braucht. Man lernte Zeichen lesen, man lernte Körper lesen und Blicke verstehen, man lernte, den grauenhaften, erniedrigenden Alltag in sprachliche Zeichen zu übersetzen, man lernte eine eigene Codierung der Stimme (ironischer Ton, verletzter und verletzender Ton, karikierender Ton, etc.) und bekam ein Werkzeug vermittelt, dass man der Wirklichkeit ins Gesicht schmeißen konnte. Ich lernte lesen als Praxis, als klassischer Spätzünder, eigentlich tatsächlich erst durch den Diskurspop, der einem immer freundschaftlich einflüsterte »eins zu eins ist jetzt vorbei«, und die Reste der Spex, bevor sie verraten und verkauft wurde. Ich tauschte mich in längst stillgelegten Onlineforen, in denen wochenlang Liedtexte besprochen und diskutiert wurden, mit Usern aus, die ich nur als hAuNtEdKiD, TheChemist, Börzörka oder Zweiflerin kannte. Als verschworene, anonyme Zeichengemeinschaft haben wir eine hochkomplexe, subkulturelle Form der Zeichenkunde und eigene Codes entwickelt, über die wir uns heute noch identifizieren. Diese Form der Zeichenkunde wird irgendwann auch mit uns sterben. Ich habe diese User nie getroffen, zumindest hat sich nie jemand bei mir je als Börzörka von fuckalternative.net vorgestellt, und trotzdem scanne ich automatisch das Verhalten meines Gegenübers nach Spuren von hAuNtEdKiD ab, weil ich es wichtig fand, was und vor allem wie der/die geschrieben hat und wenn mein Gegenüber zB Anzeichen des Humors von hAuNtEdKiD zeigt, ist mir dieses Gegenüber umgehend sympathisch. Für uns war dieser Kontakt vollkommen normal, wir hatten die Medien, wir eigneten uns das Wissen an bzw. entwickelten dieses Wissen und seine Regeln überhaupt erst und bis heute spielen wir nach außen hin nach diesen Regeln und insgeheim unterhalten wir einen geheimen Kontakt, wie das für ein gutes Publikum so der Fall ist. Wir etablierten einen exklusiven Geschmack, der bis heute gnadenlos gegenüber Artefakten ist, die sich nicht um die richtigen Zeichen bemühen.
In der Lettrétage kam dann doch auch wieder die Frage nach der Überforderung, die mich offensichtlich verfolgt und die ich immer nicht verstehe. Wer sein Publikum liebt, mutet ihm etwas zu, oder? Staatlich geprüfte PädagogInnen, die ich am Rande der Veranstaltung kennengelernt habe, erklärten allerdings umgekehrt, man sei froh, weil man nicht sicher gewesen sei, wie die Jugendlichen auf so eine Überforderung reagieren würden. Ich meinte dann, naja, man sei ja heute auf Facebook, bevor man laufen lernt, ginge ja schon mit 12 / 13 Jahren auf Death Metal / Drone / Miley Cyrus Konzerte, usw., überfordernd seien wahrscheinlich eher die aus der Zeit gefallenen Unterrichtsmethoden bzw. die damit verbundenen Wissensformen. Noch interessanter war dann, dass man mich heimlich im Dunkel des Raucherecks zu später Stunde ins Vertrauen nahm und mir offenbarte, dass Marktinsider von einem goldenen Topf voll Geld im Berliner Senat gesprochen hätten (und im Berliner Senat stehen nun tatsächlich nicht so besonders viele goldene Töpfe voll Geld). Nur ist dieser goldene Topf (als einer der wenigen goldenen Töpfe im Berliner Senat) immer noch voll, weil das Geld nur für Lesungen in Schulen ausgegeben werden darf und kaum jemand in Schulen lesen möchte. Dabei ist das doch die Leserschaft der Zukunft, oder nicht? #literaturmarketing
Deshalb an dieser Stelle: Lieber Berliner Senat, liebe Lehrplanverantwortliche, ich möchte bitte in euren Schulen lesen, ich möchte aber bitte vor allem zeitgenössischen Theatertext in den Schulen lesen, laut und lange, dieser wird nämlich weder in der integrativen Unterstufe, noch in der intellektuell fordernden Oberstufe mehr vermittelt, und am hässlichen Markt steht der auch nicht so gut da, in Literaturhäusern kommt er nicht vor und überhaupt da besteht noch ein viel dringenderer Aufholbedarf, dabei ist das doch die Perle der zeitgenössischen Literatur, die Höhlenmalerei des Spätkapitalismus, der Ort an dem man sich noch, mit der geballten Faust in der Hosentasche, der Sache wegen mit der Welt und dem Gift in einem selbst anlegen kann, und ich möchte bitte die Menschen dort in den Schulen endlich vom Kanon befreien, diesem Schmiermittel der Druckpressen, mit Kamerateams, Musik, fünf bis sechs schlecht bezahlten Chören einer Reihe TänzerInnen, ExpertInnen, PerformerInnen und als Highlight zwanzig bis dreißig geknebelte Operntenöre, die wimmernd durch die Wirklichkeit rollen und ich würde sagen, wer mitmöchte, kommt mit, wir holen uns diesen goldenen Topf und ziehen damit durch Berlin.