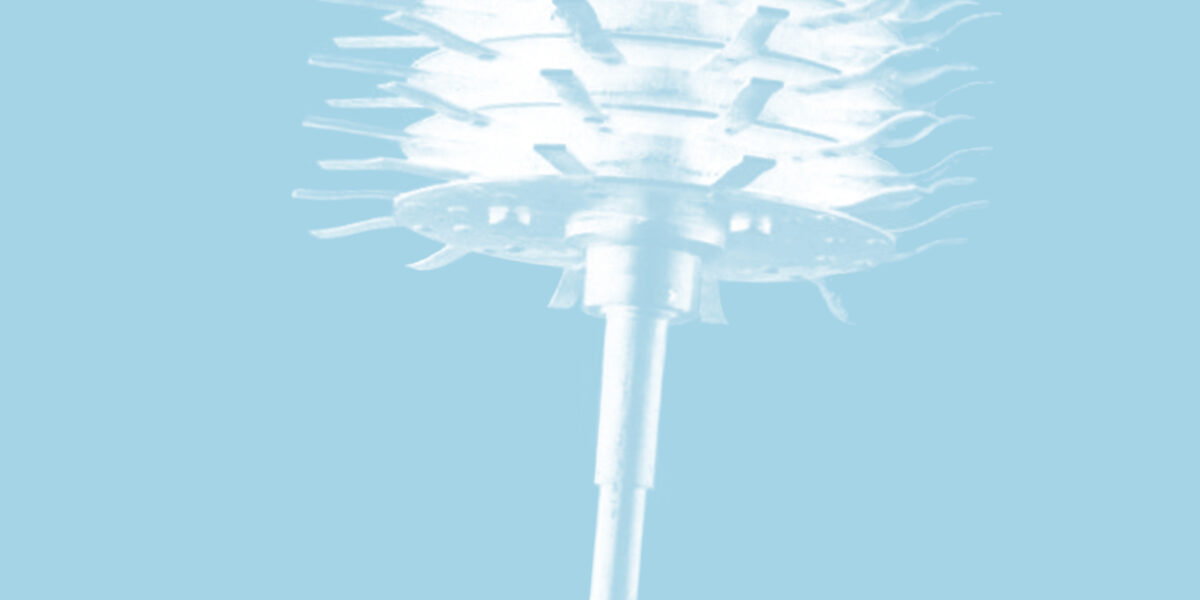Wirksame Methoden, die Angst zu regulieren: sie sich auf Augenhöhe vorstellen, sich ablenken und zerstreuen, einen Laut hervorbringen, der mehr als ein Seufzen ist, aber weniger als ein Schrei. Dem Oberkörper einen Ruck geben, die Zehen in die Schuhsohle krallen. Später, nach einsetzender Beruhigung, bewusst ein- und ausatmen, tief, aber nicht zu tief, um keine weitere Eskalation zu provozieren. Magnesium soll helfen, Johanniskraut, anders als das Apothekenblatt behauptet, eher nicht, Lorazepam auf jeden Fall. Verstärkt sich die Angst, hilft: sich irgendwo festklammern, die Beine anspannen, den Bauch herausstrecken. Manchmal hilft Kälte, manchmal Wärme, Hitze hilft nie. Langfristig hilft es, die Angst als dem Außen entgegengesetzt zu betrachten, als Schatten eines Inneren, das zu Scham und Demut fähig ist. Es ist nutzlos, sich bewusst zu machen, dass es anderen noch schlechter geht. Es stachelt die Angst nur an. Es bedeutet, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
Die Gruppentherapie fällt aus.
»Hat Ihnen keiner Bescheid gesagt?«
»Die E-Mails nicht gelesen«, murmle ich in die Maske. Die Mitpatientin aus Georgien nickt.
Die Therapeutin sieht uns mit milder Ungeduld an. Die Maßnahmen ließen noch immer nicht zu, dass ambulante Patienten das Gebäude beträten. Die Georgierin stampft mit dem Fuß auf. Ein Tritt, der auf dem Asphalt verhallt.
»Wir bieten einiges online an. Die studentische Hilfskraft kann Ihnen die Links schicken. Soll ich sie fragen?«
Wir nicken. Die Georgierin langsamer als ich.
Die Therapeutin verabschiedet sich mit einer Bemerkung zur Situation und einer vagen Handbewegung ins Klinikgebäude. Sie ist die Studienleiterin, Verhaltenstherapie als Gruppenprozess, wirkt aber selbst noch wie eine studentische Hilfskraft. Die Erklärungen der Patienten notiert sie in Stichworten in eine Kladde und markiert die zentralen Aussagen mit neonbunten Textmarkern. Sie hält die beschriebenen Ängste für kognitive Fehlstellungen. Sie agiert in einer Welt, in der das Ich ein Muskel ist, den man zur Achskorrektur strecken kann.
Ich stehe aufrecht. Ich habe gelesen, dass die Körperhaltung sich im Wesentlichen zwischen Schulter und Taille ausdrückt, und stelle mir vor, dass dieser Teil meines Körpers in Frischhaltefolie verpackt ist. Ich fühle mich wie kalibriert. Einem Hochstapler gleich verschwinde ich steif hinter einer Norm.
Der Georgierin geht es seit Beginn der Krise schlecht. Sie schaffe es kaum mehr vor die Tür, aus Angst vor den »Eurosolen« und auch den Menschen. Sie verzichte aber auf »Antidepressanten«, sie halte sich lieber an ihren Glauben, er sei ihres Daseins letzte Pflicht. Ihre Maske ist mit einer Abbildung der heiligen Nino bedruckt. Sie hat sie selbst genäht. Sie zieht ein Handy hervor, so groß wie ein Buch, wählt eine Nummer und ruft einzelne Worte in ihrer Muttersprache in das Gerät, als könne der Prozessor ganze Sätze nicht verarbeiten. Plötzlich scheint das Gespräch abzubrechen. »Mann«, sagt sie, »Häusliche Gewalt« und »Kommt jetzt mit Auto«. Gegen jede hygienische Vernunft legt sie mir ihre schweißnasse Hand auf den Arm und lässt sie dort eine Zeitlang liegen. Sie wünscht mir Gesundheit. Vor allem Gesundheit. Vor allem.
Die Wetter-App auf meinem Telefon zeigt 36° C. Die Frischhaltefolie, die ich mir zwischen Schulter und Taille vorstelle, bewahrt mich vor Diffusion, der Selbstauflösung durch Bewegung von Teilchen aus Bereichen hoher Konzentration in Bereiche niedrigerer Konzentration. Seit acht Minuten warte ich auf die S-Bahn. Die Durchmischung der Teilchen sei irreversibel, das habe ich vor einigen Tagen in meinem Telefon nachgeschlagen und bekomme es seither nicht aus dem Kopf. Ich orientiere mich an den Noppen des Blindenleitsystems auf dem Bahnsteig und zähle die Sekunden, bis die S-Bahn einfährt. Meine Finger spielen Mikado. Ich blicke auf, blinzle, erkenne aber nur Fragmente, unverbundene Flächen, die gegeneinander stürzen. Ich sehe wieder auf den Bahnsteig. Neben dem Blindenleitsystem Normalbeton. Ich bin mir nicht sicher, nennt man diese Pflastersteine H-Steine oder Doppel-T-Steine? Die S-Bahn fährt ein. Ich zwinge mich, daran zu glauben. Die Therapeutin beschreibt die Erfahrung des Unwirklichen als stetigen Kohärenzverlust. Sie empfiehlt, genauer hinzusehen. Ich steige ein, kauere mich auf einen Sitz und spioniere der Angst nach. Sie eskaliert zu Panik. Ich habe seit 42 Stunden nicht geschlafen.
Im Fernsehen läuft das Mittagsmagazin. Entweder habe ich rückwärts geschlafen oder doch ziemlich lange. Durch einen Spalt zwischen Vorhang und Fenster fällt ein gerader Streifen Sonnenlicht und brennt sich in die gegenüberliegende Wand. Es ist 13:44 Uhr. In gut acht Minuten, um 13:52 Uhr, werde ich wissen, ob die Sonne hinter dem Vorhang ihrer Bestimmung noch folgt oder bereits erloschen ist und meinen Heimatplaneten zu einem Eisklumpen veröden lässt. So lange dauert es, bis das Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht und so die Ausdehnung der Gegenwart diktiert. Ich entsperre mein Telefon und überfliege den Wikipedia-Artikel zur Sonne. Sie ist etwa 4,57 Milliarden Jahre alt und hat noch fast zweimal so viel vor sich, bevor sie sich zu einem Roten Riesen aufbläht, was den Beginn ihres Sterbens ankündigen wird. Aber Wikipedia hat nicht immer recht. Die Vorstellung, dass alles, was ich wahrnehme, der Vergangenheit angehört und in der Gegenwart womöglich nicht mehr existiert, beunruhigt mich zunehmend. Bis mein Kopf es verarbeitet hat, könnte es schon vorbei sein.
Eine Stunde später habe ich ein Kassler aus dem Eisfach geholt, es aufgetaut und angebraten und einen Rest Sauerkraut aufgewärmt. Die Braune Soße habe ich mit Mehl und Kondensmilch eingekocht. Fondor zum Nachwürzen auf dem Tischset und ein Dany-Plus-Sahne, so sieht er aus, der Donnerstagnachmittag. Für Ironie fehlt mir die Kraft. Ich versuche, mir vorzustellen, meine Zweizimmerwohnung im 6. OG eines Hochhauses, dem Boden nicht zu nah, doch stets ihm näher als dem Fliegen, sei die Mitte der Welt und der Rest nur Rand und entbehrlich, wobei ich nach einem Blick auf die Wikipedia-App in meinem Telefon weiß, dass die eigentliche Mitte der Welt seit der Kataster-Vermessung von 1817 jene Linde in Kremsmünster ist, von der aus Kaiser Franz I. seine österreichischen Lande triangulieren ließ. Ich rufe den Wikipedia-Artikel über Fondor auf und erfahre, dass man es bei Schuppenflechte nicht verwenden sollte. Während ich darüber nachdenke, ob ich jemanden kenne, der an Schuppenflechte leidet, zeichne ich eine Schraffur in den Soßenrest auf dem Teller. Im Fondor sind laut Zutatenliste Spuren von Sellerie enthalten. Vielleicht ist es das Gemüse, das die Haut krank macht. Dann weiß ich nicht weiter, und zum Masturbieren fehlt mir der Schwung.
Ich lege ein Inventar meines Körpers an: Spuren von Phosphor, ausreichend für eine winzige Explosion, Kalk zum Weißen einer Fläche, nicht größer als das Display des Handys einer Georgierin, Eisen in der Menge von einem, vielleicht zwei Nägeln, wofür man Schwefel braucht, weiß ich nicht. Annähernd ohne wahre Substanz, mag ich ausschließlich die Stellen meines Körpers, die durchscheinend sind, die Haut zwischen den Fingern, an den Wangen, an den Ohren, an warmen Tagen die Haut meines Hodensacks. Ich hinterlasse keine Spuren. Ich biete keine Angriffsfläche. Ich bin mitleidlos. Ich kann mir alles erlauben. Ich habe früher Tamagotchis verhungern lassen. Am liebsten würde ich mich nehmen und gegen die Wand klatschen. Bevor ich das Geschirr abräume, trage ich die Kalorien vom Kassler in die Kalorien-App auf meinem Telefon ein.
Ich schwanke gegen die Küchentür. Meine Knie drohen nachzugeben. Meine Finger beginnen taub zu werden. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich bekomme kaum noch Luft. Ich nehme ein Brennen in meinem Herzmuskel wahr. Es strahlt in meinen linken Arm aus. Ich werde sterben, bevor die Pandemie überstanden sein wird. Ich werde die Welt außerhalb meiner Wohnung nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Ich gehe ins Bad, klammere mich ans Waschbecken, halte den Kopf unters Wasser und wende anschließend eine Copingstrategie an, die ich in der Gruppentherapie gelernt habe: Ich richte mich auf und zähle, was ich sehe, höre und spüre, jeweils fünfmal, und dann wieder von vorne. Ich sehe die Lampe am Spiegel über meinem Waschbecken. Ich sehe die gläserne Ablagefläche unter dem Spiegel. Ich sehe eine Zahnbürste und eine Zahnpastatube in einem Zahnputzbecher, die Zahnpasta hat die Geschmacksrichtung Kräuter. Ich sehe einen Nagelclip und einen Rasierapparat. Ich sehe eine Dose mit Hautcreme. Sie ist ranzig, das sehe ich nicht, aber ich weiß es. Ich höre nichts. Nicht das Geräusch des Staubsaugers meiner Nachbarin Natascha, nicht ihre Telefonate, die sie in der Regel rufend führt, nicht ihre Spotify-Playlist alberner Pop-Songs. Ich höre Stille, pandemiebedingt, Natascha befindet sich wegen eines schnelleren Internetzugangs bei Bekannten im Homeoffice. Ich höre mein Blut in den Adern rauschen. Ich spüre Panik. Panik, Panik, Panik, Panik.
Die Copingstrategie sieht vor, zu den Symptomen der Angst zu sprechen. Mir fällt aber nichts ein. Ich lasse mich auf den Boden fallen und presse mein Gesicht auf die Fliesen. Ist eine Fliese warm geworden, nehme ich die nächste. Das ist erbärmlich, hilft aber. Ich blinzle. Zwischen den Fliesen bildet sich in den Fugen ein Gewirr steiniger Feldwege. Die WC-Ente ist ein Gülletank, der Kloreiniger ein Getreidesilo. Hinter der Badewannenverkleidung werden Rinder gehalten.
Die Angst hat mich ausgehöhlt. Die Leere in meinem Inneren ist von einer Art Exoskelett begrenzt. Eine Kutikula, bestehend aus meinem Alter, meinem Geschlecht, meiner Kleidung, den Kennzeichen meines Berufs, der Fähigkeit, zu imitieren, was andere, wie ich annehme, von mir erwarten, und dem fortschreitenden Verlust dieser Fähigkeit. Eine Kutikula aus Frischhaltefolie zwischen Schulter und Taille.
Ich erinnere mich an einen Blister mit Lorazepam in meinem Geigenkasten. Ich stehe auf und gehe ins Wohnzimmer. Es sind noch vier von zehn Tabletten übrig. Ich schlucke eine Tablette und halbiere eine zweite, nur für den Fall. Die Wirkung des Medikaments tropft vom Schädel und rinnt über den Nacken. Ich setze mich an den Esstisch, hole die Geige aus dem Kasten und beginne, sie zu putzen. Ich blase Kolophonium vom Lack, reinige die Zargen mit einem Tuch und entstaube den Saitenhalter. Dann wende ich einen alten Geiger-Trick an. Ich lasse einige Reiskörner durch die F-Löcher rieseln, bewege die Geige vorsichtig hin und her, drehe sie um und lasse die Körner unter leichtem Schütteln in meinen Schoß fallen. Mein Telefon meldet den Eingang einer Kurzmitteilung.
Marie schreibt: »Immer noch unversöhnt?«
Ich antworte: »Immer noch unversöhnt.«
Ich habe Marie vor drei Wochen zum letzten Mal gesehen. Es war einer der ersten heißen Tage, und Marie hatte eine Deichwanderung mit Abstand ab Wedel vorgeschlagen. Ich hatte einige Wikipedia-Artikel gelesen. Ich geriet in Redezwang und klärte Marie noch in der S-Bahn auf, dass, erstens, der Kreml-Flieger Mathias Rust aus Wedel stamme, für seinen Flug aber in Uetersen gestartet sei. Achtzehnjährig sei er nach Moskau geflogen, um seine Enttäuschung über den gescheiterten Gipfel von Reagan und Gorbatschow zum Ausdruck zu bringen. Nach seiner Landung habe ihm ein sowjetischer Luftwaffenoffizier erklärt, dass der Himmel kein Ort für Scherze sei. Später habe Mathias Rust versucht, eine Schwesternschülerin zu erstechen, weil sie ihn nicht küssen wollte, und sich anschließend intensiv für Yoga interessiert. Außerdem, dass, zweitens, der Showmaster Peter Frankenfeld eine Villa in Wedel bewohnt habe, dort auch gestorben sei, im Gegensatz zu, drittens, Ernst Barlach, der zwar in Wedel geboren, aber in einer Villa in Rostock gestorben sei, Marie wisse schon, Ernst Barlach, der Bildhauer, Käthe Kollwitz in Holz. Da lachte Marie. Später, nach vielleicht hundert Schafen mit Farbflecken auf der Wolle, berichtete sie bei einem Bismarckhering Unverständliches von ihrer Arbeit. Ich vergesse ständig, was sie beruflich macht, irgendwas mit Kunst im Stadtraum, obwohl sie sich vermutlich eher um die Anträge als um die Durchführung kümmert. Marie beendete ihre Ausführungen mit der Bemerkung, dass sich die Lage grundlegend geändert habe. Mir fehlte der Mut, zu fragen, was sie damit meine, und ich begann ziemlich zusammenhangslos von Gott zu sprechen, dessen Einzigartigkeit in seinem Menschsein bestehe, und die daher einen Zwang zum Individualismus begründe, aber auch zu Eigensinn und Exzentrik, was sich gegenwärtig in einem grotesken Freiheitsbegriff manifestiere, und ob es nicht besser sei, sich für eine Religion zu entscheiden, in der es mehr als nur einen Gott gebe. Die Rückfahrt in die Stadt verlief schweigsam.
Einige Tage später stellte sich heraus, was es war, das sich nach Maries Ansicht so grundlegend geändert hatte. Sie rief ungewöhnlich früh am Morgen an, das Morgenmagazin hatte erst dreimal Nachrichten gesendet, um mir in knappen Worten mitzuteilen, dass sie entschlossen sei, den erzwungenen Rückzug als Herausforderung zu betrachten. Sie wolle die Umstände, die nun einmal nicht zu ändern seien, annehmen und sie nutzen, um in einer Art nicht endendem Selbstgespräch ihre Resilienz zu stärken. Sie wünsche, das Maß ihrer Freiheit selbst zu bestimmen, und lehne es ab, diese Grenzziehung dem Verbot, das andere über sie verhängten, zu überlassen. Deshalb bleibe sie in den nächsten Wochen einfach zu Hause. Meinen trüben Einwand, dass Angstlosigkeit nur um den Preis völliger Resignation zu haben sei und dass, neurobiologisch betrachtet, nicht Mut das Gegenteil von Angst sei, sondern Neugier, wofür man sich nun mal vor die Tür bewegen müsse, beantwortete sie mit der Bemerkung, dass es schon ziemlich lustig sei, dass ausgerechnet ich das sagen würde. Während sie schwieg, kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Stadtviertel, vermutlich um versprengte Gruppen illegal feiernder Jugendlicher aufzuspüren. Ich sagte, dass ich es eigentlich ganz okay fände, ein bisschen vorsichtig zu sein, plus vielleicht ein Miniproblem mit der Amygdala zu haben, doch sie meinte nur: »Sorry«, und: »Verstehst du?«, und dass es irgendwann auch wieder vorbei sein würde, nur eben niemand wisse, wann, und ich sagte: »In Ordnung«, aber tonlos. Sanft fügte sie hinzu, dass ich einfach etwas warten solle. Pandemie bedeute warten. Dann legte sie auf.
Ich liege im Bett und lese im Telefon über Sprunggeschirre. Es sind Gurte mit angebrachtem Farbmarker, in der einfachen Ausführung ein farbiger Kreideblock, hochpreisig eine berührungsempfindliche Farbpatrone, die Schafböcken umgelegt werden, um anhand hinterlassener Farbspuren nachvollziehen zu können, welcher Bock welches Schaf gedeckt hat. Jeden auf diese Weise festgestellten Begattungsakt trägt der Schäfer in das Deckkontrollbuch ein, und wenn der Bock nichts bringt, kommt er in die Wurst.
Ich hatte mich damit abgefunden, allein zu sein. Doch dann war ich kurz vor Ausbruch der Pandemie bei einer Feier bei Freunden Marie begegnet. Sie hatte an einem Glas Rum genippt und mir von ihrer Familie erzählt, und gegen jeden inneren Widerstand verliebte ich mich in sie. Ihre Großmutter hatte bei einem Unfall den rechten Zeigefinger verloren, weshalb ihre Mutter, um die Schwester zu beaufsichtigen, die Schule hatte abbrechen müssen. Als diese Schwester alt genug gewesen war, um auf sich selbst aufzupassen, hatte die Mutter, um etwas dazuzuverdienen, in einer Apotheke ausgeholfen, sich jedoch, der Welt mittlerweile entwöhnt, im Kundenkontakt ständig im Ton vergriffen. Sie sei bald wieder gekündigt worden, obwohl sie ein Verhältnis mit ihrem Chef gehabt habe. Auf Nachfrage habe sie stets abgewunken. Das sei doch bloß der pure Sex gewesen.
Ich habe Marie nichts zu bieten. Ich bin langweilig wie ein Schluck Wasser. Ich schwitze grundlos und sehe in Badehose peinlich aus. Außerdem habe ich unerträglich viele Macken. Zum Beispiel trinke ich nur Kondensmilch, nie echte. Ich trenne meinen Müll nicht. Ich werfe alles in eine Tüte. Ich wechsle meine Kleidung nach einem zuvor festgelegten Farbschema. Manchmal esse ich abends nach dem Zähneputzen noch ein Honigbrot. Ich beschreibe die Welt durch Zahlen, die ich in meinem Telefon suche. Ich habe eine Angststörung und bin arm wie ein Student. Die Erste Geige in meinem Schülerquartett, ein Junge zwei Klassen unter mir, ist heute Weltklasseviolinist und sitzt aktuell nicht auf dem Trockenen, weil er nämlich Aufnahmen macht, Bach, Solo-Partiten, etwas in der Art. Das Cello ist Herzchirurg, und die Bratsche führt immerhin eine gut gehende Praxis für Krankengymnastik. Ich bin Gebrauchsgeiger, und wenn die Überbrückungshilfe aufgezehrt ist, werde ich nicht wissen, wie es weitergehen wird. Der letzte Auftritt hätte anlässlich einer Gedenkfeier für einen verstorbenen Reithallenbesitzer und seinen treuen Gefährten Gigolo erfolgen sollen. Wir hätten Schubert gespielt, das Andante aus Nr. 14, d-Moll. Ragna hätte darauf bestanden, dass Portamenti nicht mehr zeitgemäß seien, und Carsten hätte den Einsatz der Pizzicato-Triolen verpatzt. Der nächste Auftritt wird, falls das Infektionsgeschehen es zulässt, im Herbst stattfinden, eine Vertretung bei zwei Konzerten in Kitzbühel, organisiert vom Tiroler Tourismusverband. Es werden Arpeggien zu geigen sein.
Ich verbinde das Telefon mit dem Ladekabel und lade ein Update des Betriebssystems. Nach dem Neustart suche ich vergeblich nach Veränderungen. Ich überprüfe die Autokorrektur der Kurzmitteilungs-App. Sie bewältigt noch immer keine Worte mit potentiell sexuellem Inhalt, selbst das Wort »sexuell« nicht. Ich schreibe: »Mein Penis, ein Schlauch unter vielen.« Ich lese die Kurzmitteilung einige Male, dann lösche ich sie und schalte das Telefon aus.
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Marie am Strand. Sie hat Quallen gesammelt und zu einem Gebilde aus Glibber aufgeschichtet. Sie schmückt es mit Muscheln und einem Seestern. »Fertig«, ruft sie. »Fertig!«, und tanzt singend um den Haufen. Ich denke mich ins Bild auf ein Badelaken mit Muscheldekor. Marie kommt zu mir gelaufen und legt sich neben mich. Sie ist außer Atem. Sie ist sehr schön. Ich bekomme eine Erektion. Das Bild zerfällt in Glitches. Es bilden sich Farbverzerrungen in Magenta und Cyan.
Feindselige Funkstille. Ich öffne die Kurznachrichten-App, schließe sie und schiebe Maries Kontakt in der Favoritenliste an die letzte Stelle. Dann schlafe ich einige Stunden.
Mein Kühlschrank ist ein anschauliches Beispiel für den praktizierten Minimalismus, zu dem eine Angstkrankheit den Erkrankten zwingen kann. In den Fächern befinden sich vier Packungen Kondensmilch und eine Scheibe Gouda, die sich im Plastik wölbt, im Gefrierfach ein paar Fischstäbchen und ein Kältepack. Seit Beginn der Pandemie hat Marie manchmal für mich eingekauft, meistens habe ich mir etwas liefern lassen. Mittlerweile fehlt mir für den Lieferdienst das Geld. Ich werde den Mittelpunkt der Welt verlassen müssen und bekomme eine Ahnung davon, was es heißt, zu glauben, die Erde sei eine Scheibe. Jeder Schritt zum Rand bringt mich dem Abgrund näher. Ich rufe die Karten-App auf und lasse mir die gespeicherte Route zum Supermarkt anzeigen. Ich verordne mir kalte Zuversicht. Die blaue Markierung, eine Linie aus Eis, wird mich durch die Panik führen. Ich drücke eine Lorazepam aus dem Blister, warte, bis die Wirkung einsetzt, und gehe aus dem Haus.
Ein Sicherheitsangestellter, der die Maskenpflicht durchsetzt, lässt die Kunden mit Abstand am Eingang warten. Vor mir stehen zwei Frauen in der Schlange und rufen sich etwas zu. Die vordere schimpft, dass es absurd sei, dass man Ibu 400 ohne Rezept bekomme, Ibu 800 aber nicht, obwohl man, wenn man zwei Tabletten 400 schlucke, die gleiche Menge eingenommen habe, und dass dies einmal mehr beweise, dass der Pharmaindustrie nicht zu trauen sei. Die Frau hinter ihr, drall im Einteiler, stimmt mit fliegenden Armen zu. Sie sieht wie eine Zeichentrickbiene aus. Erleichtert stelle ich fest, dass ich mit der verrenkten Körperhaltung, die mir die Angst vorm Supermarkt wartend abnötigt, anschlussfähig bin. Nachdem mich der Sicherheitsangestellte eingelassen hat, hetze ich durch die Gänge, besorge Vorräte für mindestens eine Woche und Konserven für mindestens fünf.
Wieder zurück, erfasst mich die nächste Panik. Ich stehe vor der geöffneten Wohnungstür und bin nicht in der Lage weiterzugehen. Unter der Frischhaltefolie scheint etwas einem konturlosen Druck nachzugeben. Ich klammere mich an den Türrahmen. Vorgebeugt verharre ich mehrere Minuten, vielleicht acht, auf der Fußmatte und warte auf das Dunkel einer sterbenden Sonne. Mein Kopf ist eine Prärie. Meine Gedanken stieben auseinander wie fliehende Pferde. Die schlagenden Hufe lassen einen leeren Platz zurück. Er ist verdreckt und abgenutzt. Ich kenne ihn schon zu lange. Ich verliere die Geduld mit mir. Die Therapeutin spricht von Ambivalenzen, von Gegenbesetzungen, die ins Bewusstsein drängen.
Irgendein Instinkt trägt mich in die Wohnung. Ich lasse den Einkauf fallen und klappe den Geigenkasten auf. Ich schlucke eine weitere Lorazepam und die halbe von gestern. Dann setze ich mich an den Esstisch und beobachte meinen Atem, prüfe meine Sinne, kontrolliere meinen Pulsschlag. Die Wirkung des Medikaments legt sich wie eine Decke über die galoppierenden Gedanken. Die Sonne scheint noch immer. Ich stelle mir die Antarktis vor. Das diffuse Grau des Schelfeises ebnet meine Wahrnehmung ein. Ich döse ins Nichts.
Mein Telefon meldet den Eingang einer E-Mail. Ich schrecke auf und tippe hastig aufs Display.
marie14pelikan@swisscom.ch schreibt:
Betreff: Vorschlag.
Du könntest dich radikalisieren.
Ich antworte:
Betreff: Re: Vorschlag.
Wie?
Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich friere vor Aufregung. Während ich auf Maries Antwort warte, lese ich im Telefon einen Artikel über Adrenalin. Es soll die Bronchien öffnen. Ich versuche, tief durchzuatmen. Ich scrolle ans Ende des Artikels, um weitere Links aufzurufen, dabei denke ich nacheinander, dass, erstens, Längsfasern das Fleisch zäh machen und dass man beim Kauf darauf achten sollte, zweitens, ein Nurdachhaus an einem schattigen Bach eine schöne Behausung ist, ich, drittens, durch Gewichtszunahme mehr biologische Realität gewinnen und, viertens, einer NGO beitreten könnte. Dass, fünftens, meine Gliedmaßen Dendriten sind, ich aber, sechstens, gerade deswegen jetzt unter den Bedingungen der Pandemie ins Theater gehen sollte, wegen des Zugewinns an Beinfreiheit. Dass die Corrente, siebtens, der Partita für Violine Solo Nr. 2, d-Moll, von Bach die passende Länge hat, um zweimal gründlich die Hände zu waschen und sie auch abzutrocknen, dass, achtens, Leute, die eine Frage nicht beantworten können, meistens sagen, dass es sich hierbei um eine gute Frage handle, und, neuntens, »Brauchtum« eigentlich ein schönes Wort ist. Bei zehn erreicht mich die nächste Mail.
Marie schreibt:
Betreff: Re: Re: Vorschlag.
Wenn die Hochhäuser einstürzen und die Regierenden in die Keller evakuiert werden und sich dort gegenseitig umbringen, vielleicht mit Sprengstoff, auf jeden Fall mit Hass, wenn die Lobbyist:innen verzweifelt in die Flüsse springen, wenn Aufsichtsrät:innen an Straßenböschungen, auf bepflanzten Verkehrsinseln, im Park oder in Privatgärten, auf jedem Stück unversiegelter Erde nach Essbarem wühlen, aber nichts finden außer Gestrüpp und sich um ein paar Würmer streiten, wenn Feuilletonist:innen sich eingestehen müssen, dass sie das alles nicht vorhergesehen haben und deshalb ihre Festplatten zerstören und ihre Büros in Brand setzen, bevor sie sich aus dem Fenster stürzen, wenn die Wette auf die Zukunft endgültig verloren sein wird und der Markt, der Markt, der Markt zusammenbricht, das System kollabiert und der Hack sich für Jahrzehnte im Code einnistet, wenn das CO2 und die Ignoranz und die Bosheit, der Stumpfsinn und die Monotonie die Atmosphäre zerstört haben und das Meer kommt und alles verschlingt, könntest du als Teil des Lichts auf der anderen Seite stehen und freundlich lächeln. Amen.
Ich schreibe an Marie:
Betreff: Re: Re: Re: Vorschlag.
Ich rufe lieber mal an.
Ich schiebe Maries Kontakt in der Favoritenliste auf den ersten Platz zurück und tippe auf die Nummer. Während es klingelt, sehe ich Maries Foto auf dem Display. Mithilfe der Foto-App habe ich den Kontrast des Bildes erhöht, um die Sommersprossen auf ihrer Nase zählen zu können. Es sind 52. Marie nimmt den Anruf an, und ich höre sie atmen. Es pfeift ein wenig. Vielleicht gibt es Liebe auch ohne Halt. Vielleicht gibt es ein Glück, das dem anderen die Freiheit nicht neidet.
Ich erzähle ihr von meinem Freund Toddy. Früher war Toddy Punk und Messdiener, zwar mit Nieten auf dem Gürtel, die so flach waren, dass sie niemanden stachen, aber er kannte die Leute von Slime, na ja, vom Bassisten den Bruder. Wenn Frau Genast, eine pensionierte Schulsekretärin, uns auf der Straße begegnete oder in der Grünanlage hinter der Siedlung, wandte sie sich ab, bekreuzigte sich und murmelte: »O selige Dreifaltigkeit.« Toddy war mit Anja zusammen, sie kannten sich seit dem Kindergarten und hatten dort geheiratet. Doch als Volker in die Siedlung zog, fühlte sich Anja an das Eheversprechen nicht mehr gebunden. Volker war Jugendtrainer im Volleyballverein und hatte veranlagungsmäßig breite Schultern. Eine Zeitlang ritzte Toddy schwer verständliche Zeichen in die Tür der Sakristei, dann schiss er auf Volleyball und ließ sich auch nicht mehr zum Ministrieren einteilen. »Die Matrix hieß noch Holodeck, und im Fernsehen lief der erste Golfkrieg. Tagelang grüne Flocken vom Nachtsichtgerät auf dem Bildschirm. Modern Talking hatte sich aufgelöst, und Thomas Anders schminkte sich die Augen mit Kajal, trug aber den Namen seiner Freundin als Kette um den Hals, Nora, sehr verwirrend, auf jeden Fall habe ich Toddy vor ein paar Wochen wiedergetroffen. Nach einem Suizidversuch mit anschließendem Psychiatrieaufenthalt glaubt er jetzt, dass man nur mit dem Herzen gut sieht und das Wesentliche für die Augen und so weiter. Er begegnete mir mit Spott, weil ich nichts von Mikrochips wissen wollte, nichts von Merkel und dem Reim auf Ferkel, nichts von Kindern, die in Kellern gehalten werden, damit sich die Mächtigen mit ihrem Blut bevorraten können. Die Therapeutin nennt es übrigens kollektive Regression. Toddy sagt, dass er sich keinen Maulkorb anlegen lassen werde und dass es ihm damit gut gehe. Seit langem wieder einmal gut gehe.«
»Wie genau hieß die Schulsekretärin?«, fragt Marie.
»Frau Genast«, sage ich, und es kommt mir so vor, als teilten Marie und ich nun ein Geheimnis. »Toddy ist sicherlich nicht der Grund für meine Angst, aber vielleicht daran beteiligt, dass sie nicht weggeht.«
Ich schließe die Augen und sehe Maries Gesicht wie Speiseeis in der Sonne schmelzen. 52 Sommersprossen aus Krokant rinnen von der Nase. Ich sage ihr, dass ich mich ohne sie extrem gelangweilt hätte. Sie sagt, dass Langeweile manchmal ein Ausdruck von Freiheit sei, und kann nicht mehr aufhören zu lachen. Irgendwann fügt sie hinzu, dass Vertrauen einfach der Entschluss sei, Verletzungen künftig nicht mehr einzukalkulieren. Ich liebe Marie. Ich merke es daran, dass sich die Frischhaltefolie in Velours verwandelt. Ich hoffe, dass sie es weiß, denn ich werde es ihr niemals sagen.
»Ich finde, dass die Seuche ruhig noch ein bisschen weitergehen kann. Es ist doch ganz schön zu wissen, dass man nichts versäumt, weil gerade sowieso nichts passiert. Wenn es vorbei ist, werden die anderen uns verpflichten, wieder teilzunehmen. Vielleicht sogar noch mehr teilzunehmen. Endlich mal so richtig teilzunehmen. Mit Leuten wie mir werden sie dann ungeduldig sein.«
»Lass sie«, sagt Marie. »Sie drehen gerade durch und verwechseln das mit Sinn. Denen und deinem Freund Toddy wäre ein Duplikat der Erde zu wünschen, irgendein Klonplanet, auf dem sie sich austoben können. Dann könnte sich der Ausgangsplanet mal eine Zeitlang erholen.«
»Ein Holodeck«, sage ich, »in dem Glitches nichts ausmachen.« Ich wimmere ins Telefon, weil ich meine, dass Glitches so klingen würden, hätten sie einen Klang. »Eigentlich würde es mir schon reichen, endlich wieder zur Gruppentherapie zu gehen. Mir fehlen die anderen. Mir fehlt sogar die Therapeutin mit ihrer Empathie aus dem Technikbaukasten. Mir fehlt es, am Ende des Stuhlkreises die Stühle an den Rand zu räumen, um Platz für das Reinigungspersonal zu machen, und ich würde mich gerne mal mit der Georgierin über Ehescheidung unterhalten.«
Marie schweigt eine Weile, dann sagt sie: »Vielleicht werden wir wie die Pflanzen und entwickeln Methoden des Glücks, die es nicht mehr notwendig machen, sich groß fortzubewegen.«
»Ja«, sage ich. »Vielleicht werden wir wie die Pflanzen.«
Marie sagt: »Ich habe übrigens Käsekuchen gekauft.«
»Lecker«, sage ich und werde ein bisschen traurig. »Hättest du eine Drohne, könntest du sie mit einem Stück plus Sahne vorbeischicken.«
»Du kannst mir auch einfach aufmachen«, sagt Marie. »Ich stehe vor der Tür.«