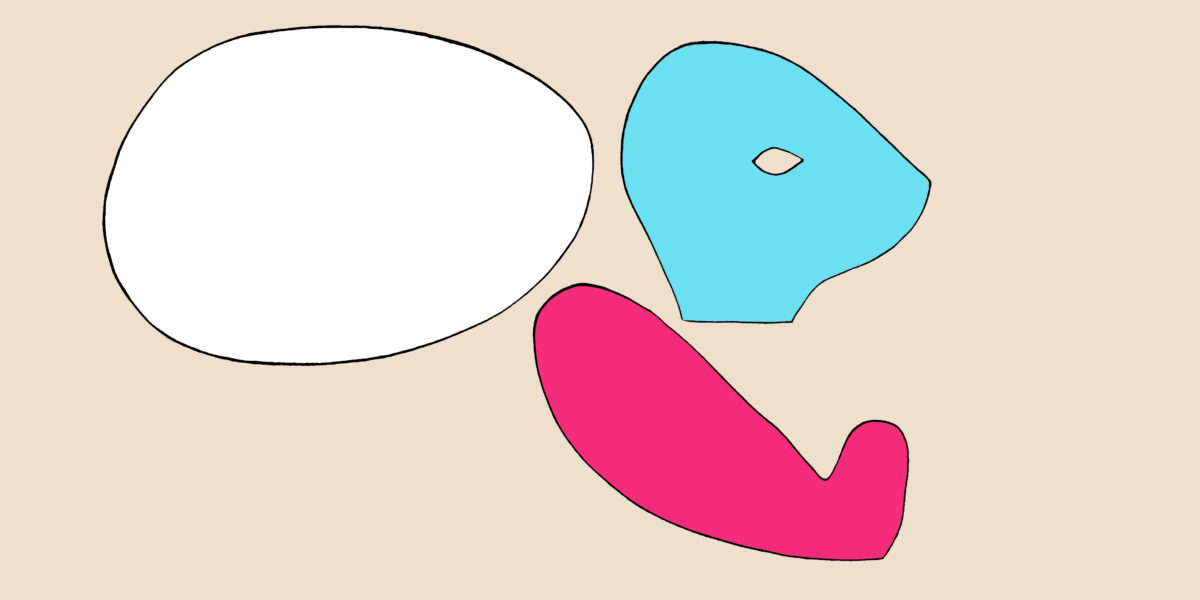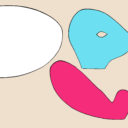Sasha Marianna Salzmann war Autorin der Mainzer Poetikdozentur 2019. Der folgende Text ist ein Kapitel aus ihrem Vortrag mit dem Titel »Dunkle Räume«.
Es ist eine immer wieder aufs Neue irritierende Erfahrung: Ich sitze an meinem deutschen Eichentisch, tippe in meine Logitech-Tastatur, in meiner Dachgeschosswohnung, in einem der besseren Wohnbezirke der Hauptstadt, Füße im Warmen, Wasser und Kaffee und Bücherberge um mich herum, und plötzlich fange ich an, auf Russisch zu schreiben, obwohl bis zu diesem Moment Sätze, Absätze, ganze Seiten wie selbstverständlich auf Deutsch aus mir herausgeflossen sind. Heißt das, ich stoße jetzt vor zum Eigentlichen in mir, zum Verborgenen, oder heißt das, ich kann immer noch kein Deutsch? Fehlen mir immer noch so viele Wörter, fehlt mir die Verbindung zwischen den Sprachen, der ersten, meiner Muttersprache, und der, die jetzt meine Schreibsprache ist? Was fehlt mir?
Ich bin: ein Name, der weder in meinem Ausweis noch auf der Geburtsurkunde vermerkt ist, der aber für viele von jenen, die mir heute nahestehen, der einzige ist, mit dem sie mich rufen können. (Als man meinen Geburtsnamen aus dem kyrillischen Alphabet in lateinische Buchstaben übertrug, wurde er zu einer vagen Interpretation dessen, was er einmal war, es fiel mir nicht schwer, ihn hinter mir zu lassen.)
Ich bin: süchtig nach türkischen Kosenamen, wenn sie im Zuge einer Konversation fallen. Ganz egal, in welcher Sprache der Rest des Satzes funktioniert, ich werde der Sprecherin zuhören bis spät in die Nacht. (Jedes türkische Kosewort trägt das Echo meiner Zeit in Istanbul, das Klirren der Teegläser und den Ruf der Simit-Verkäufer.)
Ich bin: jemand, der auf Englisch träumt, aber es nicht schafft, auf Englisch ein Gedicht zu verfassen.
Ich bin: die Walenki, die ich über meine Schuhe stülpe und hochziehe bis zu den Waden, damit sich meine Hosenbeine nicht vollsaugen mit dem eiskalten Moskauer Regenwasser.
Und nun will ich mit jeder von Ihnen eine Zigarette teilen, die weiß, was Walenki sind. Mein Gefühl wird mir vorgaukeln, wir hätten etwas gemeinsam und müssten uns im Übrigen nicht weiter verständigen, wir wüssten das meiste voneinander, ein Austausch in Halbsätzen und unverbindlichen Gesten würde reichen. Denn eine gemeinsame Sprache ist eine Falle, in die wir allzu bereitwillig stolpern. Oder nicht?
Wie ein Kind, das die Arme nach seiner Mutter ausstreckt, auch wenn sie es nie mit Liebe überschüttet hat, so reiße ich im ersten Augenblick die Arme vor dem Russischen auseinander und verschränke sie sogleich wieder, weil ich ahne, dass keine Umarmung folgen wird. Ich habe Angst vor dem, was ich von Fremden und Bekannten in meiner Muttersprache hören werde. Ich habe Angst davor, was man mit ihr heute assoziiert: Sie ist zu einer Art Synonym für Grobheit, Aggression und Fake News verkommen. Und bestenfalls gebunden an eine nostalgische Erinnerung an einen Kanon, in dem das zwanzigste Jahrhundert schon keine Rolle mehr spielt: Puschkin, Dostojewski, Tschechow.
Meine Beziehung zu meiner Muttersprache ist vergleichbar mit den unaufhörlich verschiebbaren Steinchen eines Rubikwürfels. Sie nennen ihn im Deutschen auch Zauberwürfel, auf Russisch sagen wir – oder sagt man? – кубик рубик, im Englischen kennt man das Drehpuzzle als Rubik’s Cube, auf Türkisch musste ich es nachschlagen: Rubik Küp. Die Elemente sind permanent in Bewegung, kommen nie zusammen, ergeben nie ein gemeinsames Bild. Zumindest habe ich die Puzzlesteine nie zu einer monochromen Fläche schieben können.
Ich weiß, dass der Kiefermuskel von Menschen, deren Geburtssprache Russisch ist, eine bestimmte Dehnbewegung erlernen muss, um den Buchstaben ы auszusprechen. Verbindet uns das? Oder macht es ein gemeinsames Weltbild aus, dass Russischsprechende zur Schwiegermutter »Eigenblut« sagen, wenn man diese Vokabel wortwörtlich ins Deutsche überträgt? Wenn eine Frau heiratet, wird sie auf Russisch sagen: »Ich stehe hinter meinem Mann.« Wenn sich ein Mann trauen lässt, sagte er auf Russisch, er sei »befraut«.
Die Bildsprache scheint klar: Ein Mann hat eine Frau an sich kleben, wenn er heiratet. Die Frau stellt sich hinten an, wenn sie sich vermählt.
Für andere Geschlechter als männlich und weiblich – wie Transgender und nicht binäre Menschen (zu den letzteren zähle ich mich selbst) – lässt die russische Grammatik keinen Platz, dennoch kommen wir vor: beispielsweise im Strafregister, als Individuen, denen das Autofahren, aufgrund ihrer geistigen Verfassung, untersagt ist. Auf diese Art nimmt man zur Kenntnis, dass es uns gibt.
Die Historie, die eine jede Sprache mit sich bringt, klebt an der Sprechenden wider Willen.
Sie alle wissen, dass die meisten Menschen im Ausland an Hitler denken, wenn Sie ihnen gegenüber erwähnen, dass Deutsch ihre Sprache ist. Ob man es offen ausspricht oder Ihnen verschweigt, dieser Name ist unauflösbar mit dem Deutschen verbunden. Für mich als Jüdin rufen nach wie vor deutsche Wörter wie Kammer, Zug, Waggon, Lampe oder Seife die Assoziation mit Vernichtungslagern auf.
Wenn ich auf Menschen treffe, die in der russischen Sprache aufgewachsen sind, höre ich (neben Puschkin, Dostojewski und Tschechow) auch: Verschleppung, Staatsterror und Gulag.
Möglicherweise weiß der Mensch, der mit mir spricht, selbst nicht, ob er das Trauma der Stalinzeit in sich trägt. Vielleicht hatten seine Vorfahren im Gegenteil unter Stalin die besten Zeiten. Seine Sprache transportiert in jedem Fall die Erinnerung an Verbrechen, aber ihn selbst kann man möglicherweise nicht nach vererbten Traumata fragen. Weil er vielleicht selbst nicht gefragt hat. Weil er vielleicht nicht wissen will, ob Familienangehörige an Massenerschießungen beteiligt waren oder bei Exekutionen umgekommen sind. Vielleicht will er nicht wissen, ob sie Ausführende oder Opfer waren.
Beides, vermute ich im Fall meiner Familie. Aber ich weiß es nicht. Keiner kann es mir sagen.
Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, die eigene Mutter in der Muttersprache zu fragen, wer von den Familienangehörigen im Gulag gewesen war. Мама, кто из наших родственников был в гулаге? Und wo der Unterschied darin liegt, es nicht auf Deutsch zu tun.
Diese Distanz zur Sprache brachte ich nach Deutschland mit, ich brachte sie in mein Deutsch-Sein mit, ich misstraue der Sprache, in der ich meine Romane, Essays, Theaterstücke und Reden heute verfasse. Und ich mache meinen Zweifel sowohl im Satzbau als auch in der Wortwahl deutlich. Ich öffne nicht die Arme zur Begrüßung, und die deutsche Sprache tut nicht so, als wären wir verwandt. Sie ist ausgesucht höflich zu mir und erinnert mich permanent daran, dass ich angeheiratet bin. Wir begegnen uns offen in unseren wechselseitigen Anspannungen: Ich erkläre ihr, dass sie nie reichen wird, und sie mir, dass ich nie reichen werde.
Das Deutsche ist für mich eine permanente Übung in Selbstkritik (ich bin nicht eloquent genug, nicht belesen genug, ich hätte Kleist viel ernster nehmen sollen in der Schule) und gleichzeitig ein Experimentierfeld. Wie hebelt man eine so von sich überzeugte, geradlinige Sprache aus? An welchen Stellen lässt sie mal locker?
Das Russische kann schnell schwülstig werden und lacht allzu gerne, sodass ich mir fast jede Metapher untersagen muss. Das Deutsche hingegen provoziert mich, Pirouetten zu drehen.
Vielleicht ist die Distanz, das Gefühl, an einer Sprache zwar teilzuhaben, aber ursprünglich nicht eingeladen worden zu sein, produktiv, weil es zu einem genaueren Hinhören und Hinschauen zwingt. Wenn man nicht weiß, wie der Weg weitergeht, kann man sich auch gleich einen neuen, eigenen suchen.