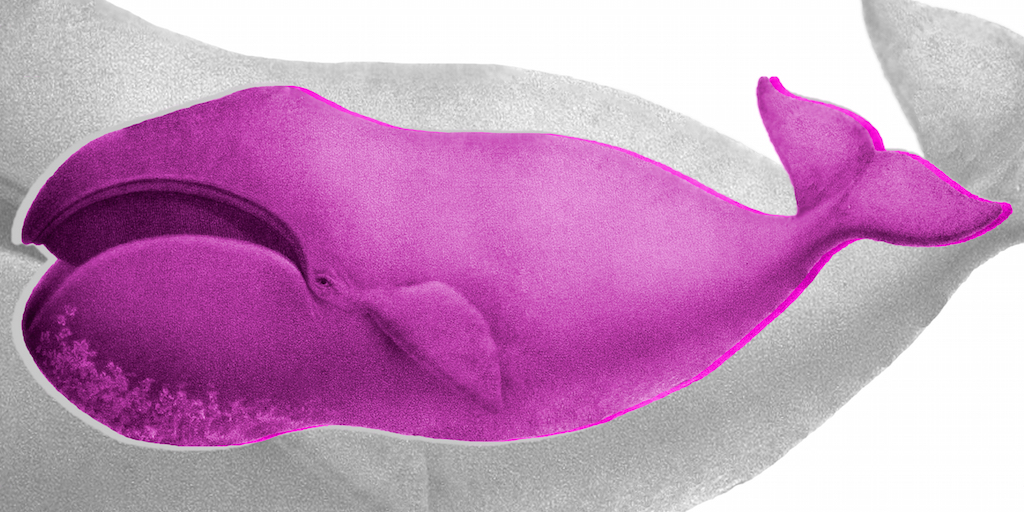Mit dem Projekt »Feminismen: Wie wir wurden, wie wir leben, was wir sind« von Thomas Meinecke und Antje Rávic Strubel setzen Logbuch Suhrkamp und S. Fischer Hundertvierzehn ihren im vergangenen Jahr begonnenen Austausch fort. Am 17. Juni erschienen die beiden Eröffnungsessays Wie ich Feminist wurde von Thomas Meinecke und Hart am Wind von Antje Rávic Strubel. Am 25. Juni fand eine kommentierende Gesprächsrunde in Form eines Chats statt, an der u. a. Jörg Albrecht, Paul Brodowsky, Olga Grjasnowa und Senthuran Varatharajah teilgenommen haben. Das Projekt wurde mit Essays von Rosa Liksom, Annika Reich & Katharina Grosse, Isabel Fargo Cole, Inga Humpe und Marion Detjen fortgesetzt. Im heutigen Beitrag denkt Rachel Cusk über weibliches Schreiben nach.
Gibt es heute eine Literatur, die sich als »weiblich« bezeichnen ließe? Sicher, hin und wieder darf eine Frau das Preisgeld des Man Booker oder des Costa Prize entgegennehmen, und hin und wieder steuert sie den Jet, der einen von New York nach Hause bringt. Möglicherweise beschleicht manche gesellschaftlichen Gruppen in beiden Fällen ein Gefühl der Unsicherheit. Dabei habe ich den Eindruck, dass »weibliches Schreiben« nicht von Natur aus nach Gleichheit in der Männerwelt streben würde. Es wäre ein Schreiben, das Unterschiede nicht bestreiten, sondern betonen will.
Wenn eine Frau sich heute ans Schreiben macht, fühlt sie sich vielleicht eher geschlechtslos. Sie möchte weder bestreiten noch betonen; sie möchte einfach nur in Ruhe arbeiten. Vielleicht empfindet sie sogar eine gewisse Abneigung gegenüber dem Konzept des »weiblichen Schreibens«. Warum sollte sie politisiert werden, wenn ihr so gar nicht danach ist? Am Ende ist es für sie vielleicht sogar eine Frage der Ehre, ihre Prosa gegen diese Art der Vereinnahmung zu verteidigen. Was eine Frau beeinträchtigt – Kinder, Familienleben, Mittelmäßigkeit –, beeinträchtigt das Schreiben noch viel mehr. Sie aber hat diese Beeinträchtigung überwunden – knapp. Sie führt ein freies und gleichberechtigtes Leben, anders als vermutlich ihre Mutter. Und doch ist sie kein Mann. Sie ist eine Frau, und die Unterschiede zwischen ihr und ihrer Mutter hat allein die Geschichte hervorgebracht. Sie sieht sich um und muss feststellen, dass das Leben der Frauen sich in mancherlei Hinsicht verändert hat und in anderen Hinsichten weitgehend gleich geblieben ist. Es reicht ein Blick auf den eigenen Körper; wenn der weibliche Körper eines zeigt, ist es die Dominanz der Wiederholung über den Wandel. Dabei ist der Wandel bewundernswerter und erfreulicher. Am Buch des Wandels zu schreiben ist angenehmer, als das Buch der Wiederholung fortzuführen. Wer am Buch des Wandels schreibt, darf über absolut alles nachdenken, außer über das Ewige und das Unabänderliche. »Weibliches Schreiben« ist vielleicht nur eine andere Bezeichnung für das Buch der Wiederholung.
Zwei Texte, Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht und Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein, sind Ausdruck dieser Überlegung. Beide beeinflussten den Diskurs über das weibliche Schreiben im 20. Jahrhundert maßgeblich, und diese Prägung ist bis heute spürbar; beide setzen bekanntermaßen bei der Frage nach dem materiellen Besitz an. De Beauvoirs These von der historischen Marginalisierung der Frau durch männliches Besitzstreben ist eine Zuspitzung von Woolfs literarischer Annäherung an die weibliche Armut – Armut in konkreter wie expressiver Hinsicht. Um schreiben zu können, braucht die Frau ein Zimmer für sich allein; ihr Schweigen ist folglich das Schweigen der Enteigneten. Und doch liegt ihrem Schweigen noch etwas anderes, viel Rätselhafteres zugrunde, nämlich das Rätsel um ihre Identität. Woolf und de Beauvoir sind sich einig, dass keine Frau – nicht einmal die mit eigenem Zimmer – ein Buch wie Moby Dick oder Krieg und Frieden hätte schreiben können, denn »die Zivilisation an sich bringt dieses Zwischenprodukt zwischen Mann und Eunuch hervor, das wir das Weibliche nennen«. Den Frauen fehlt nicht nur ein eigenes Zimmer, sondern auch eine eigene Literatur. Halb Schweigen, halb Rätsel: Der Begriff »weibliches Schreiben« benennt nicht einfach eine von Frauen geschriebene Literatur, sondern eine, die unter typisch weiblichen Lebensumständen entsteht und durch sie geformt wird. Ein Buch wird nicht dadurch zu einem Beispiel für »weibliches Schreiben«, weil es von einer Frau geschrieben wurde. Vielleicht kann Literatur erst dann als »weiblich« gelten, wenn kein Mann sie produziert haben könnte.
Bei de Beauvoir ist die Frau eine Bettlerin; genauer gesagt ist sie nicht als Bettlerin geboren, sondern sie wird zu einer. Sie ist in der Versklavung umfassend erniedrigt und erniedrigt sich zusätzlich selbst, indem sie um den Männertisch herumscharwenzelt und auf Reste hofft. Bei Woolf hingegen ist die Frau eher Opfer, Gefangene. Das Berufsverbot wird ihr erteilt, die Deformierung ihres Charakters geht auf ihre Lebensumstände zurück. »Die Kunst, die Literatur, die Philosophie sind Versuche, die Welt neu auf eine menschliche Freiheit zu gründen«, schreibt de Beauvoir, »auf die Freiheit des Schöpfers. Um ein solches Ansinnen zu nähren, muss man sich zuerst eindeutig als eine Freiheit setzen.« Gewiss, einer Frau kann Freiheit gewährt werden, doch keine Frau ist je von Anfang an frei: »Will man die Welt neu begreifen, muss man erst in einer souveränen Einsamkeit aus ihr auftauchen.« Die Versuchung für die Schriftstellerin, schreibt de Beauvoir, liegt nun darin, das Schreiben als Flucht zu benutzen. Die Schriftstellerin möchte der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, denn »ihre größte Sorge ist die, zu gefallen, und oft fürchtet sie schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie schreibt, als Frau zu missfallen. Originalität im literarischen Ausdruck erregt immer Anstoß. […] Die Frau, noch ganz erstaunt und geschmeichelt, in dieser Welt des Denkens und der Kunst, die eine Männerwelt ist, überhaupt zugelassen zu sein, zeigt ein wohlanständiges Benehmen. Sie traut sich nicht zu stören, zu forschen, aus sich herauszugehen.«
Und so verliert die Schriftstellerin bei dem Versuch, sich der männlichen Schreibkultur anzupassen, ihre Integrität – und damit ihre Chance auf Größe. Denn der Mann ist, wie de Beauvoir schreibt, »ein geschlechtlicher Mensch. Die Frau kann nur dann ein vollständiges Individuum und dem Mann ebenbürtig sein, wenn auch sie ein geschlechtlicher Mensch ist. Auf ihre Weiblichkeit verzichten hieße, auf einen Teil ihrer Menschlichkeit verzichten.« Gleichheit kann folglich nur über den Unterschied erlangt werden. Doch was bedeutet das für die Schriftstellerin? Muss sie sich mit dem Schweigen und dem Rätselhaften identifizieren, wie der männliche Autor sich mit Moby Dick identifiziert? Die weiblichen Kulturschaffenden des 21. Jahrhunderts wissen kaum noch, was sie dem Feminismus zu verdanken haben; wozu auch? In der Konsequenz vermeidet es die schreibende Frau von heute, allzu großes Interesse an den Frauen von heute zu zeigen. Doch wenn schwarze Autorinnen und Autoren in ihren Werken nicht mehr ausloten, was es bedeutet, schwarz zu sein, schließen wir daraus noch lange nicht, dass schwarz zu sein keine weiteren Auswirkungen auf das Leben hätte oder es keinen Rassismus mehr gäbe. Die Unterdrückung, auch eine Form der Beziehung, kann nicht überwunden, sondern nur umgestaltet werden; in den ständig sich abwechselnden Phasen von Scham und Achtsamkeit muss stets mit Rückfällen gerechnet werden. Mal ist die Gesellschaft achtsam für die Sprache der Unterdrückung, mal ist sie es nicht, und dann muss man sich dafür schämen, unterdrückt zu sein. Frauen stellen also nicht deshalb das »weibliche Schreiben« ein, weil sie freier wären, sondern weil sie sich schämen, weil sie der allgemeinen Aufmerksamkeit nicht trauen, vielleicht sogar, weil sie Verunglimpfung fürchten.
Historikerin zu sein ist leichter, als Prophetin zu sein. Als Virginia Woolf meinte, eine Frau brauche zum Schreiben ein Zimmer für sich allein und eigenes Geld, entwarf sie eine weibliche Zukunft, in der Eigentum – Besitz – gleichbedeutend ist mit Worten, während Enteignung dem Schweigen entspricht. Eine Frau mit Geld und eigenem Zimmer hat die Möglichkeit zu schreiben – doch worüber? In Ein Zimmer für sich allein stellt Woolf zwei Behauptungen auf: Erstens, dass die Welt und damit auch ihre Abbildung in der Kunst eine nachweislich männliche ist, zweitens, dass eine Frau gar nicht in der Lage sein kann, aus der männlichen Wirklichkeit Kunst zu schöpfen. Und auch die Literaturgeschichte ist zu weiten Teilen in dieser männlichen Wirklichkeit verortet. Form und Struktur des Romans, der ganze Wahrnehmungsapparat, Art und Gestalt des literarischen Satzes waren Werkzeuge, die von Männern zum Eigengebrauch entwickelt wurden. Die Frau der Zukunft, schreibt Woolf, wird einen eigenen Satzbau ausbilden müssen, eine eigene Form, und die wird sie gebrauchen, um über ihre eigene Wirklichkeit zu schreiben. Mehr noch, diese Wirklichkeit wird eigenen Wertvorstellungen folgen: »Und da ein Roman diese Verbindung zum realen Leben hat, sind auch die in ihm vertretenen Werte bis zu einem gewissen Grad die des realen Lebens. Natürlich weichen die Wertvorstellungen von Frauen oft von den durch das andere Geschlecht postulierten ab; es kann gar nicht anders sein. Und doch setzen sich am Ende die maskulinen Werte durch … Dies ist ein wichtiges Buch, behauptet der Kritiker, denn es handelt vom Krieg. Dies ist ein unwichtiges Buch, denn es handelt von den Gefühlen von Frauen in einem Wohnzimmer. Eine Szene, die auf dem Schlachtfeld spielt, ist wichtiger als eine Szene aus einem Einkaufsladen. Überall und zunehmend subtil besteht diese unterschiedliche Bewertung fort.«
Die unabhängige Autorin, glaubte Woolf, würde alle Regeln über Bord werfen und schreiben, was nie zuvor geschrieben wurde. Diese weibliche Literatur würde »eine Fackel entzünden in den weitläufigen Gemächern, in denen noch keiner war. Dort herrschen Zwielicht und Schatten wie in jenen verwinkelten Höhlen, die man mit einer Kerze in der Hand betritt; man blickt auf und nieder und weiß nicht, wohin der nächste Schritt führt.«
Doch die Zukunft stellt sich natürlich nie ein; es handelt sich lediglich um eine Projektion von gegenwärtigen Frustrationen. Seit Woolfs Veröffentlichung von Ein Zimmer für sich allein vor über achtzig Jahren sind einzelne Aspekte weiblicher Erfahrung mit bewundernswerter Offenheit ausgeführt worden, nicht selten von männlichen Autoren. Doch ein Buch über den Krieg scheint immer noch wichtiger als ein Buch über »die Gefühle von Frauen«. Schreibt eine Frau ein Buch über den Krieg, wird sie gelobt, denn sie hat die dunklen Gemächer und verwinkelten Höhlen gemieden; es entsteht der Eindruck, sie hätte von ihrem Zimmer und ihrem Geld, also ihren neuen Eigentumsrechten, sinnvollen Gebrauch gemacht. Entsprechend kritisiert wird hingegen die Schriftstellerin, die sich auf ihre weibliche »Wirklichkeit« beruft. Sie scheint ihr Zimmer, ihr Geld vergeudet zu haben, scheint betrogen worden zu sein oder sich selbst zu betrügen; sie fällt ihrer Selbstausbeutung zum Opfer. Und was die »weiblichen Wertvorstellungen« betrifft – wer kann schon sagen, was damit gemeint ist? Wenn sich, wie Woolf behauptet, die Wertvorstellungen der Wirklichkeit in der Literatur zu allen Zeiten niederschlagen, leben wir in einer Epoche, in der das Weibliche wieder einmal entwertet wird und das Männliche dominiert.
Als ich vor kurzem Tschechows Drei Schwestern las, stellte ich verblüfft fest, dass das Anliegen weiblicher Selbstdarstellung – nennen wir es »weibliches Schreiben« – genau dort diffus wird, wo ein konkreter Versuch gefragt wäre. Tschechows Drama basiert auf Aspekten aus dem Leben der Geschwister Brontë. Drei Frauen – Olga, Irina und Mascha – leiden nicht nur unter den Beschränkungen und der Langeweile des Provinzlebens, sondern auch unter ihrem widersprüchlichen Verhältnis zur Wirklichkeit. Was sie fühlen, wird durch das, was sie sind, nicht verkörpert. Ihre Kindheit betrachten sie als eine Zeit paradiesischer, glücklicher Sorglosigkeit – als Kinder sahen sie ihr Geschlecht noch nicht als Schicksal und Beschränkung –, und nun sind alle Hoffnungen, etwas zu leisten und jemand zu sein, auf den einzigen Bruder Andrey übertragen worden. Die Schwestern erwägen Ehe, Liebe, Mutterschaft und bezahlte Arbeit, doch nichts davon scheint eine Lösung zu sein. Die Schwierigkeiten erwachsen nicht nur aus der weiblichen Ohnmacht, es steckt mehr dahinter, eine Energie, die zerstörerisch auf die Gegenwart einwirken will. Die Schwestern können nichts werden, können nichts tun, um sie freizusetzen. Diese Energie könnte man auch Kreativität nennen; interessant ist Tschechows Entschluss, das Schreiben selbst aus seiner Darstellung der Lage herauszuhalten, so wie er es überhaupt bei den leisesten Anspielungen auf die raue Welt der Brontës belässt. Das Leiden und das Schreiben werden in etwas nicht Greifbares, Allgemeingültiges überführt, das unmittelbar an das Wesen der Frau rührt.
Die Frau ist erfüllt von Visionen und Sehnsüchten, denen die Wirklichkeit niemals gerecht werden kann; ihre Vorstellungskraft stößt unablässig an die Grenzen ihrer weltlichen Machtlosigkeit. Aus diesem Lebenskonflikt könnte sie natürlich Literatur gewinnen, viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie schweigt. In Tschechows Beispiel verschärft sich der Konflikt zwischen Werden und Sein, als das Leben seinen Lauf nimmt und der Raum für das Nicht-Fassbare immer enger wird. Irina und Olga sind gezwungen, ein Zimmer zu teilen, weil die Schwägerin Irinas Zimmer für ihr Neugeborenes beansprucht. Die Frau, die sich, um es mit Woolf zu sagen, den »maskulinen Wertvorstellungen« unterwirft, die also zu männlichen Bedingungen Frau ist, erlangt einen räumlichen Vorteil über jene, die sich weigert. Mehr noch, die Frauentypen stehen einander feindselig gegenüber. Die Frau, deren Sein Ehe und Mutterschaft ist, wird Teil der widersprüchlichen Wirklichkeit und entzieht der Frau, die im Zustand nicht fassbarer Weiblichkeit verharrt, ihren Besitz.
Mag sein, dass weibliche Kreativität weit weniger an das eigene Zimmer gebunden ist als von Woolf angenommen. Sie selbst konnte sich glücklich schätzen, immer über ein Zimmer und eigenes Geld zu verfügen; und vielleicht erschienen ihr diese beiden Dinge deshalb so unabdingbar, weil sie die Grundbedingungen ihrer eigenen literarischen Produktion bildeten. Dennoch räumte Woolf ein, dass Jane Austen und Emily Brontë, zwei fraglos von ihr bewunderte Schriftstellerinnen, in Haushalten ohne Rückzugsmöglichkeit lebten. Das Zimmer, oder sein Fehlen, hat also nicht notwendigerweise mit dem Schreiben zu tun. Man könnte sagen, dass jede Frau ein Zimmer für sich allein haben sollte. Aber man könnte ebenso sagen, dass eine Schriftstellerin durch das eigene Zimmer ihre Verbindungen zur Weiblichkeit verliert und sich der Reproduktion »maskuliner Wertvorstellungen« verpflichtet. Das Zimmer selbst könnte die Verkörperung dieser Werte sein, eines Begriffs von »Eigentum«, der der weiblichen Natur im Grunde gar nicht entspricht.
Woolf gibt zu, nicht zu wissen, was Frauen sind. Sie haben so wenige Spuren hinterlassen, schreibt sie, haben jahrhundertelang so konsequent geschwiegen, dass ihre Geschichte nahezu ungeschrieben blieb. Die Künstlerin muss sich an den dürftigen Vorgaben ihrer Vorgängerinnen orientieren – Austen, George Eliot, die Brontës. Sie muss auf die vorhandenen Darstellungen zurückgreifen. Vielleicht ist Tschechow in dieser Hinsicht sogar der Scharfsichtigere: Die Darstellung der Frau hat ihn zum Nachdenken über das Schweigen angeregt, nicht umgekehrt. Ihn interessiert das Schweigen an sich, und zwar nicht als Abwesenheit von etwas, sondern als Präsenz. In Ein Zimmer für sich allein analysiert Woolf diese Präsenz in der Gestalt von Shakespeares fiktiver Schwester Judith. Woolf beschreibt sie als eine Person, die abgesehen vom Geschlecht identisch ist mit William und doch überall dort, wo der Bruder Anerkennung und Lob erfährt, immer nur enttäuscht, zum Schweigen gebracht oder beschimpft wird. Doch Tschechow denkt über das Weibliche nicht in männlichen Begriffen nach. Er begreift die Frau als an ihrem eigenen Sein Gehinderte, als sich selbst zutiefst fremd. In Drei Schwestern führt Irina das Schweigen auf die mangelnde Übereinstimmung von Gefühl und Lebensrealität zurück: »O, ich habe so oft von der Liebe geträumt«, sagt sie, »so lange schon denke ich darüber nach, bei Tag und bei Nacht, aber meine Seele ist wie ein teures Piano, das verschlossen ist und der Schlüssel verloren.« Wer das Piano verschlossen und wer den Schlüssel verloren hat, verrät sie nicht; wir erfahren nur, dass es wertvoll ist und stumm.
Auf ähnliche Fragen geht Doris Lessing in ihrer Erzählung Zimmer 19 ein, in der eine konventionell – wenn auch nicht glücklich – verheiratete Mutter von vier Kindern plötzlich den heftigen Wunsch nach einem eigenen Zimmer verspürt. Das Verlangen quält sie; weder weiß sie, warum sie das Zimmer braucht, noch, was sie dort tun sollte. Doch sie muss es haben. Sie spürt den starken Wunsch, sich vom Einfluss anderer Menschen abzugrenzen; sie hat keine andere Erklärung als die, an einem Ort sein zu wollen, wo sie niemandem mehr zur Verfügung steht. Zunächst bestimmt sie ein leerstehendes Zimmer im Haus zu dem ihren, was sie jedoch auf Dauer nicht zufriedenstellt. Jeder hat Zutritt, die Kinder kommen herein und lassen Spielzeug auf dem Teppich liegen. Zudem hält sie sich nicht einmal gern dort auf; wie sich herausstellt, geht es ihr vielmehr darum, die Verbindungen zu ihrer Existenz zu kappen. Sie mietet ein schäbiges Hotelzimmer in einem heruntergekommenen Viertel, fährt jeden Tag dorthin und legt sich aufs Bett. Dieses Zimmer, Zimmer 19, kann sie endlich als das ihre annehmen, und sie ist bestürzt, als sie eines Nachmittags dort ankommt und feststellen muss, dass es belegt ist (schließlich ist es ein Hotelzimmer). Um ihrem Ehemann die ständigen Abwesenheiten zu erklären, schützt sie eine Affäre vor. Der Ehemann reagiert hocherfreut; er selbst hat Affären und fühlt sich nun von aller Schuld freigesprochen. Eines Nachmittags bringt die Frau sich in Zimmer 19 um.
Bei Lessing wie auch in den Drei Schwestern wird »stillschweigend« erzählt. Wir wissen, dass Doris Lessing, eine Frau, diese Erzählung geschrieben hat, ebenso wie wir wissen, dass die Brontës geschrieben haben. In beiden Fällen jedoch bleibt der erkämpfte Raum leer. Lessings Figur zieht sich nicht in Zimmer 19 zurück, um Bestseller-Romane zu schreiben, und ebenso wenig münzen Olga und Irina ihre Frustrationen in literarische Werke um. Schreiben, »weibliches Schreiben« bedeutet also offensichtlich etwas anderes, etwas Neues: Es beschreibt, was es nicht ist, und definiert sich über sein Gegenteil, das Schweigen; es stellt sich in den Dienst einer Macht, die es leugnet. In Lessings Erzählung bedeutet das Zimmer – das eigene Zimmer – den Tod, Tod der weiblichen Lebensrealität, Tod als Alternative zur Beschränkung. Die Autorin erkennt, dass ihr Schreiben mit dem Sterben und dem Schweigen verwandt ist und ihr »Zimmer« durch Beschränkung bedroht. Dann lieber den Tod als die Fortschreibung »maskuliner Werte«.
Woolf räumt ein, dass die schreibende Frau möglicherweise alles zerstören muss – den Satzbau, die Szenenfolge, selbst die Romanform –, um zu einer eigenen Literatur zu gelangen. Sie fragt sich allerdings auch, ob die situative Verbindung von Leben und Arbeit nicht vielleicht eine Notwendigkeit ist und weit davon entfernt, das Schreiben zu behindern; ob, in anderen Worten, Stolz und Vorurteil nur deshalb zu einem so vollkommenen Werk werden konnte, weil Jane Austen beim Verfassen in einer Nische hinter der Wohnzimmertür saß. Als Voraussetzung für jede Kunst gilt, dass man eins wird mit seinem Thema; Woolf wagt die Vermutung, dass »weibliche« Literatur kürzer, fragmentarischer und heterogener sein müsse als männliche, denn »Störungen gibt es zuhauf.« Ihr eigener Roman Mrs. Dalloway ließe sich demnach als ein Buch über die Ängste der Autorin vor der eigenen Gewöhnlichkeit und Trivialität lesen, über das schwer lastende, geschlechtlich zugeteilte Erbe von Schweigen, Kompromissen und Mittelmäßigkeit, über die erschreckende Fragilität ihrer Ausdruckskraft, ohne die sie, wie sie einmal in ihrem Tagebuch schrieb, ein Nichts wäre.
Mag sein, dass die Schriftstellerin von heute mit dem Begriff des »weiblichen Schreibens« nicht mehr viel anfangen kann. Der Feminismus als kulturelle und politische Krise gilt als überwunden. Ehe, Mutterschaft und Hausfrauendasein werden als drei Möglichkeiten unter vielen betrachtet, folglich darf man sich nur begrenzt beschweren. Fühlt eine Frau sich von der eigenen Weiblichkeit erstickt, eingeengt und überfordert, so ist das ihr individuelles, privates Problem. Zurzeit besteht zwischen Frauen keine öffentliche Einigkeit, denn seit der Hochphase des Feminismus ist es ihre Aufgabe, sich den Männern anzupassen. Folglich ist das weibliche Dasein ein verdecktes, verstreutes, verstecktes. Wollte eine Schriftstellerin sich an ihre Geschlechtsgenossinnen wenden, sie wüsste vermutlich gar nicht, zu wem oder was sie sprechen sollte. Oberflächlich betrachtet ist ein Zustand der Gleichheit erreicht, nur dass in dieser Gleichheit die »maskulinen Werte« tonangebend sind. Was die Frauen von heute an persönlicher Freiheit dazugewonnen haben, ist ihnen als gesellschaftlicher Klasse verlorengegangen. Ihr Geschlecht ist immer noch das andere; immerhin haben sie das Recht erkämpft, sich davon loszusagen.
In diesem Zusammenhang gewinnt Simone de Beauvoirs Behauptung, man käme nicht als Frau auf die Welt, sondern werde zu einer, eine neue Bedeutung. Wenn die Frau von heute keine Identität besitzt, vollzieht sich ihr »Werden« unter umso willkürlicheren und rätselhafteren Umständen. Die Gefahr ist dabei sicherlich, dass sie vorrangig – und gezwungenermaßen – in solchen Lebensbereichen »wird«, in denen sie sich als gleich empfindet. Mit anderen Worten: Wenn die Geschlechterdifferenz unreflektiert hingenommen oder gar verleugnet wird, wird ein Mädchen nicht weniger, sondern mehr angezogen und fasziniert sein von dieser Differenz. Und wenn sie sich dann umsieht, stellt sie fest, dass in Politik und Wirtschaft, bei den Banken und an der Börse und im Fernsehen fast nur Männer das Sagen haben. Und vielleicht riskiert es die Schriftstellerin aus diesem Grund, falls sie einen braucht, das Weibliche und die weiblichen Werte zu ihrem Thema zu machen. »Fest steht, dass die traditionelle Frau über ein mystifiziertes Bewusstsein verfügt und selbst ein Instrument der Mystifizierung ist«, schreibt de Beauvoir. »Sie versucht, ihre Abhängigkeit vor sich selbst zu verbergen, was einer Einwilligung in die Abhängigkeit gleichkommt.« Die leidenschaftlichsten Passagen in Das andere Geschlecht handeln von den Mitteln und Strategien der Frauen, ihre Privilegien und ihren Besitz im Patriarchat zu wahren, indem sie nämlich die Aufrichtigkeit anderer Frauen verspotten und verurteilen. Dies gilt bis heute: Die Frau macht sich genau dort weiterhin zum »Instrument der Mystifizierung«, wo sie ihre eigene Abhängigkeit fürchtet und leugnet. Für die Schriftstellerin ist das eine beängstigende Aussicht. Wenn sie an die tiefsten Wurzeln der kollektiven Erfahrung rührt, riskiert sie es, auf Ablehnung zu stoßen. Wenn sie sich die Mühe macht, aufrichtig zu schreiben, riskiert sie es, unaufrichtig gelesen zu werden. Und meiner persönlichen Erfahrung als Autorin nach ist Aufrichtigkeit genau dort gefragt, wo sie am heftigsten zurückgewiesen wird, denn genau dort gefährden Einschränkungen, falsches Bewusstsein und »Mystifizierung« noch immer die Integrität weiblichen Lebens. Ich spreche hier natürlich vom Buch der Wiederholung und von einer Literatur, die sich mit dem Ewigen und Unabänderlichen beschäftigt, mit Häuslichkeit, Mutterschaft und Familienleben. Die absolute Intoleranz, die derlei Themen noch heute entgegengebracht wird, ist der unstrittige Beweis dafür, dass Frauen im Begriff sind, wichtige Elemente ihrer modernen Identität aufzugeben.
Die Schriftstellerin, die sich in dieser Richtung betätigen will, wird also noch jede Menge Arbeit vorfinden bei der Entmystifizierung und der Überwindung des Schweigens, das sich wie ein Nebel über die sich wiederholende weibliche Erfahrung legt. Sie wird für das Buch der Wiederholung keinen Man Booker Prize gewinnen; sie wird, wie de Beauvoir richtig erkannt hat, eher verstören und sich Feinde machen als gefallen. Schlimmer noch, möglicherweise muss sie, wenn sie darüber schreiben will, auf einige ihrer Privilegien verzichten. Vielleicht muss sie auch ihr eigenes Zimmer verlassen und ihren angestammten Platz hinter der Wohnzimmertür einnehmen.
Aus dem Englischen von Eva Bonné