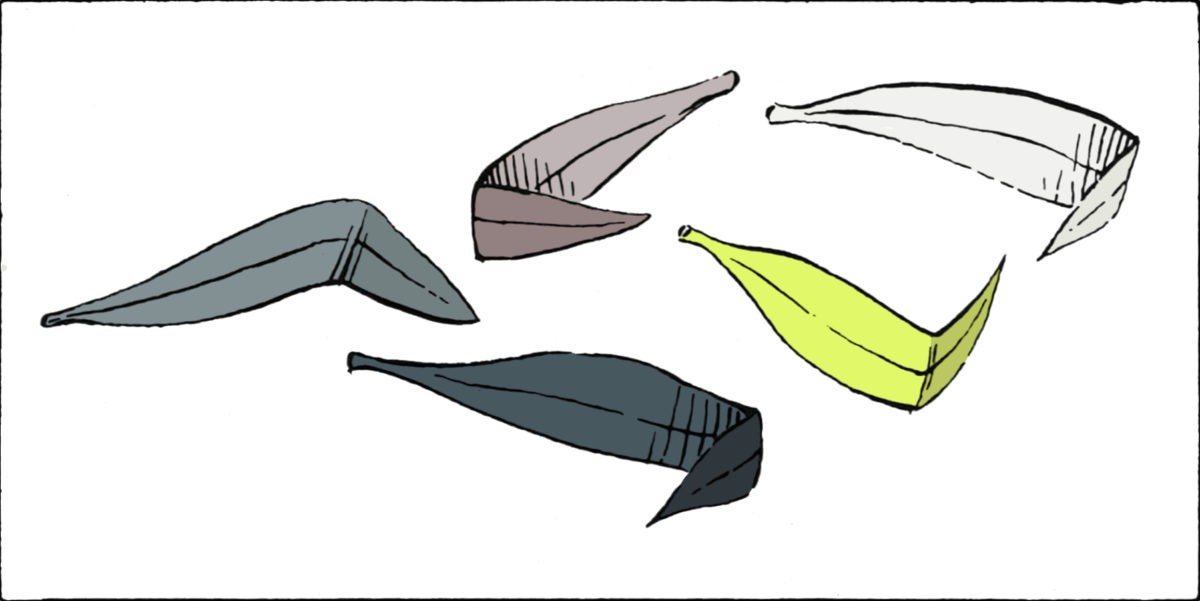Ein Jahr nach Erscheinen der Anthologie Wie wir leben wollen. Texte für Solidarität und Freiheit erzählen der Herausgeber Matthias Jügler sowie drei der damaligen Beiträger – Lara Hampe, Stephan Thome und Shida Bazyar – in zwei Folgen von ihren Erfahrungen und Beobachtungen im Alltag. Ob im Flugzeug nach Wien oder mitten in Halle, Berlin und Taipeh.
Matthias
Vor wenigen Wochen fuhr ich mit meiner Freundin Susann nach Halle. Ich wollte ihr die Stadt zeigen, in der ich aufgewachsen bin. Wir fuhren in die Silberhöhe, ein Plattenbauviertel am Rande von Halle. Dort ließen wir das Auto stehen und fuhren mit der Tram in die Altstadt, gingen spazieren, aßen Döner und fuhren dann wieder zurück in die Silberhöhe. Kurz bevor wir aussteigen mussten, hielten wir vor der Poliklinik. Rentner saßen in der Tram, Mütter mit Kindern und drei Männer, die Arabisch miteinander sprachen.
Wir beobachteten einen jungen Mann, der über den Platz vor der Poliklinik auf eine Gruppe anderer junger weißer Männer zulief. Der Mann, fast noch ein Junge, machte den Hitlergruß und feixte. Auch die anderen reckten die Hände in die Luft. Sie standen vor einem Mülleimer und tranken Bier. Es war ein Sonntag, kurz nach Mittag. Die Tram setzte sich wieder in Bewegung. Ob sie das gesehen habe, fragte ich Susann.
Wieder zu Hause googelte ich Asylbewerberheim, Silberhöhe. Tatsächlich gibt es dort ein Heim, im Robinienweg. Ich kenne diese Straße. Früher spielten wir dort in der Nähe Fußball. Der erste Eintrag führte zu einem Artikel vom 10. Januar 2015. Asylheim Robinienweg: Wutbürger gegen Flüchtlinge. In den Kommentaren, schrieb ein Nutzer, der sich hafentrottel nannte, am 16. Januar 2015:
natürlich sind es Wirtschaftsflüchtlinge. sicherlich wird unser System eines tages dadurch einen Kollaps erleiden, dass wir uns nicht schützen können. dank Adolf hitler darf man ja nicht mehr sagen man ist deutscher Christ und möchte das Deutschland deutsch bleibt.
Lara
Im Flugzeug von Berlin nach Wien saß ich am Gang, neben mir ein dicker Mann mit Brille auf halber Nase. Wir waren schon in der Luft, als er eine Zeitschrift aufschlug; er tat das wie jemand, der sich beobachtet fühlt und deswegen alle Bewegungen auf die denkbar einfachste Art ausführt; er las das Compact-Magazin. Dass jemand ein Magazin mit hetzerischen und rassistischen Inhalten auf einer Billigfliegerbühne las, eingequetscht zwischen zwei Fremden, das hatte ich noch nie gesehen.
Ich sprach ihn an und ich tat es naiv: Warum er denn dieses Magazin lese? Er wolle sich eben informieren, sagte er. Er lese auch normale Zeitungen, doch es sei gut, auch die andere Seite zu kennen, nur so könne man sich seine eigene Meinung bilden. Ich fragte ihn, was das sein sollte, die andere Seite. Naja, sagte er, eben Medien, die nicht gewisse Nachrichten unterschlagen würden.
Er sagte: »Es ist doch erstaunlich, dass erst jetzt, nachdem diese Menschen nun schon seit anderthalb Jahren bei uns sind, rauskommt, dass sie eine viel höhere Bildung mitbringen als angenommen.« Es schien ihm nicht darum zu gehen, ob »diese Menschen« gebildet waren oder nicht und was ihr Bildungsgrad aus sozialer, politischer oder ökonomischer Sicht bedeutet, sondern allein um die Tatsache, dass erst jetzt darüber berichtet wurde. Er fühlte sich vorsätzlich und böswillig getäuscht.
Ich fragte ihn, woher man im Sommer 2015 eine genaue Statistik zu den Bildungsabschlüssen der Ankommenden hätte hernehmen sollen? Es war ihm nicht wichtig. Er hatte verinnerlicht, dass den Medien nicht zu trauen sei, und wollte, wie er sagte, selbst abwägen. Er fände die hetzerischen Inhalte »auch nicht gut«, manch andere Berichte aber schon, die über Merkel zum Beispiel.
Bei meinen Recherchen über das Compact-Magazin bin ich auf mehrere Spitznamen Merkels gestoßen: Man nennt sie im Heft Rautenfrau, Schlepperkönigin, GröMaz (größte Mutti aller Zeiten) und Eiserne Kanzlerin. Es gibt auch eine Hofberichtserstatterin (das ist Anne Will), einen linguistischen Kettenhund (gemeint ist Frank-Walter Steinmeier) und Transatlantiker (ZEIT-Journalisten). Allgemein ist man gegen Menschenrechtsblabla und Multikultiphrasen.
Diese Okkasionalismen ziehen sich durchs ganze Heft, meist sind es aus zwei Nomen bestehende Personen- oder Sachverhaltsbeschreibungen. Verschiedene Kontextualisierungen werden in die Wortneuschöpfungen integriert, aber nicht erklärt; dies geschieht ironisch, im augenzwinkernden Gestus des »ihr habt es doch verstanden«. Mindestens ein Nomen ist abwertender Natur, somit ist jegliche Neutralität ausgeschlossen. Sich »seine eigene« Meinung zu bilden, ist schon allein deswegen nicht möglich.
Im Editorial wird Angela Merkel mit Adolf Hitler verglichen, sie sei seine »spiegelbildliche« Karikatur, sie führe ein »Regime« an, in dem sich der »aktuelle Rassismus nicht mehr, wie damals, gegen Fremde – sondern gegen die eigene Nation« richte. Die inflationär verwendeten Ausdrücke aus der Militärsprache sollen wohl überzeichnend, ironisierend und anschaulich wirken:
»Dass der Führerin wichtige Bundesgenossen von der Fahne gehen, erinnert ebenfalls an die letzte Phase des Zweiten Weltkrieges: Nach dem Zusammenbruch der Front im Osten setzte sich kein anderer als Heinrich Himmler von dem Untergangskurs des Walhalla-Süchtigen ab und begann Geheimverhandlungen mit den Amerikanern. Die große Macht jenseits des Atlantik ist jetzt auch für die Risse im Merkel-Block verantwortlich: Wer klug ist, hat sich längst ausgerechnet, dass die Rautenfrau gegen den neuen Präsidenten keine Chance hat.«
Der hypotaktische Satzbau wirkt fachsprachlich und verschleiert so die falsche Kausalität. Pro Trump ist man sowieso. »Wer klug ist, hat sich längst ausgerechnet …« – was als Redensart daherkommt, meint eigentlich eine Unterteilung der Welt in »kluge Menschen, die es verstanden haben«, und »dumme Menschen, die es noch nicht verstanden haben«.
Der Untertitel von Compact lautet »Mut zur Wahrheit«, nicht »Mut zur Meinung«. Es gibt dort kein Zweifeln. Aus dem Gefühl des Ausgeschlossenseins heraus wird dort ein Feind ausgemacht, den es zu beobachten gilt. Ohne groß zu zögern, ohne groß über Werte und Inhalte der feindlichen Positionen nachzudenken, lehnt man alles, was jener verkörpert, ab. Ein Beobachten, ein Ahnen, ein Wittern, ein Suchen nach Merkmalen. Aber kein Zweifeln.
Man ist hier nicht unentschieden, man schwankt hier nicht zwischen verschiedenen Denkmotiven. Man hat sich bereits festgelegt. Man vereint dort alles, was gegen das Establishment ist. Man ist entschlossen, zu gewinnen, egal, welche Mittel dafür nötig sind. Es geht hier nur noch ums Gewinnen.
Der Mann im Flugzeug war für eine private Sicherheitsfirma tätig, bei Veranstaltungen der AfD und Pegida. Er erzählte das mit gesenkter Stimme, wie etwas Feierliches oder etwas, das man nur mit Wenigen, Auserwählten teilt –
Stephan
Bin gerade aus Deutschland nach Taiwan zurückgekommen und noch im Jetlag. Also schaue ich nachts die sehenswerte Serie The Knick von Steven Soderbergh über ein New Yorker Krankenhaus im Jahr 1900. Gruselige OP-Szenen und kluge Beobachtungen. Einer der Ärzte ist ein Schwarzer, und es wird in vielen Variationen gezeigt, dass die weißen Kollegen unfähig sind, ihn als Mensch und normalen Kollegen wahrzunehmen. Entweder sind sie offen rassistisch gegenüber dem »Nigger«, oder sie verhalten sich subtil herablassend und gefallen sich in ihrer vermeintlichen Großzügigkeit.
Laras Compact-Beobachtungen haben mir noch mal klargemacht, was mich an der darin artikulierten Haltung am meisten anwidert – es ist zugleich das für sie typischste. Die Pose ironisch-flapsiger Überlegenheit gepaart mit der totalen Unfähigkeit zu (oder Verweigerung von) Empathie, Einfühlung, Selbstreflexion und -kritik. Am besten drückt es sich im Zwang aus, Andersdenkenden herablassende Spitznamen zu geben. Wer benennt, bestimmt. Eine Art rhetorischer Machtergreifung der Machtlosen, die auf mich kleinbürgerlich wirkt, wie die gedruckte Form von Stammtischgerede, wo alle derselben Meinung sind und sich immerzu und immer betrunkener bestätigen müssen, dass es außerhalb der Kneipe nur Idioten gibt.
In einer Szene in The Knick stehen drei Ärzte nach einer nächtlichen OP vor dem Haus und ruhen sich aus. Gerade haben sie zusammen einen Menschen gerettet, es war knapp. Die Sonne geht auf. Einer der beiden Weißen seufzt, zieht den Flachmann hervor, trinkt einen Schluck. Wortlos hält er dem weißen Kollegen den Flachmann hin. Der trinkt auch. Seufzen, Durchatmen. Dann gibt er die Flasche zurück. Man sieht nur das Gesicht des Schwarzen, der in der Mitte sitzt und an dem die Flasche zwei Mal vorbei gereicht wird. Die beiden anderen sind nicht bösartig. Es ist bloß undenkbar, ihn an diesem Moment männlich-kollegialer Verbundenheit teilhaben zu lassen.
Wie gesagt, es spielt im Jahr 1900. Das Motto der Serie auf dem DVD-Cover lautet: »Humanity is hard to cure.«
Shida
Hier im Wedding ist ein Späti neben dem anderen. So langsam habe ich raus, bei welchem ich welche Tageszeitung bekomme. Gestern war ich auf der Suche nach einer bestimmten türkischen Tageszeitung, die über die türkische Version meines Romans geschrieben hat. Ich kann kein Türkisch, und ich kam mir selten so unwissend vor. Nicht mal, wie man den Namen besagter Zeitung ausspricht, konnte ich so richtig angeben, habe immer genuschelt, aus Scham. Ich weiß ein bisschen was über die türkische Medienlage, habe so viel darüber gelesen und bin immerzu betroffen – aber eben immer nur aus einer sehr deutschen Sicht. Und ich weiß nichts über türkische Aussprache.
Die Zeitung gab es nirgendwo, und ich bin im Kopf Gründe dafür durchgegangen. Vielleicht ist dieser Teil von Wedding ja komplett AKP-nah und besagte Zeitung ist es nicht. Oder alles völlig anders. Vielleicht sind es politische Gründe, vielleicht wäre jeder Späti hier verpöhnt, der gewisse Zeitungen führen würde. Vielleicht gibt es klare Gruppen, die den und den Späti aus dem und dem Grund meiden. Und ich Pfeife kaufe mein Bier immer da, wo ich gerade Lust habe, ohne all das zu blicken. Weiß höchstens, wo es Alternativen zu Coca Cola gibt und welche Verkäufer*innen ich mag. Ich wohne hier im Wedding, dem traditionellen Arbeiterviertel, dem Migrantenviertel, ich treibe die Mieten nach oben und ich habe keinen Plan von meinen Nachbar*innen. Null. Ich kann doch irgendwie auch keinen Plan von Deutschland haben, wenn ich so wenig über die Türkei weiß, oder?
Die Zeitung hab ich nicht bekommen und einmal mehr gedacht, ich bin in meiner kleinen, weißen Blase, egal wo ich wohne.
Wenigstens hat meine Blase diesen einen kleinen Vorteil, dass ich hier nicht der Compact begegne. Wenigstens das. So, aber jetzt mal: Halle, Wien, Taiwan, Wedding, Fernsehprogramm. Ist es denn in irgendeiner dieser Blasen auch mal irgendwie schön? Hoffnung? Oder so was? Neigt man denn immer dazu, von Dingen zu lernen, die sich als »doof« entlarven lassen?