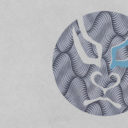Philipp Weiss spricht über seinen Roman Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Hier geht es zum zweiten Teil des Interviews.
Worum geht es in deinem Roman?
Die Wahrheit ist: Das ist für mich die allerschwierigste Frage. Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass der Roman mit allem, was er ist und sein will, ebendiese Frage nach seinem Rahmen unterläuft und torpediert, da er die Entgrenzung sucht. Es ging mir tatsächlich um solch ein umfassendes Denken und Erzählen. Trotzdem ein Versuch einer Antwort: Es geht um Verlust und Aufbruch. Alle Figuren sind Suchende, Reisende, die auf ihre jeweilige Art mit dem Verlorenen und dem Verlorensein umzugehen versuchen, mit dem Verlust von geliebten Menschen etwa oder dem Erodieren der Realität.
In einem ersten Exposé hast du einmal geschrieben, es sei ein Roman über die »Erfindung und Verwandlung der Welt«.
Das gefällt mir immer noch gut, weil wir unseren Planeten in den letzten 200 Jahren tatsächlich völlig verwandelt haben. Erfunden haben wir die Welt, also die Gesamtheit unseres Lebenszusammenhangs, wahrscheinlich schon immer, aber wohl noch nie so global, technisch und komplex. Eine andere Formel, die mir auch gut gefällt, lautet: Es geht im Roman um das Verhältnis des Menschen zu Natur und Technik im Anthropozän – also jener Epoche der Erdgeschichte, in der der Mensch zur zentralen gestaltenden Kraft geworden ist. Was mich bei alldem besonders interessiert hat, waren Momente des Kontrollverlusts, auf kollektiver und individueller Ebene, das Ereignishafte und Unvorhersehbare, das plötzlich über einen hereinbricht und dabei ein Leben, ein Ich, eine Geschichte formt. Es zeigt sich in den Erschütterungen der Natur, in den Unfällen der Technik, den Umwälzungen der Politik und auch in der Liebe. Letztlich mündet alles in die Fragen nach der Utopie und der Zukunft des Menschen. Über und zwischen diesen genuin europäischen Themen steht Japan: als komplementäre Kultur, als Projektionsfläche okzidentaler Sehnsüchte. Und als ein Land, welches das westliche Weltbild inkorporiert und überboten hat.
Der Roman besteht aus fünf Bänden. Wie hängen sie zusammen?
Als ich begonnen habe, daran zu schreiben, das war 2012, gab es über lange Zeit konzeptionell nur einen der fünf Bände: Terrain vague. Er erzählt von einem androgynen Künstler, Jona, der, auf der Suche nach seiner verschwundenen Geliebten, der viel älteren Klimaforscherin Chantal, nach Japan reist und dort das Erdbeben und die Nuklearkatastrophe erlebt. Für Theaterarbeiten musste ich damals den Schreibprozess für ein Jahr unterbrechen. Als ich den Text danach wieder zur Hand nahm, wurde mir schnell klar, dass diese eine Geschichte und Form nicht ausreichen würde, um das zu erforschen und zu erzählen, was mich eigentlich interessierte. Nämlich: Wie ist es zu dieser Welt gekommen, in der wir uns heute befinden? Was ist die Vorgeschichte dieser fragilen technischen Membran, die sich da über unseren Globus legt? Und wo führt das hin? Ich begann also, mein Konzept zu erweitern. Und so entstand in kurzer Zeit die Idee der fünf Bände. Sie hat mir erst erlaubt, weit komplexer und umfassender über die genannten Fragen nachzudenken. Etwa ins 19. Jahrhundert, in diese Zeit der großen Umbrüche und Utopien, oder sogar bis zur Entstehung des Universums aus dem Nichts zurückzugehen, das war erzählerisch für mich ungemein produktiv.
Wie ergibt sich aus den fünf Bänden nun ein Roman, eine Geschichte?
Thematische und motivische Verknüpfungen gibt es auf verschiedenen Ebenen. Eine Klammer des Romans bildet etwa die historische Entwicklung der Individualität. Da erscheint etwas mit dem Aufstieg des Bürgertums: die Idee des Individuums, das offenbar zu einem gewissen Grad von seiner Umgebung unabhängig und selbstbestimmt agiert, das Rechte hat und diese auch einfordert, et cetera. Im 20. und 21. Jahrhundert scheint diese Erfahrung wieder zu zerfallen. Der Konsum und die Technik schalten uns in gewissem Maße gleich. Das Ich erodiert paradoxerweise, da es sich absolut setzt. Jeder Band zeigt nun einen anderen – wie ich es nenne – »Aggregatzustand des Ichs«.
Kannst du das etwas näher ausführen?
In den Enzyklopädien, die im 19. Jahrhundert angesiedelt sind, kann man noch die historische Konstituierung des Ichs miterleben, konkret in Form von Paulettes Geschichte einer feministischen Selbstermächtigung. In Akios Aufzeichnungen folgt man der Phänomenologie der kindlichen Wahrnehmung, die in ihrer symbiotischen Phantasie das Ich als untrennbar verwoben mit seiner technischen und biologischen Umwelt erfährt. In den Glückseligen Inseln endet das Ich im »Echo Chamber«, in der virtuellen solipsistischen Blase.
Darüber hinaus sind die Teile durch Figuren und erzählerische Bögen verknüpft …
Genau. So beginnen die Cahiers etwa mit dem Fund von Paulettes Gletscherleiche, der Erzählerin der Enzyklopädien, die Ende des 19. Jahrhunderts in den französischen Alpen verunglückte. Oder ein anderes Beispiel: Der Band Die Glückseligen Inseln ist ein Comic der jungen Japanerin Abra, die dem schon erwähnten Jona in Terrain vague begegnet. Die Teile sind ineinander verschachtelt wie paradoxe russische Puppen. So ergibt sich ein dichtes Geflecht aus thematischen und erzählerischen Verknüpfungen. Es gibt auch eine Schattenfigur, die durch – beinahe – alle Bände geistert: Satoshi, der »Mann vom Mond«, ein obdachloser Nuclear Gypsy, der als Tagelöhner Reinigungsarbeiten in Atomkraftwerken durchführt.
Jeder Band hat sein eigenes Format – Enzyklopädie, Notizheft, Erzählung, Transkript, Comic – warum hast du diese Form gewählt? Warum sind die unterschiedlichen Formate nötig?
Alle fünf Bände sind höchst subjektive Weltentwürfe – immer von einer jeweils anderen Figur in der ersten Person erzählt. Jede dieser Figuren hat eine eigene Sprache, aber auch eine genuine Art, die Welt wahrzunehmen, das heißt, sie im Geist zu entwerfen. Wie kann man erzählerisch Denkprozesse und Erfahrungen abbilden? Die utopische Inventarisierung der Welt in der Enzyklopädie des 19. Jahrhunderts etwa, die fahrigen, fragmentierten, in sich selbst gefangenen und zur Auflösung hinstrebenden Denkbewegungen philosophischer Notizhefte oder die phantastische visuelle Bildwelt des Comics – es sind nicht nur andere erzählerische Formen, es sind jeweils andere Zugänge zur Wirklichkeit, zugleich Manifestationen verschiedener Persönlichkeiten. Wir denken heute nicht mehr so stark in linearen Narrativen, sondern in symbolischen Hyperräumen, in einem komplexen Geflecht aus Bildern und Texten. Dem wollte ich Rechnung tragen.
Was hat es mit dem Titel auf sich?
Da gibt es als Referenz zunächst Flammarions Holzstich. Auf Deutsch trägt er auch den Titel Wanderer am Weltenrand. Diesem habe ich dieses wunderbare Wort »Weltenrand« entliehen. Die berühmte Illustration fand sich zum ersten Mal in einer Publikation des französischen Astronomen Camille Flammarion Ende des 19. Jahrhunderts, man hielt sie aber lange Zeit irrtümlich für ein mittelalterliches Original. Sie zeigt einen Missionar, der, wie es in dem daneben stehenden Text heißt, jene Stelle des Horizonts fand, wo Erde und Himmel nicht verschweißt waren, was dem Wanderer also ermöglichte, seinen Kopf durch diese schmale Lücke zu drängen. Dieses Bild eröffnet die positive Lesart des Titels und erzählt von der menschlichen Urbewegung der Überschreitung. Die zweite Referenz ist Nietzsches »Letzter Mensch« aus Also sprach Zarathustra. Bei Nietzsches letztem Menschen handelt sich um ein gleichgültiges und dumpf glückliches Geschöpf, das zu nichts mehr imstande ist, als zu blinzeln. Im Zarathustra heißt es: »›Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?‹ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt.« Das Lachen ist dazu vielleicht eine hysterische Vorstufe.
In welcher Reihenfolge hast du die Bände geschrieben?
Es gibt diese Anekdote über einen Autor – ich weiß nicht mehr, war es Thomas Mann, Kant oder Freud? –, der jedenfalls zwei Schreibtische besitzt, an denen er an zwei verschiedenen Werken arbeitet. Kommt er mit dem einen Text nicht voran, treibt es ihn also fort, so drängt es ihn geradewegs zum anderen Schreibtisch hin und umgekehrt. Es gibt kein Entkommen. Die Fluchtbewegung wird so produktiv, und das Ganze wird beinahe zum literarischen Perpetuum mobile. So ähnlich habe ich auch – mit Ausnahme großer Teile von Terrain vague, die zuerst entstanden sind – an diesem Roman gearbeitet. Wurden mir etwa Chantals Zynismus der Cahiers und die Dunkelheit eines langen Winters zu viel, so habe ich an Akios Aufzeichnungen weitergeschrieben, die etwas Fröhliches und Tröstliches haben. Wenn ich des Spielens müde wurde, bin ich zu den Enzyklopädien eines Ichs geflüchtet und so weiter.
Was ist die beste Lese-Reihenfolge? Gibt es die überhaupt?
Die gibt es nicht. Es gibt aber sicherlich einfachere oder herausforderndere Reihenfolgen. Im Prinzip kann man sich dem Roman von jeder Seite nähern, man kann auch parallel oder selektiv lesen. Das ist wahrscheinlich eine sehr zeitgemäße Rezeptionshaltung. Ich selbst lese meistens in bis zu fünfzig Büchern parallel und so gut wie nie ein Buch zu Ende.