1 – Prosanova lieben
Es gibt wenig Dinge im Leben, für die ich mich mehr begeistern kann als für das Literaturfestival Prosanova. Aber Achtung: Ich bin ein kompromittierter Beobachter, weil ich das Festival 2005 gemeinsam mit fünf Freund*innen begründet habe. Von daher schaue ich auf dieses Ereignis immer mit dem look of love. Junge Gegenwartsliteratur, Performativität und experimentelle Lesungsformate, eine Community der gleichgesinnten Festivalbesucher*innen (und deren harter Kern eine Art Wunsch-Großfamilie), der Kollektivrausch einer sehr guten Party – wenn das alles zusammenkommt, kann ich mir nicht helfen: I love it. Hinzu kommt bei den letzten zwei Ausgaben (2017 und 2020) ein dezidiert politischer Blick auf Welt allgemein und den Literaturbetrieb im Besonderen. Ausgiebige Diskussionsrunden und Workshopformate, Rausch und Reflexion, kollektive Bewusstseinserweiterung – mein liebster Daseinsmodus. Sich an vier Tagen zwischen dreißig und fünfzig Einzelveranstaltungen reinstellen, in einen Flow geraten, von Ereignis zu Ereignis driften – wie man es sonst vielleicht nur von Film- oder Musikfestivals kennt. Auf der Festivalwiese zwischen den Lesungen, auf den Partys am Abend oder beim Frühstücken am Morgen ist man dauernd im Gespräch über das Gesehene. Und zugleich ist man ab Tag 2, spätestens ab dem Morgen des 3. Tages angelaugt, porenoffen, in dieser Post-Kater-Empfänglichkeit.
2 – School Of Life And Prosanova
Was eine Lesung ist, was eine Literaturveranstaltung kann, habe ich im Wesentlichen auf den bisherigen fünf Prosanova-Ausgaben gelernt: Was es ausmacht, dass man Literatur kollektiv rezipiert und eben nicht alleine vor seinem Buch sitzt; die Bedeutung von Co-Präsenz, also der Energiestrom zwischen Autor*in und Zuhörer*innen; überhaupt die Frage, wie Begegnung und Interaktion gestaltet sind und wie mit dem Raum umgegangen wird; die Momente von Improvisation und – sofern vorhanden – Medieneinsatz (Musik, Bilder, Filme, die die Lesung überlagern oder ergänzen); das Spürbarmachen von Textentstehungsprozessen und das Ausstellen der Materialität von Texten; Lesegestus, Stimme und Ausstrahlung einer Autor*in – alle oder zumindest viele dieser Elemente kommen bei einer starken Literaturveranstaltung zusammen und sind bewusst oder unbewusst gestaltet.
3 – Trauerarbeit leisten
Irgendwann im April 2020 sinkt dann auch bei mir die Erkenntnis ein, dass Prosanova in diesem Pandemie-Frühjahr sehr anders aussehen würde als seine Vorgängerausgaben. Nachdem ich am Anfang des Lockdowns noch viele Lesungen der großartig engagierten Viral-Lesungsreihe des Glitter-Magazins angeschaut habe, stellt sich irgendwann eine Ermüdung ein: durchwachsene Bild- und Soundqualität, immer wieder ähnliche Wohnzimmer-Settings, keine Interaktion jenseits von ein paar Likes und knappen Bemerkungen in sozialen Netzwerken. Noch ernüchternder ist, im Mai das Theatertreffen auf dem Bildschirm zu erleben: kleine Glühbirnen-Menschen, die über eine entfernte Bühne wandeln und Texte aufsagen. Ein Live-Festival ins Netz zu verlegen wirkt da wie ein trotziger, aber sinnloser Versuch, Normalität zu behaupten. Mir wird nochmal mit aller Deutlichkeit klar, dass es 2020 also kein Wunschklassentreffengefühl geben wird, kein Pilgern nach Hildesheim, kein Festivalzentrum, kein Fest. Noch bedrückender wird die Vorstellung eines Digital-Prosanovas, wenn ich mir ausmale, wie es sich für die Festivalmacherinnen anfühlen muss, das gesamte Festival in den digitalen Raum zu verlegen. Prosanova selbst zu organisieren und zu kuratieren war die intensivste Arbeitserfahrung meines Lebens – Schlafmangel, Freund*innen, die sich gekränkt abwandten, weil man keine Wahrnehmungskapazitäten mehr für sie frei hatte, ein emotionaler Zusammenbruch am dritten Festivaltag. Die Künstlerische Leitung zu übernehmen bedeutet, eineinhalb Jahre Lebenszeit in ein unterbezahltes Projekt zu investieren, das nur möglich wird, wenn alle an der Organisation Beteiligten viel Idealismus aufbringen. Wenn eine vergleichbare Pandemie im März 2005 ausgebrochen wäre, hätte es dieses Festival vermutlich einfach nie gegeben.
4 – Das Programm bewundern
Im Verlauf des Mais wird dann klar: Die aktuelle Festivalleitung lässt sich von den viralen Umständen nicht beirren. Nach und nach werden Line-up und Programm verkündet. Ich kenne lediglich gefühlte fünf der eingeladenen 50 Autor*innen. Gezeigt wird ein Gegenprogramm zu dem, was sonst überall zu sehen ist. Prosanova war schon immer die Utopie eines anderen, besseren Kulturbetriebs, ein Literaturmarathon, der alles Verstaubte hinter sich lassen will und frisch auf Texte und Autor*innen blicken, ein Veranstaltungscluster, das neue Formate ausprobieren, neue Stimmen nach vorne schieben will – eben genau so, wie sich ein Haufen junger literaturfanatischer Menschen das ausmalt. Ein Shift-Button hin zu einem besseren Betrieb. Das nimmt Prosanova 2020 in aller Konsequenz ernst, beschleunigt dieses Fast Forward nochmal – nicht nur weil es komplett digital stattfindet, sondern vor allem, weil es mit aller Vehemenz, aller politischer Deutlichkeit und mit Wissen für die eigene Position im Betrieb für vier Tage einen diverseren, vielfältigeren, bewusstseinserweiternden Literaturbetrieb entwirft. Eine Festivalausgabe, die wie keine andere ihrer Vorgängerinnen die Entdeckung neuer Stimmen nach vorne schiebt, ein Festival, das nicht von der Mitte her denkt, sondern vom Kommenden, das nicht die immer gleichen toastbrotbleichen Autor*innen featured wie sonst überall, sondern für vier Tage eine Diversität als Normalnull setzt, von der man sich wünschen würde, dass sie schon längst Standard wäre und nicht eigens herausgehoben werden müsste.
5 – Schaugemeinschaften bilden
Was dann während des Festivals sehr hilft: das Programm nicht alleine anzuschauen, sondern mit anderen Prosanova-Affizierten gemeinsam. Wir verabreden uns zu kleinen Gruppen à fünf Leuten und belagern Küchen und Hinterhöfe. Die Blitzanalyse, die Ad-hoc-Diskussion über das eben Gesehene, eine gemeinsame Zigarette zwischendurch, kühle Biere, rote, sprudelnde Getränke, Querverweise auf die Veranstaltung von gestern oder die von vor neun Jahren – all das ist in dieser Form gerettet. Und nebenbei kann man sogar für die Gruppe kochen.

Am Freitagabend respektive Samstagmorgen treffen sich dann zweieinhalb Schaugemeinschaften in einem Park in Neukölln – die Euphorie sich so zu sehen (trotz zwei Armlängen Abstand), lässt einen vergessen, dass wir in Corona-Berlin festhängen und nicht auf dem Festivalgelände unserer Wünsche.
6 – Staunen über so viel tech savvy
Entscheidend für die Euphorie war, wie großartig das Programm kuratiert, wie durchdacht und tech savvy das Festival ins Netz verlegt worden ist. Wie bei einem Live-Festival werden die einzelnen Veranstaltungskacheln sukzessive freigeschaltet – teilweise muss man sich zwischen zwei Events entscheiden, weitereilen, um den nächsten Start nicht zu verpassen, zumindest wenn man ansatzweise weiter am Freischalthorizont dranbleiben möchte (die Veranstaltungen sind dann in der Folge den Rest des Wochenendes on demand abrufbar). Lust, sich diesem Sog hinzugeben, entsteht auch durch zwei Telegram-Chatgruppen, eine davon mit ca. 500 Teilnehmenden, die vom Festivalteam klug moderiert wird (inklusive verschiedenen interaktiven Challenges, Gute-Nacht-Geschichten und Chats mit einzelnen Festival-Autor*innen). Noch mehr Suchtpotenzial hat für mich die zweite, bei der frühere Festivalmacher*innen mit der aktuellen Künstlerischen Leitung im Austausch stehen. Live-Kommentare zu den eben freigeschalteten Veranstaltungen; nerdige Rückbezüge auf eine Lesung mit Dorothee Elmiger und Wolfram Lotz beim Prosanova 2014; ein Strauß verspielter Gifs und liebevoll produzierter Festivalsticker, Jokes, Clips und theoretisierendere Verortungen tickern durch. Was das eigentliche Programm angeht, schälen sich zwei Tendenzen heraus: Konzentration aufs Wesentliche (also Lesung als Soundfile ohne Bild, ohne Schnickschnack) – großartig etwa Laura Naumann, die aus ihrem neuen Romanprojekt liest, oder die vielschichtige Lyrik von Ronya Othmann. Hinzu kommen eine Reihe voraufgezeichneter Gespräche, Chatverläufe und Zoom-Talks – etwa die drei »Confession Rooms« oder die kontroverse Diskussion zu Trigger-Warnungen und Identity Politics; neben diese klassischen, reduzierten Netzformate treten aufwändig produzierte Hörspielstrecken und der Audio-Walk zu FLEXEN. Flâneusen*schreiben Städte, bei dem man mit Tonbegleitung auf einen Spaziergang geschickt wird, wahrnehmungssensibilisiert für eine erst im Gehen entworfene, feministischere Stadttopografie. Am aufwändigsten sind sicherlich eine Reihe kurzer Literaturfilme – Anaïs Meiers »Spiel um das Alpensanatorium« etwa oder großartige Kurzprosa von Judith Keller mit animierten Zeichnungen in Tattoo-Ästhetik des Kollektivs Walter Wolff. Die Oberfläche ist hier jeweils angenehm glatt und ausproduziert, die Texte und Text-Bild-Beziehungen sperrig, widerständig, vielschichtig. Das Gleiche kann man auch bei Yade Yasemin Önders »fünf« beobachten. Yade liest darin neue Passagen aus dem beim open mike 2018 preisgekrönten, subtil autofiktionalen Text, der von einem Aufwachsen in einem Kollektiv von fünf Freundinnen erzählt. Zentral ist dabei die sich herausschälende Selbstbehauptung des Ichs in einer Fülle von Fremdzuschreibungen an die Rolle des Mädchens, einer vermeintlich prekär und bildungsfern aufwachsenden, postmigrantischen jungen Frau. Vom vorpubertären Raum bis zum Studium samt seinen akademistischen Distinktionsritualen erstreckt sich der Erzählrahmen: »Uns schmeckt weder Sesam noch Saussure, weder Dinkel noch Derrida.« Die filmische Umsetzung von Önder und der Videokünstlerin Dorothy Parker ist denkbar schlicht: Wir sehen Önders Gesicht in Nahaufnahme. Während sie diesen hoch verdichteten Text sehr klar vorträgt, fallen Filmbilder in Kodakcolorästhetik auf ihr Gesicht, das zur Leinwand wird für tanzende Menschen, Gesichter, Frauen in Abendgarderobe. Diese Schichten von Licht und Schatten steigern sich, lassen Önder teils ganz verschwinden und dann wieder umso klarer heraustreten.
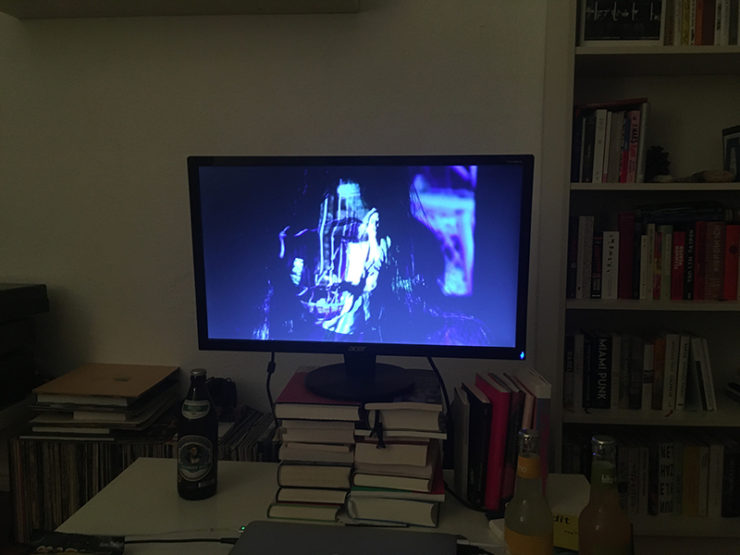
Was hier gefunden wurde, ist eine Form, die den pandemisch verhinderten physischen Lesungsraum vergessen macht, die gestreamt sogar stärker wirkt, als das eine Live-Veranstaltung normalerweise leistet. Das liegt einerseits an dem im Wortsinn vielschichtigen Konzept, andererseits an diesem Nah-Dran-Sein der Kamera. Darin scheint ein tieferes Verständnis für Wirkungsweisen des Internets auf – eine medial vermittelte, reale oder fingierte Intimität. Thematisch findet sich das auch in den »Confession Rooms« wieder oder in einem Lesung-mit-Gespräch-Format von Raphaela Edelbauer unter dem Titel »Sisipha«. Wir sehen Edelbauer bei sich zu Hause, sie spricht über den zehn Jahre währenden, immer wieder gescheiterten Schreibprozess ihres 2021schließlich erscheinenden Romans, sehen zwischendurch Edelbauers beeindruckenden Bizeps beim Workout in ihrem Garten – insgesamt ergibt das einen Hybrid aus Lesung, Autorinnengespräch, Homestory und der Parodie einer Homestory, ein sehr überzeugendes Netzformat.
7 – Im Abklingbecken
Letzte Empfehlung: das Festival in kleinen Kollektiven an der frischen Luft nachbereiten.


























