Tampakika, oder ein später Brief
Ende Dezember 2015. Ich erzähle meinen Großeltern, dass ich nach Griechenland fahre, und denke, sie fragen jetzt, warum, doch sie sagen nur, dass es gut ist, dass ich das mache. Warum genau ich dort hinfahren möchte, darauf habe ich keine Antwort. Weil ich mir selbst ein Bild machen möchte? Wahrscheinlich. Weil ich die letzten zwölf Jahre sehr viel Zeit auf dem Balkan verbracht habe, die Region für mich ein zweites, ein selbstgewähltes Zuhause geworden ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich möchte mich irgendwie einbringen. Möchte helfen. Vielleicht auch nur mir selbst.
Anfang Januar 2016. Wir treffen uns um 10.30 Uhr vor dem Neustädter Bahnhof in Dresden. Wir kennen uns untereinander kaum, haben uns erst einmal auf dem Vorbereitungstreffen des Vereins eine Woche zuvor gesehen. Der Verein heißt Dresden-Balkan-Konvoi. Und wir (das sieht jeder auf den ersten Blick), sind eine lose Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, etwas tun zu wollen: die von dem Verein gesammelten Spenden entlang der sogenannten Balkanroute zu verteilen und sich an der Versorgung geflüchteter Menschen zu beteiligen.
Ich steige in einen alten Bulli ein, der K. gehört. Der Bulli ist einer von drei Kleintransportern, die am Abend zuvor bis unter das Dach mit Kleidung, Schlafsäcken und Medizin beladen wurden. Es gibt kein Autoradio, dafür hat K. viel zu erzählen. Später erzähle auch ich sehr viel. Der Bus hat nur 37 PS und muss in Bratislava repariert werden. Ein Freund aus Istanbul schreibt, dass es einen Anschlag in Sultanahmet gegeben hat. Es vergehen Stunden, bis ich ihm antworte.
Zwischen Bratislava und Györ frage ich K. zweimal, warum der Bus nur 37 PS hat. Kurze Zeit später finde ich mich damit ab.

Während der übrigen 1.300 Kilometer, die wir teils nur im Schritttempo zurücklegen, weil der Balkan vor allem ein Hochgebirge ist (ich frage K. nicht, ob ihr das nicht bewusst war), stelle ich mir oft die Frage, warum ich mich in Griechenland engagieren möchte und nicht in Deutschland. Ich finde keine zufriedenstellende Antwort. Die Landschaft, die da draußen an uns vorbeizieht, kenne ich sehr gut. Doch der Winter hat die Farben verschluckt.

Von den anderen hören wir: der Bus mit dem Trailer ist bereits auf Chios, und man unterstützt die Arbeit der dort teils schon für mehrere Wochen helfenden Freiwilligen. Die sechs Insassen des zweiten Busses haben sich entschieden, in Mazedonien zu bleiben. Wer was wie und warum macht, wird spontan und je nach Notwendigkeit entschieden. Ich würde auch am liebsten nach Mazedonien abbiegen. Aber hier geht es nicht um mich.
Wir brauchen dreieinhalb Tage bis zur griechischen Küste. Geplant waren dreißig Stunden. Sturm und Unwetterwarnungen. Und wir bleiben erst einmal in der Stadt, die Kavala heißt.

Mehrmals am Tag gehe ich (K. bleibt meist im Hotel) durch die Stadt spazieren und zuletzt immer zur Hafenpolizei. Die Polizisten freuen sich jedes Mal mich zu sehen, und vertrösten mich auf weitere sechs Stunden, in denen entschieden wird, ob das Wetter entsprechend sei, dass die Fähre endlich von Lesbos, wo sie seit zwei Tagen vor Anker liegt, ablegen dürfe.
Kavala, sechs Tage nach der Abfahrt in Dresden. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Die zusätzlichen Ausgaben für das Hotel stören mich nicht, vielmehr die Zeit, die ich wegen der langen Fahrt und des Wartens auf besseres Wetter verloren glaube. Am Mittag teilt man mir im Büro der Hafenpolizei mit, dass die Fähre in Lesbos ablegen wird, noch heute Abend in Kavala eintreffen und sofort wieder zurück und bis nach Chios und anschließend noch weiter bis nach Athen fahren wird.
Drei Stunden vor Ankunft der Fähre. Die Sonne geht gerade unter, und wir fahren mit dem Bulli zum Hafen. Der Wartebereich des Terminals füllt sich langsam. In dem sich anschließenden Café sitzen Männer. Keiner trinkt Bier oder andere alkoholische Getränke, aber alle trinken Kaffee aus kleinen Espressotassen und Wasser aus schmalen Gläsern und alle schauen Fußball auf sechs im Raum verteilten Monitoren.
Vor dem Terminal halten jetzt mehrere Kleinwagen, die mit zahlreichen Plastiktüten beladen sind, es steigen Rentner aus, die provisorische Tische aufbauen. Immer mehr Rentner kommen in ähnlichen Kleinwagen an.

Sie haben Kuchen und Suppentöpfe und Obst und Gemüse und Kleidung und Schuhe dabei. Ich komme zuerst mit Maria, später mit Eléni und ihren Freundinnen und Bekannten ins Gespräch. Sie erzählen mir, dass sie zweimal die Woche hier sind, immer wenn eine Fähre von den Inseln kommt. Und ich bin glücklich, das Bild dieser Menschen, von denen keiner eine griechische Fahne schwenkt, um das Abendland oder die eigenen Sorgen zu verteidigen, mit nach Hause nehmen zu können.
Busse stehen bereit. Man erzählt mir, dass die Syrer, Afghanen und Iraker nach Idomeni an die mazedonische Grenze und alle anderen nach Athen gefahren werden. Ein Ticket an die Grenze soll mindestens 150 Euro kosten. Maria sagt, das stimme nicht, die Fahrt sei kostenlos. Nieselregen setzt ein. Als ich wenig später die Menschen sehe, die über die Laderampe die Fähre verlassen, spannen einige der Rentner ihre Schirme auf und gehen ihnen entgegen, sagen, dass sie nicht in eines der Taxis, die in Sichtweite stehen, einsteigen sollen. Sagen, dass es am Terminal Essen und heiße Getränke und Kleidung gibt, dass hinter dem Terminal Busse auf sie warten. Auch ich werde mehrmals gefragt, wo es zum Bus nach Mazedonien geht. Ich bin überfordert und versuche so gut ich kann bei der Koordination zu helfen und zu lächeln, was mir manchmal auch gelingt.

Eine halbe Stunde später ist alles wieder ganz ruhig im Hafen von Kavala, von dem wir weitere dreißig Minuten später in Richtung Süden ablegen.
Die Heizung auf der Fähre funktioniert nicht oder wurde nicht angestellt. Die wenigen Passagiere frieren trotz ihrer Winterjacken. Um sechs Uhr morgens steigen auf Lesbos circa fünfhundert Menschen zu, fast ausschließlich Familien aus Syrien. Sie fahren nach Piräus. Die Crew ist genervt. Ist das verständlich? Vielleicht sind die Crew-Mitglieder auch nur überfordert? Ich weiß es nicht.
Neun Uhr morgens in Karfas, einem Dorf etwas außerhalb der Stadt Chios. Wir lernen einige der anderen Freiwilligen kennen und trinken türkischen Kaffee, der hier griechischer Kaffee heißt. Ich höre Tampakika. Ein Wort, das klingt, wie ausgedacht. Tampakika ist das Registrierungscamp. Ein weiteres Camp bei der alten Festung heißt Souda. Und dann soll es da noch das Port-Camp geben und eines namens Depethe, gleich am Kreisverkehr im Zentrum der Stadt.
Da ich immer noch nicht schlafen kann, verteile ich mit S. die Spenden, die noch in dem Bulli sind, auf verschiedene provisorisch eingerichtete Sammelstellen. Eine dieser Sammelstellen war bis vor vier Jahren ein gut gehendes Restaurant, erzählt mir der Besitzer, der Giorgís heißt. Er schimpft nicht auf die Welt, auch nicht sein Freund Mímis, der uns ebenfalls hilft und überzeugt ist, dass alles noch viel schlimmer werden wird. Vielleicht hat er recht, doch das sage ich ihm nicht. Er erzählt von seiner Zeit in England und in Deutschland, wo er jeweils ein paar Jahre gearbeitet hat. Zum Abschied bedankt er sich bei mir, weil ich den weiten Weg von Deutschland bis nach Chios zurückgelegt habe, um hier zu helfen, und dann lacht er und schüttelt den Kopf und sagt: Ihr Deutschen!

Wir fahren in die Stadt. S. ist Tischler und seit zwei Monaten auf der Insel. Er hat gerade eine Box gebaut, mit der man Schuhe trocknen kann. Er erklärt mir, dass in der Box mittels Ventilatoren Konvektionsströme erzeugt werden, das Verfahren also dem einer Holztrocknung sehr ähnlich ist. Wir fahren immer an der Küste entlang, an der die Boote ankommen.

Ich lerne: Wenn es gut läuft, sind ein paar Freiwillige zur Stelle und versorgen die Menschen mit Decken, heißem Tee und etwas zu essen und neuen Socken. Wenn es richtig gut läuft, auch mit trockenen Schuhen und trockener Kleidung. Meist ist als einer der Ersten auch ein Pick-up vor Ort. Der Fahrer und Beifahrer des Pick-ups schnappen sich den Motor des Bootes und verschwinden spurlos. Manchmal kommt auch die Polizei und stellt Fragen, wer das Boot gesteuert hat und so. Läuft alles glatt, zahlt derjenige, der das Boot steuert, einen geringeren Preis für die Überfahrt, und niemand verrät ihn. Läuft es schlecht, wird die Familie des Steuermanns als Pfand auf der türkischen Seite festgehalten, und er lässt die anderen noch vor der Küste ins Wasser springen, und sie müssen den Rest schwimmen, während er mit dem Boot und dem Motor (der ist wichtig) in die Türkei zurückkehrt, um vielleicht bei einer nächsten Überfahrt zusammen mit seiner Familie endlich übersetzen zu dürfen. In den Booten sitzen außen die Männer und in der Mitte die Frauen und Kinder, immer zwischen dreißig und siebzig Personen. Auf einem ähnlich großen Boot der Agentur Frontex finden offiziell sechs Personen Platz.

Dann wird auf einen städtischen Bus gewartet, der pro Person drei Euro kostet und die Menschen nach Tampakika bringt. Hat jemand die drei Euro nicht, muss er nach Tampakika laufen oder auf das gute Gewissen des Busfahrers hoffen. Werden die Menschen, die laufen müssen, von der Polizei aufgegriffen, gibt es Ärger, der mit drei Euro nicht aufzurechnen ist.
Wir halten auf einem großen, vom Regen zerfressenen Hinterhof vor einer alten Werkshalle, dem Registrierungscamp. Tampakika. Das Glas der meisten Oberlichter fehlt, sodass drinnen nahezu die gleiche Temperatur herrscht wie draußen. Die Halle selbst wird durch ein System an Zäunen aufgeteilt, die an einer der Längsseiten zwei schmale Gänge bilden, durch die die Menschen bis zum Ende laufen, wo Angestellte der Samariter ihnen Papierbändchen um die Handgelenke kleben, die wie die Eintrittsbänder eines Konzerts oder eines Festivals aussehen. Darauf stehen Buchstaben, die anzeigen, mit welchem Boot und an welchem Tag sie hier in Tampakika eingetroffen sind und ob sie beispielsweise einen der Schlafsäcke, mit denen sie die Nacht hier verbringen werden, erhalten haben. Dann bekommt jede Person einen Schein, der ausgefüllt werden muss. Und dann dauert es noch einmal vier bis zwölf Stunden (oft auch viel länger), bis die Anzeige am Ende der Halle die Personen nach Booten aufruft. Und dann können sie sich in einem persönlichen Gespräch mit der griechischen Polizei und Mitarbeitern der Agentur Frontex am Ende der Halle (wiederum hinter einem ausgeklügelten System an Gängen, die durch Zäune begrenzt werden) offiziell registrieren lassen.
Die meiste Zeit verbringe ich mit M. Wir sind uns sehr schnell einig, dass wir uns aufs Teeverteilen in Tampakika (wenn möglich auch in den anderen Camps) konzentrieren, statt die Küste abzufahren, illegale Pushbacks (Zurückdrängen der Schlauchboote durch die griechischen Behörden oder durch Frontex) zu registrieren oder Hilfe zu koordinieren oder als Erste an Ort und Stelle zu sein. Die Shore-Gruppen, die an den Stränden aufpassen, sind gut ausgerüstet und melden sich, falls sie Hilfe benötigen.
Zunächst müssen mehrere hundert Liter Tee gekocht und anschließend in die Camps gebracht werden. Dann: neuen Tee kochen und später die Schicht in Tampakika ablösen und selbst den Tee verteilen. Zwischendurch wirst du von der Polizei kontrolliert, weil das mehrmals am Tag passieren kann oder weil du gerade dort bist, wo ein Boot an der Küste ankommt.

Ansonsten bist du auf einem Plenum mit anderen Freiwilligen oder auf einem Plenum deiner eigenen Gruppe, oder du kaufst ein, oder du fährst jemanden ins Krankenhaus, oder du kaufst Tabak, oder du legst dich für ein paar Stunden schlafen. Wir sind zu zehnt und haben in unserer Unterkunft Platz für fünf Personen.
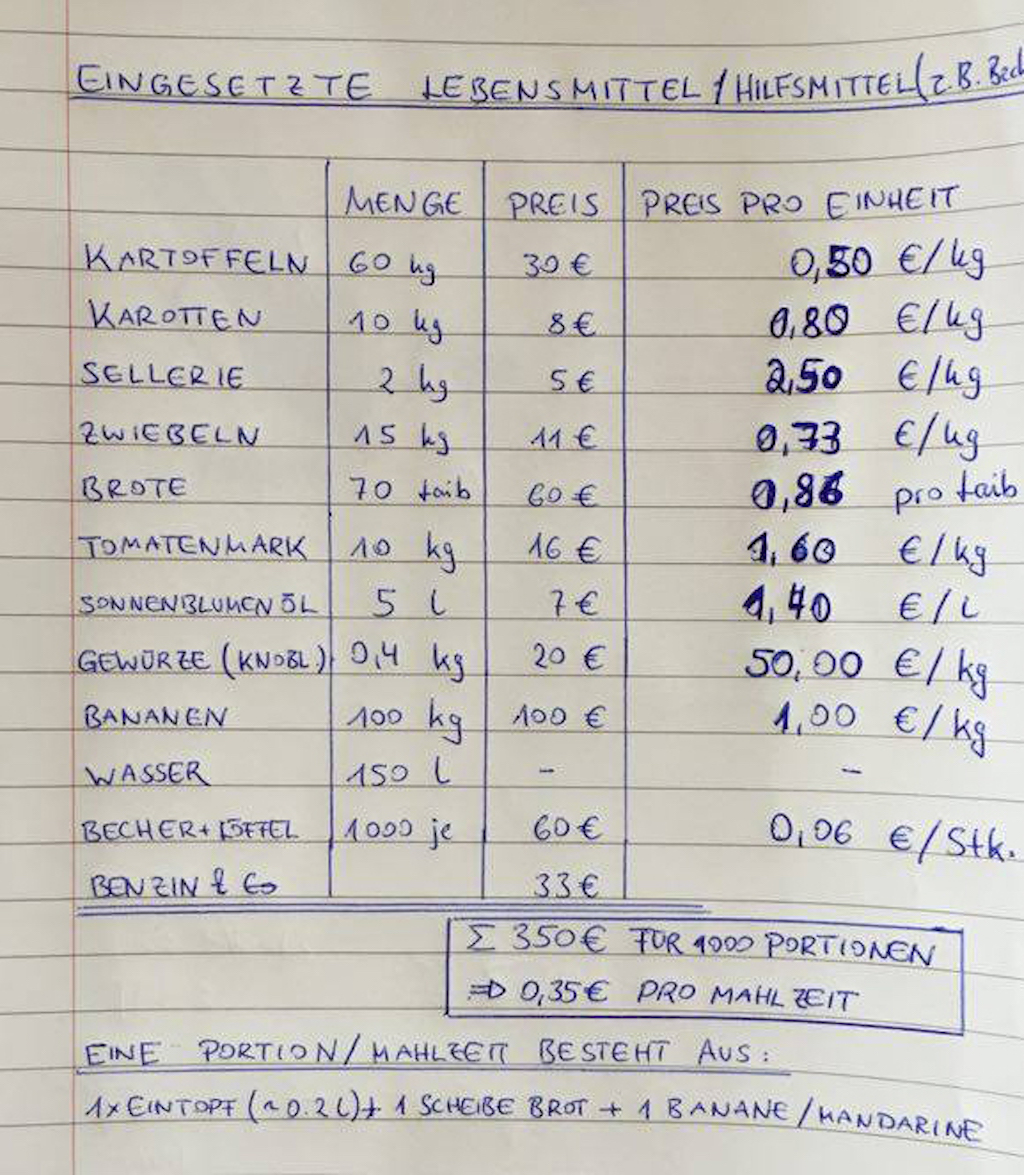
Tage später, gegen fünf Uhr. Ich habe fast dreißig Stunden nicht geschlafen und muss daran denken, dass ich dir, obwohl ich dich kaum kenne, vor meiner Abreise vorgeschlagen habe, zu schreiben. Notizen als Vorsorge, um nicht durchzudrehen. Besser ist das, hast du geantwortet. Jetzt würde ich dir schreiben, dass ich sehr müde bin, wie wohl die meisten Menschen hier. Und ich würde dir schreiben, dass es in der Halle jetzt auch ein paar Heizpilze gibt, die ein Käfig aus Maschendrahtzaun umgibt. Daran hängen die Menschen ihre nassen Kleider. Und dann gibt es da noch einen Verschlag aus OSB-Platten, vor dem sich immer lange Schlangen bilden. Wir nennen diesen Verschlag die Boutique, denn darin verteilen einige der anderen volunteers die eingegangen Kleiderspenden. Volunteers, so werden wir von den meisten auf der Insel genannt. Nur nicht von den geflüchteten Menschen, denn die wissen ja nicht, dass wir Freiwillige sind. Neben der Boutique ist eine Tür, an die ein rotes Kreuz gemalt ist. Diese ist nachts fast immer verschlossen. Vielleicht, weil es den Mitarbeitern zu gefährlich ist in Tampakika, aber das habe ich nur gehört.
Auch gehört habe ich, dass es einen inoffiziellen Drei-Tages-Rhythmus gibt, dem hier vieles folgt: Wird von der Türkei aus gezielt die Insel Lesbos angesteuert, können sich die Camps auf Chios in dieser Zeit wieder leeren, da die Menschen die Insel schnellstmöglich mit den Fähren verlassen möchten. Dann folgt wieder ein Run auf Chios und so weiter. Doch die letzten beiden Tage haben die Angestellten der griechischen Fähren für bessere Löhne gestreikt, und die Menschen kommen nicht aufs Festland, die Camps auf Chios sind voll.

Ich würde dir schreiben, dass meine und die Hände von M. vom Zucker im Tee kleben. Der Tisch vor uns klebt, und ich habe Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl habe, nicht weiter zu wissen. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich heute Nacht schon mit den Mitarbeitern von UNHCR streiten musste, sie angeschrien habe wegen Menschen, die ins Krankenhaus und nicht in diese Halle gehören. Und wie oft die Worte Zuständigkeit und Polizei und nicht möglich und Registrierung und illegal fielen, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass P. irre Kraftreserven hat und diese Menschen dann doch ins Krankenhaus fährt und wir mögliche Konsequenzen zu verantworten haben. Und: dass unaufhörlich weitere Boote kommen, davon würde ich dir schreiben. Selten trägt noch jemand trockene Kleidung. Und wir alle, die wir hier in dieser Halle immer weniger Platz haben, verwandeln uns langsam in gefährliche Tiere, die sich gegenseitig beißen und schlagen, weil zusätzlich die Ungewissheit und Angst und Erschöpfung und Kälte und Nässe die Anspannung immer weiter steigern. Dass es bereits mehrere Schlägereien um die besten Plätze an den Heizpilzen gab und um Kleidung und Schlafsäcke, die gestohlen wurden. Und dass die Polizei nur dann zu sehen ist, wenn sie, und das passiert ganz unauffällig, bei den Simkarten- und Snackverkäufern ihren Anteil eintreibt. Denn offiziell gibt es nichts zu essen in Tampakika. Offiziell gibt es auch uns nicht.

Und ich würde dir schreiben, dass sich ab Montag alle Freiwilligen in Tampakika registrieren lassen und für ihre Arbeit bezahlen müssen. Dass mich das aber nicht betrifft, weil ich dann bereits im Auto sitze. Und dass es mich deswegen dennoch trifft, während ich nach Deutschland zurückfahren werde. Und ich würde dir schreiben, dass ich bereits nach zwei bis drei Tagen ein Teil des Systems der Flucht geworden bin, an dem so viele Menschen sehr viel Geld verdienen, und vor allem, dass ich ein Teil geworden bin von Tampakika. Tampakika, wie das klingt. Bei Herta Müller habe ich einmal gelesen, dass Orte auch nur Gegenstände sind, ja, selbst der Nachthimmel ist nur ein Gegenstand, und dass sie unsere verlängerten Arme sind. Und sie sagt, diese Gegenstände stehen nicht einfach nur herum, sie sind Teil unserer Handlungen. Und manchmal beobachte ich andere Freiwillige oder die neuen des UNHCR, wie sie sich umsehen in Tampakika. Hilflos, erschrocken und ungläubig, und dann sage ich zu M., dass diese Gesichter recht haben und dass wir bereits abgestumpft sind. Und M. nickt und wir verteilen weiter Tee, helfen in der Boutique oder beim Anbringen der Armbändchen, sortieren die Schuhe in der Trockenbox ein und aus, besorgen etwas zu Essen oder einen zusätzlichen Schlafsack.
Später wird es hoffentlich wieder ruhiger. Und einige werden dann mit uns Gespräche an unserem Tisch führen, auf dem ein achtzig Liter fassender Topf mit heißem Tee steht, während die meisten versuchen zu schlafen. Sie werden erzählen, woher sie kommen und wohin sie am liebsten gehen möchten, und wir erzählen auch, woher wir kommen. Und das ist dann meist der Moment, an dem wir zusammen unsere Blicke durch die Halle schweifen lassen, in der ein paar Hundert Menschen in ihren Schlafsäcken liegen oder in Gruppen zusammensitzen, sich unterhalten oder diskutieren. Und wir sehen verzweifelte und frierende und verängstigte und lächelnde und kranke und glückliche und immer noch stark unterkühlte und weinende und gesunde und schreiende und erleichterte Menschen.


































