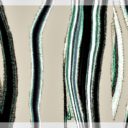J. sagt, wir brauchen drei bis vier Stunden bis nach Bukarest, und G. fügt hinzu, dass wir pünktlich zum Anpfiff des Finales da sind. Bis Călimănești läuft alles gut. Dann stehen wir, wie so oft in Rumänien, im Stau. Und weil jetzt auch noch die Nadel der Kühlwasseranzeige auf Anschlag steht, müssen wir an den Straßenrand fahren. Eine halbe Stunde später entscheiden wir, alle Fenster zu öffnen, die Lüftung auf Maximum zu stellen und es erneut zu versuchen. Im Schritttempo passieren wir bis zur Autobahn bei Pitești mehrere Baustellen und einen Unfall. Ein Auto liegt auf dem Dach oder darauf, was davon übrig ist. G. ist auf dem Beifahrersitz eingeschlafen und J. steuert den Wagen in die Nacht hinein.
Am Stadtrand von Bukarest drischt die Stimme des Radio-Reporters noch immer auf meine Gehörgänge, und ich frage mich, wie G. es schafft, nicht aufzuwachen. Es ist Éder, der das erlösende Tor für Portugal schießt, während die scheinbar endlos aneinandergereihten Blocks des Bulevardul Iuliu Maniu an uns vorbeiziehen. Die Stadtteile da draußen tragen Namen wie Roșu und Militari und die Stimme im Radio schreit seit über einer Minute Goool.
Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich mit dem Auto in die Stadt hineinfahre. Eine Freundin fragte mich vor ein paar Tagen, was ich in Bukarest will. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, und sagte, dass es keinen besonderen Grund dafür gibt.
Bukarest als Kind. Das waren neu errichtete Blocks, in denen das Wasser aus den Wasserhähnen in den oberen Stockwerken nur sporadisch tropfte, wenn man sie aufdrehte, und ein Fahrstuhl, in dem ich mit fremden Menschen stecken blieb. Bukarest, das war der grüne 1310er Dacia, in dem wir zu siebt an einen Beton-See fuhren, der gerade geflutet worden war. Ich erinnere mich nicht, ob ich schon damals darüber nachgedacht habe, ob ein See aus Beton noch ein See ist oder nicht, aber ich erinnere mich an die Abende im neunten Stockwerk und an den Geruch des Essigs auf unserer Haut, mit dem uns die Eltern einrieben, damit uns die Mücken nicht auffressen. Und dass ich damals lernte, dass man Mücken hier Moskitos nennt, und dass mir das gefiel, weil ›Moskito‹ für mich viel gefährlicher klang als das deutsche Wort ›Mücke‹.
Auf einer Werbetafel einer Apotheke blinkt die Zahl 25 und im Radio wiederholt eine weibliche Stimme das Resultat des Spiels und sagt anschließend, dass morgen 36 de grade Celsius erwartet werden. Mehr Nachrichten gibt es nicht für diese Nacht.
 Abseits der großen Straßen schläft die Stadt und auch das McDonald’s an der Piața Obor ist bereits geschlossen. Wir sind zu müde für einen Spaziergang ins Zentrum und lassen uns, nachdem wir nach einer Viertelstunde einen Parkplatz gefunden haben, von einem Taxi zum nächstgelegenen Fast-Food fahren.
Abseits der großen Straßen schläft die Stadt und auch das McDonald’s an der Piața Obor ist bereits geschlossen. Wir sind zu müde für einen Spaziergang ins Zentrum und lassen uns, nachdem wir nach einer Viertelstunde einen Parkplatz gefunden haben, von einem Taxi zum nächstgelegenen Fast-Food fahren.
Am Morgen steht G. als Erste auf und geht einkaufen. Wir trinken Kaffee, der für die meisten in Rumänien schon lange kein Luxus mehr ist. Zum Brot essen wir Telemea und Wurst und Paprika und Tomaten und wir rauchen, weil in Rumänien immer geraucht wird. Alles ist vertraut, nur der bio iaurt de băut irritiert mich. Ist gut für die Elektrolyte, sagt J. und ich weiß nicht, was ich sagen soll, auch wenn ich es gut finde, dass Bio-Trink-Joghurt selbstverständlich geworden ist, und nehme einen Schluck. Dann gehen wir durch die Teile der Stadt spazieren, die sich hinter den Blocks verstecken.


Den Mittag verbringen wir auf dem Friedhof. Nachdem die Grabsteuer für die letzten drei Jahre bezahlt ist, üben wir Kopfrechnen und lesen uns gegenseitig die schönen und die sonderbar klingenden Namen vor, zeigen auf hässliche Fotos oder auf die kurzen Verse und Lebensgeschichten, die in die Steine eingraviert worden sind.
Am Familiengrab von G. gibt es keinen Schatten. Wir bleiben dennoch und tauschen uns über die Mythen in unseren Familien aus und lachen viel und schwitzen und ich sehe in die Gesichter der beiden und weiß, auch sie sind glücklich, genießen diesen gemeinsamen Moment.
Fünf U-Bahn-Haltestellen vom Zentrum entfernt liegt das Viertel Crângași, an dessen Rand sich der Lacul Morii erstreckt, ein Stausee aus Beton, der in den Achtzigerjahren errichtet wurde. Irgendwo dort, sagt G. und zeigt in Richtung Sonnenuntergang auf das Wasser, haben meine Großeltern gewohnt.
 Dann sagt sie, dass sie nicht weiß, ob die Wohnblocks am Rand des Sees damals schon existierten, weil die Siedlung mit den kleinen Häusern, der Kirche und dem Friedhof ihr als ein Dorf in Erinnerung geblieben ist.
Dann sagt sie, dass sie nicht weiß, ob die Wohnblocks am Rand des Sees damals schon existierten, weil die Siedlung mit den kleinen Häusern, der Kirche und dem Friedhof ihr als ein Dorf in Erinnerung geblieben ist.
Um den See einmal zu umrunden, benötigt man vielleicht zwei Stunden. Während wir bis zu der großen Halbinsel laufen, frage ich mich, ob es nicht besser wäre, die Orte der Kindheit so zu belassen, wie sie in unserer Erinnerung sind, sie nicht noch einmal aufzusuchen.
In den kommenden Wochen arbeite ich tagsüber in einem leer stehenden Raum in der Wohnung eines Freundes an verschiedenen Texten, während er nebenan einen Dokumentarfilm über die rumänische Protestkultur schneidet, oder ich gehe spazieren und bin beeindruckt von dieser verrückten Gleichzeitigkeit der ungleichen Architektur dieser Stadt, oder ich versuche den Schlaf der Nächte nachzuholen, die fast immer zu heiß sind oder zu lang oder beides.
Ich lerne Freunde von Freunden kennen und an den Abenden sitzen wir oft in einem der vielen Biergärten, in denen man meist Cocktails, Wein und Longdrinks, und wenn schon, nur ungefiltertes Bier, trinkt. Und ich staune, wenn wir dann weiterziehen, wie wenig getanzt wird in den Clubs, wie leer sie sind, und lerne, dass das am Sommer aber auch am neuen Rauchverbot liegt, das nach den Protesten des letzten Winters durchgesetzt wurde. Proteste, die die Regierung zum Rücktritt gezwungen hatten, nachdem bei einer Brandkatastrophe im Club Colectiv mehr als sechzig Menschen starben. Ich erfahre, dass Rumänien derzeit das einzige Land in Europa ist, in dem Proteste auch etwas bewirken, und dass sich viele Menschen nach einer europäischen Normalität sehnen. Und ich frage mich, was das sein soll, eine europäische Normalität: ›Zivilisiert‹ ist das Wort, das ich fast jeden Abend zu hören bekomme.
Mitte August. Ich sitze in einem Auto und mein Shirt klebt an der Haut. Ich verlasse die Stadt, schaue nach draußen und überlege, warum ich hier war. Vielleicht müssen Orte immer wieder aufgesucht werden, damit sie nicht verloren gehen, damit man selbst Teil der Veränderungen sein kann. Ich weiß es nicht. Auf der Werbetafel einer Apotheke blinkt die Zahl 36. Ich zünde mir eine Zigarette an, verfluche den Stau und die Hitze und nehme noch einen Schluck meines Trink-Joghurts.