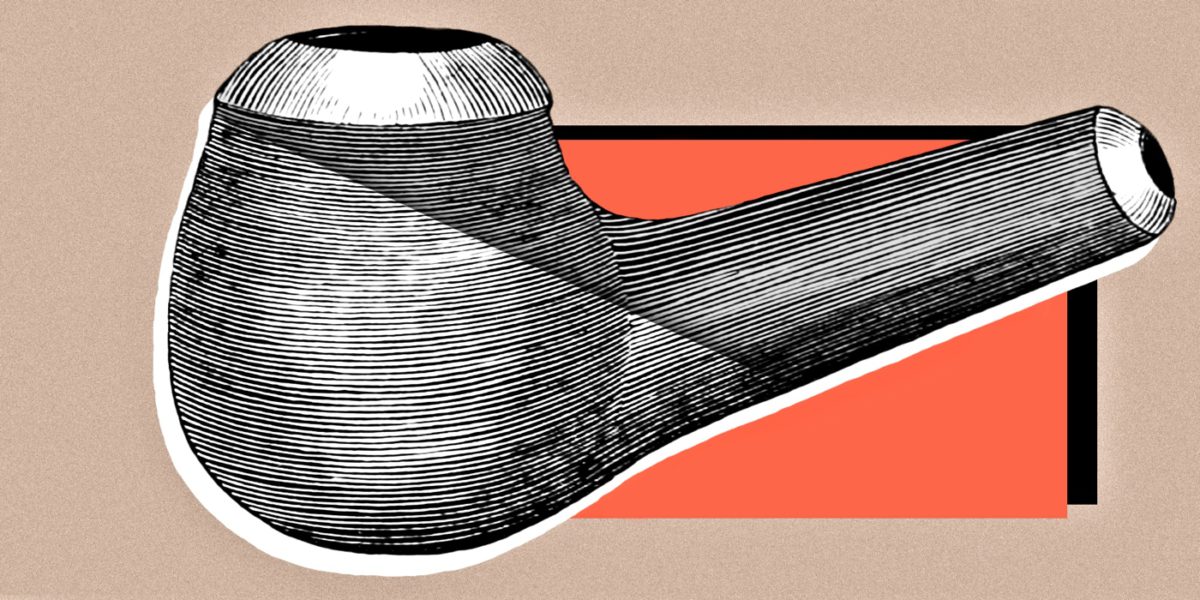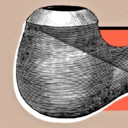Einmal, im Rahmen meiner Tätigkeit als Dolmetscher, arbeitete ich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und war bei der Anhörung – auch Interview oder, in Österreich, Einvernahme genannt – eines Asylsuchenden dabei. Die Anhörerin – je nach Position auch (Einzel-)Entscheiderin genannt, in Österreich Einvernehmende – fragte den Antragsteller, was er im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland befürchten würde. Das ist eine Standardfrage, die gegen Ende jeder Anhörung gestellt wird. Viele Asylsuchende antworten darauf mit: Verhaftung, Verfolgung, soziale Isolation, Repressalien, Folter oder Todesstrafe. Einige Anhörende nehmen die Antworten einfach zur Kenntnis, ohne weitere Fragen zu stellen. Andere tun dies aber, um weitere Details oder Erklärungen des Asylvortrags zu erörtern. Der genannte Antragsteller antwortete: »Wenn ich Glück habe, wird der König lachen.«
Die Anhörung ist die wichtigste Gelegenheit für die Asylsuchenden, ihre Fluchtgründe zu schildern und entsprechende Nachweise vorzulegen. Diese Punkte bilden die elementare Grundlage im Prozess der Entscheidungsfindung. Bei der anfänglichen Belehrung wird unter anderem betont, dass während des Gesprächs alles gesagt und vorgelegt werden solle und dass das Nachtragen von Inhalten und Dokumenten »gegebenenfalls nicht berücksichtigt werden kann«. Die Anhörung ist aber nicht nur deshalb eine komplexe Kommunikationssituation: Es gibt verschiedene Sprachen und Sprachformen, Erwartungen und Hierarchien zwischen den Teilnehmenden sowie emotional belastende Gesprächsinhalte für alle Beteiligten. Zudem treffen hier Menschen mit verschiedenen Erfahrungs-, Wissens- und Bildungshorizonten aufeinander. Prinzipiell wird von den Dolmetscherinnen verlangt – auch wenn die Praxis anders aussieht – allgemeine, professionelle und berufsethische Standards mitzubringen und diese einzuhalten: Zuverlässigkeit, Objektivität, Sprachsicherheit in Wort und Schrift, Neutralität, Verschwiegenheit, soziale Kompetenzen, Umgangsformen usw.
Die Antwort des Antragstellers irritierte die Anhörerin. Was er damit sagen möchte, fragte sie ihn. Ich übersetzte seine Antwort zuerst mit: »Na ja, wenn ich überhaupt das Glück habe, dass sie mir eine Pfeife anzünden«, und fügte hinzu, dass es auch anders übersetzt werden könne: »… dass sie mir eine Pfeife stopfen und anzünden.« Sie fragte mich, ob er es denn genau so formuliert habe. Ich erklärte ihr, dass eine wortwörtliche Übersetzung in etwa ›dass sie mir eine Pfeife vorbereiten‹ wäre. Der persische Begriff für die Vorbereitung einer Pfeife oder Wasserpfeife beinhalte bereits das Stopfen und Anzünden. Die Aussage könne allerdings noch genauer übersetzt werden, der Begriff sei auf Farsi gleichlautend wie Wörter für ›verdicken‹ oder ›mästen‹. Der Antragsteller bemerkte in unserem Klärungsgespräch die häufige Verwendung des Wortes und ergänzte, dass es nicht nur ›stopfen‹ und ›anzünden‹ bedeuten würde, sondern in mancher Hinsicht auch das Anrauchen bezeichne, mit dem man sichergehe, dass der Rauch »gut« sei und kein Kratzen im Hals verursache. Die Anhörerin, die nun ungeduldig wirkte, forderte eine konkrete Aussage: »Was befürchten Sie bei einer eventuellen Rückkehr in Ihr Heimatland?« Er aber schilderte ihr den Ursprung des Sprichworts: Früher gab der Henker den zum Tode Verurteilten bei der Zeremonie der Hinrichtung etwas zu Essen und zu Trinken. Manchmal wurde danach eine Wasserpfeife oder eine Pfeife vorbereitet. Sie mussten in diesem Fall mindestens einen Zug davon nehmen. Wenn sie nicht daran gewöhnt waren, husteten sie oder es wurde ihnen schwindlig. Dies brachte den König zuweilen zum Lachen. Danach trat der Henker mit einem Schwert, einer Lederschürze und einem Tablett für die Präsentation des Kopfes vor die knienden Verurteilten und wartete auf den Befehl des Königs.
Bei einer Anhörung wird von den Dolmetscherinnen meistens erwartet, sich auf den Transport inhaltlicher Informationen zu konzentrieren. Die vollständige Übertragung und inhaltliche Genauigkeit dieser stehen hier im Vordergrund. Dolmetschtechniken und -methoden sowie der Umgang mit Problemen der Übersetzbarkeit, Teil- und Unübersetzbarkeit spielen für die Anhörenden nur in Ausnahmefällen eine Rolle. Gelegentlich kann jedoch auch verlangt werden, weitere Aspekte wie nonverbale Kommunikationssignale, Lücken, kulturelle und persönliche Spezifika zu berücksichtigen. Es gibt durchaus Anhörende, die sich für den Sprachstil und das Sprachregister der Asylsuchenden interessieren. Das heißt beispielsweise, dass die alltagssprachliche Ausdrucksweise möglichst genau wiedergegeben werden soll. Und es gibt andere, die in jedem Fall den Einsatz der Behördensprache bzw. einer ›gehobenen‹ Sprache erwarten. Es soll sozusagen protokollreif gedolmetscht werden. Dolmetscherinnen haben verschiedene sprachliche, pragmatische, diskursive und strategische Fähigkeiten. Aber es wäre unrealistisch, sie als reine Kommunikationsmittlerinnen oder Brückenbauende zu betrachten. Genauso wäre es verfehlt, das Dolmetschen als einen universalen, neutralen und dekontextualisierten Handlungstypus der Kommunikation zu sehen. Dolmetschen bedeutet für alle Beteiligten, sich auch auf Differenzen, Irritationen, Spannungen und Konflikte einzulassen.
Bevor ich mich verabschiedete, fand ein kurzes Gespräch zwischen der Anhörerin und mir statt. In etwa so:
– Haben Sie von Anfang an gewusst, was er sagen wollte?
– Das mit dem Lachen des Königs wusste ich nicht. Aber ich kenne das Sprichwort und seinen Ursprung.
– Könige können sehr launig sein. Aber sagen Sie mal, warum haben Sie denn nicht einfach übersetzt, was er befürchtet hat.
– Er hat ja gesagt: »Wenn ich überhaupt das Glück habe, dass sie mir eine Pfeife anzünden.« Oder stopfen, anzünden und so weiter.
– Das weiß ich ja jetzt. Aber Sie wissen ja auch, dass eine wortgetreue Übersetzung nicht immer möglich und nützlich ist. Außer zum Beispiel bei kulturell geprägten Ausdrücken oder Eigennamen.
– Ich denke, er hat mit Absicht so gesprochen, um sein intimes Verhältnis zu seiner Sprache zu zeigen.
– Aber hier wäre doch eine inhaltliche Wiedergabe viel einfacher gewesen: »Ich befürchte meine Hinrichtung.« Das ist auch sehr intim.
– Fanden Sie seine Antwort nicht individueller und sinnlicher?
– Wie meinen Sie ›sinnlich‹?! Ich fand die Geschichte grausam. Nun gut, das spielt bei der Entscheidung ja alles keine Rolle. Herr Moradpour, Sie sind ja oft bei mir als Dolmetscher. Sagen Sie mir doch etwas auf Farsi, was ich Ihnen und den Antragstellern dann sagen kann.
– Sie sagen immer »willkommen«, wenn wir Ihr Zimmer betreten.
– Ja.
– Ihr Schritt auf meine Augen.
– Was?
– Das heißt »willkommen«, »sehr willkommen«.