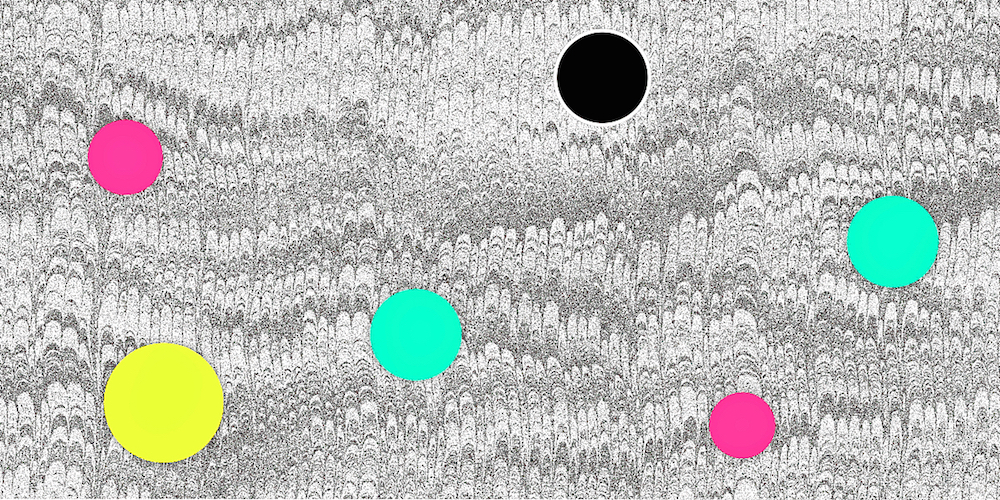… zu Höllerer mit den langen.«1
Die Erfindung des deutschsprachigen Langgedichts
»Der Höhepunkt war 1967 erreicht. Immer noch sprachen alle von der Nummer der Zeitschrift Akzente mit ›Langen Gedichten‹, die Walter Höllerer 1965 herausgebracht hatte, und seine Veranstaltungsreihe in der Berliner Akademie der Künste. ›Ein Gedicht und sein Autor‹ war das Ereignis der Saison«.2
Nicht selten setzen Würdigungsschriften am Zenit der Wirkmacht des Darzustellenden an. Diesem Kompositionsprinzip treu verbunden, rückt Helmut Böttigers Retrospektive von Walter Höllerers Schaffen die Berliner Zeit in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre unter das Brennglas der Betrachtung. Und Böttiger tut gut daran, bringt der Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und -vermittler Höllerer es doch damals zustande, die hochkarätigsten Vertreter der internationalen Literatur in den isolierten und noch kulturell ausgehungerten Westen der Stadt zu holen. Von Robbe-Grillet über Jandl und Mayröcker bis Pasolini folgt man gerne der Einladung, debattiert nachmittags im LCB und liest abends in überfüllten Auditorien und vor versammelten Fernsehkameras. Dass die illustren Gäste so bereitwillig und in Scharen kamen, Literaten wie Zuhörer, mag sicher auch am frühvollendeten Ruf Höllerers gelegen haben, der Fülle an Anthologien und Zeitschriften, die er herausgab, der nimmermüden Organisation von Diskussionsabenden und Veranstaltungsreihen. Nicht, dass Höllerer unbedingt eine neue literarische Nachkriegsavantgarde aus der Taufe heben wollte, aber immer und mit offenem Ohr die Pulsschläge der Zeit zu vernehmen, Erschütterungen nicht lediglich zu spüren, sondern die Einsicht zu haben, diese selbst herbeiführen zu können, war ausdrücklich Teil des Projekts.
Ein kleines Beben entfachte dann auch die Ausgabe des 1965er Jahrgangs der Akzente zum »Thema: Lange Gedichte«. Zu hervorstechender Berühmtheit hat es die Nummer allerdings nicht deshalb gebracht, weil sie den Auftakt von Autorenkarrieren markierte oder zum ersten Mal maßgebliche Texte versammelte, die heutzutage als weichenstellend für die Kanonisierung der bundesrepublikanischen Literatur gelten. Die Akzente sind zwölf Jahre nach ihrer Gründung 1953 angesehener Teil des Establishments. Gleiches mag für die meisten der Beiträger – merke: keineswegs alles Lyriker – des Hefts zu den langen Gedichten gelten: Von Peter Weiss über Rühmkorf, H.C. Artmann, Günter Grass, Erich Fried zu Günter Kunert und Helmut Heißenbüttel – einige verdanken ihre frühe Reputation durchaus auch dem umtriebigen Zutun des Herausgebers und Förderers Walter Höllerer – gibt man sich die Ehre und Klinke in die Hand – und dem literaturästhetischen Experiment »Lange Gedichte« eine Chance. Das Themenheft ist vielmehr aufgrund eines enthaltenen Textes berüchtigt, der aus literaturhistorischer Perspektive wie ein Mythos daherkommt und bis heute wirkt wie ein Gespenst: Walter Höllerers Thesen zum langen Gedicht, sechzehn kurze Sentenzen, die sich unauffällig inmitten der literarischen Beiträge tummeln, treten eine Debatte los, wie sie – rein theoretisch – kaum besser laufen kann. Es entwickelt sich eine Diskussion, bei der die Verunsicherung, worum es hier eigentlich geht (lange Gedichte), jederzeit und auf allen Seiten zu spüren ist.3 – Jeweils durch Asterisken unterteilt, wirken die zusammengestellten Stichpunkte auf das Auge und die Lesegewohnheit wie ein Kranz von Fragmenten. Ein lyriktheoretischer Entwurf wird präsentiert, der zwischen manifesten Proklamationen und der hoffnungsvollen Erwartung an die Poetologie eines in der deutschsprachigen Literatur bis dato (theoretisch) kaum beachteten Gedichttypus oszilliert. Höllerer serviert mit den Thesen eine gepfefferte Gedankenfülle nicht vorbehaltlos synthetisierbarer Konzeptionen für eine ihm vorschwebende Sorte von Gedicht, die in politisch düsteren Zeiten frei und engagiert die Fürsprache für das mögliche, bessere Leben übernehmen kann. Wie es die ursprüngliche Utopia will, ist nicht die ferne Zukunft, sondern die Befreiung der Gegenwart – nicht zuletzt auch um der Zukunft Willen – Programm. Installiert wird eine spekulative Poetik als praktisch zu wählender Pfad aus einer gesamtgesellschaftlichen Situation, die eher zurückschwappt zur nicht zu Ende geführten großen Erzählung der Massenvernichtung, als dass sie Perspektiven auf eine geglückte und glücklichere Form des Zusammenlebens eröffnet. Der Ironie der Literaturgeschichte mag es zugesprochen werden, dass in jenen bewegten 60er Jahren den Spielarten von literaturästhetischer Theorie jegliche, stets ambivalente, Weihe des Engagements fast vollends abgesprochen wurde.
Was hat man sich nun aber vorzustellen unter einem langen Gedicht, dieser nahezu messianisch präsentierten und dieser Tage zumindest in der dichterischen Praxis und kritischen Rezeption vollends etablierten Textform? Anders als die unmittelbaren Diskussionen nahelegen, war Höllerers Anliegen nicht begriffsexplikatorisch motiviert. Ihm war sicher nicht primär an gattungstheoretischen Formfragen und eindeutigen Antwortversuchen auf diese gelegen. Ebenso wenig ging es in der Hauptsache um die Konstruktion einer ohnehin unhaltbaren Opposition von langem und kurzem Gedicht. Die Thesen zum langen Gedicht sind Kinder ihrer Zeit und suchen als solche auch in literaturtheoretischer Hinsicht über ihre Zeitgenossenschaft hinauszuweisen – was bereits mit dem Lyrikbuch Transit rund eine Dekade zuvor auf der Agenda Höllerers stand. Es ist der Flirt von Lyrik und Politik4 – eine unheilige Verbindung, die Sartre schon aus technischen Gründen für quasi unmöglich hielt und Adorno für eine Befleckung ersterer halten mochte –, der den Reiz der Überlegungen ausmacht und durchaus eingedenk der unablässigen Fragen warum und wofür so provoziert.
Mit der unterkomplexen Rezeption der Thesen zum langen Gedicht wurde leider eine der letzten Ausfahrten verpasst, Lyriktheorie ausgehend von einer ästhetischen Theorie der Literatur zu denken.5 Es wurde zu wenig über das poetologische Potential der Thesen gestritten, stattdessen zankten sich die Beteiligten um Bagatellen wie das richtige Verhältnis zur lyrischen Tradition und den unmittelbaren Mehrwert von tagespolitischem Agitprop. Der Literatur wurde nichts zugetraut, in die Politik als Streit herrschte kein Vertrauen. Heute liegt dem Bedauern angesichts eines seit Jahrzehnten durch Stagnation bezeichneten Status quo einer Theorie der Lyrik, von der häufig geglaubt wird, sie gehe in ihrer Kritik auf, ohne sich um die Reaktivierung ihrer Parameter, ihrer Möglichkeiten zu bemühen, auffälligerweise nicht mehr die Frage zugrunde, was das eigentlich ist oder vielmehr, was man will, dass es sei – ein Gedicht.
Was also soll es sein, das lange Gedicht? Die Thesen beantworten die Frage nahezu agitatorisch. Das lange Gedicht gilt Höllerer entsprechend der Logik seiner Begründung paradigmatisch als freizügig, was die Weise, die Welt zu betrachten, betrifft. Da es nicht durch den Anspruch eines regelpoetischen Gesetzes fixiert ist, wirkt das lange Gedicht demokratisch, alles soll darin Platz finden (Hoch- wie Unkultur), der Emanzipation soll eine Schaubühne bereitstehen: »Die Republik wird erkennbar, die sich befreit« (These 3). Als Gattung der Moderne ist das lange Gedicht »schon seiner Form nach politisch« (These 2). Die Darstellung einer möglichen Welt (These 5) ist dem Rückzug aus der Realität und der Tendenz zum Verstummen (These 14) vorzuziehen.6 Nichts zuletzt geht es um die Parteinahme für eine freie Gesellschaft, die der in zu vielen Gedichten noch bedachten eitlen und elitären »Preziosität und Chinoiserie« unbedingt und gerade jetzt entgegenzuhalten ist. – Das lange Gedicht hat nach Höllerer vielleicht nur ein Thema: die Gemeinschaft – und damit ein Thema, groß genug, tonnenweise heterogensten Stoff in seiner Zusammensetzung durchzuspielen (These 13). Und es verweist, nicht ausschließlich, aber zwangsläufig, auf einige US-amerikanische Säulenheilige wie Gregory Corso, Allen Ginsberg und vor allem Charles Olson, die es Stand 1965 alle zumindest einmal geschafft hatten, ein Gedicht fertigzustellen, von dem in den Thesen die Rede sein könnte.
Über den Einfluss der US-amerikanischen Lyrik auf die Dichter der jungen Bundesrepublik ist viel geschrieben worden. Die Pionierarbeit der rasch aufeinander folgenden Gallionsfiguren Rainer Maria Gerhardt, Walter Höllerer und Rolf Dieter Brinkmann / Ralf Rainer Rygulla ist größtenteils bekannt. Gefeilscht wird höchstens noch darüber, wen alles man sträflich in dieser Reihe vergisst und wem der Löwenanteil der Vermittlertätigkeit zukommt. Weitaus spannender für die Frage nach dem langen Gedicht ist es, wenn man das Scheinwerferlicht ein Weilchen auf einer Gestalt wie Charles Olson (1910 geboren, gestorben 1970) ruhen lässt: Der Dichter und Zeitschriftenherausgeber Rainer Maria Gerhardt kommt mit Olson unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Kontakt, hat große Pläne, scheitert an seinen noblen wie himmelhohen Ansprüchen, stirbt viel zu jung und schlimm verarmt und provoziert Olson mit The Death of Europe – dem Gedicht, das 1961 Gregory Corsos und Walter Höllerers Junge amerikanische Lyrik eröffnen wird – zu einer Höchstleistung. Es ist zu einfach zu sagen, dass Charles Olson für Rolf Dieter Brinkmann bei der Zusammenstellung der aus dem Schatten von Acid zu hievenden Anthologie Silverscreen. Neue amerikanische Lyrik keine Rolle mehr gespielt habe. Brinkmann schätzte auch Olsons Weggefährten Robert Creeley ungemein, aber das waren eben Dichter, die Höllerer dem westdeutschen Publikum bereits (nach R. M. Gerhardt noch einmal) vorgestellt hatte, von denen Übersetzungen (bei Suhrkamp) vorlagen, die nicht so sehr der Stützräder bedurften wie die Dichter, die noch nach den Beats kamen und denen Brinkmanns Interesse galt.
Höllerer redet nämlich mit Olson, wenn er von der Bedeutung des Atems als pneumatischer Einheit des Gedichts spricht (These 6). In der Theorie der modernen Lyrik verkörpert Olson die Möglichkeit einer Poetologie, die bereit ist, dass Erbe der klassischen Moderne anzutreten (Olson, dessen frühe Gedichte zeitlich einsetzen, wo Enzensbergers Museum der modernen Poesie einen wohlverdienten Schlussstrich ziehen muss). Der US-Amerikaner Olson ist für Höllerer vielleicht aber auch, da mag der aufmerksame Kritiker Karl Krolow – auch er ein Hansdampf auf den Pfaden und in den Sackgassen der Lyrik des 20. Jahrhunderts – das Begehren Höllerers richtig lesen, Gewährsmann für die Erfüllung des für das Gedicht perversen Wunsches nach Syntax. Diese Anmerkung ist gut gezielt, tatsächlich ist das Verhältnis von Vers und Syntax durch Walt Whitman et al. sicher gleichermaßen verunsichert und erweitert worden wie durch das poème en prose. Viel mehr ist Olson allerdings ein amerikanischer Dichter, also ein Landsmann Whitmans, Ezra Pounds und William Carlos Williams‹, mit denen das lange Gedicht für Höllerer historisch einsetzt. Mehr noch: Höllerer identifiziert das lange Gedicht als genuin (US-)amerikanische Gattung,7 er konstituiert eine Genealogie der gelungenen Werke, die eng verwoben mit der Geschichte der US-amerikanischen Nation sein soll. Die erste moderne Demokratie und der letzte erste Mensch bilden gemeinsam das geschichtliche Fundament für die gesellschaftliche Bedeutung des Gedichts – was bei Whitman gelingt, was bei Pound in Anbetracht des Ethos der Gemeinschaft schiefgeht und die Regel in gewisser Weise bestätigt.
Dass die ästhetische Diskussion mit der allgemeinen Akzeptanz dieser Prämisse unmittelbar an ihr Ende gelangt war, äußert sich in den weiteren Beiträgen vor allem kulturtheoretisch, es werden die sensibelsten Demarkationslinien gezogen. Die affirmativen Leser der Hugo Friederich’schen Struktur der modernen Lyrik bevorzugen die Franzosen und deren dunkle Enigmatik in epigrammatischer Kürze. Das linkste Spektrum der Debattanten wird sich hingegen schwerlich auf Pound und seine Adepten als federführende Poetologen eingelassen haben. Vor allem aber stört das, was jetzt – sprich Mitte der 60er – aus den Staaten kommt: nämlich Pop oder was immer das sein mag, auf den ersten Blick aber immerhin unpolitisch wie nichts Zweites. Das generelle Unbehagen äußert sich schließlich sinnbildlich in einem Kommentar des Ginsberg-Übersetzers Heiner Bastian im Zuge einer Diskussionsrunde, die 1969 im LCB an einen Vortrag Lars Gustafssons zu den Problemen des langen Gedichts anschloss: »Wer hier immer noch vom ›langen Gedicht‹ spricht, der sollte dies mit sich selbst tun. Ist es nicht so, daß jeder Beteiligte diesen Begriff zu seiner persönlichen Interpretation gemacht hat? Daß er nichts taugt, wissen wir doch spätestens seit den kuriosen Gedanken, die Herr Horst Bienek 1966 in der Zeitschrift Akzente zu diesem Thema dachte. Obwohl kein Mensch weiß, was das eigentlich ist, das lange Gedicht – ich erinnere, daß es etwa 500 Synonyme gibt: freilich eines haarsträubender als das andere –, wird auch hier dauernd davon gesprochen. Aber wenn man Ihnen zuhört, dann kann man bestenfalls eine riesige Angst davor bekommen.«8
Man hat also seine liebe Müh, das lange Gedicht hierzulande zu lieben, angesichts der immensen Ablehnung von allem, was die Diskussion ausmacht und was diesen Texttyp historisch hervorgebracht hat. Seit ungefähr 1968 vertilgt zudem die Tagespolitik die Politik des Gedichts. Gestritten wird nunmehr darüber, was mit den Schlagworten Neue Sensibilität bzw. Neue Subjektivität gemeint ist, wer sich durch die Einordnung unter jene deckelnden Begriffe beleidigt fühlt usw. Das lange Gedicht wird hier synekdochisch zum Erzfeind: in die Literatur werde nur noch subjektivistischer Müll und private Befindlichkeit gepumpt – und worin lässt sich mehr dieser vom Wesentlichen ablenkenden Störfaktoren hineinstopfen als in ein Gedicht, anerkannter Urquell der Subjektivität, und sodann noch in ein langes, dass aufgrund seines in der Bezeichnung angekündigten Umfangs die Möglichkeiten zur Larmoyanz ins Unendliche und Unerträgliche erweitert. Nicht nur Brinkmanns Gedichte werden zunächst rasch dieser Haltung geopfert. An ihnen zeigt sich außerdem noch ein weiteres Problem: Wie anthologisiert man diese Texte, deren Formatierung – wie im Falle Brinkmanns – bereits das Taschenbuch an seine setzerischen Grenzen treibt? Weitere, beachtenswerte Texte wie Helmut Salzingers Das lange Gedicht gehen bei der Erstveröffentlichung in der Anthologie Supergarde unter, zur Zeit des selbstständigen Nachdrucks 1982 schert sich bereits niemand mehr drum. Das führt zu dem Eindruck, dass eine Theorie des langen Gedichts sich scheinbar nicht praktisch umsetzen lässt. Die langen Gedichte hingegen, traut man den Zuschreibungen der Literaturgeschichte und den Behauptungen des Literaturbetriebs, gibt es; das Gespräch über sie als Gedicht jedoch fand und findet nicht statt.
Mit diesem Schweigen einhergehend sind allerdings auch jene Hoffnungen passé, die gesellschaftspolitisch einmal – als die Verbrauchtheit aller anderen lyrischen Artikulationsformen als zu drückend empfunden wurde – an das lange Gedicht adressiert wurden. Daher spricht heute in Schulen und Universitäten niemand über Langgedichte, wenn einmal Lyrik und Politik in abgesicherter Simulation aufeinanderprallen sollen: der Faust und die vermeintliche Absage an das »garstig Lied« werden zitiert, das war’s dann häufig. Ferner vernachlässigen die Literaturwissenschaften hüben wie drüben die Beschäftigung mit Text und Kontext. Bislang ging es nicht weiter, als dass im Langgedicht das ambitionierte Projekt des Epos wiederentdeckt wurde. Wenn allerdings das Epos traditionell den Kulturkreis in Abgrenzung und Öffnung vor dem Beginn eines empfundenen Zeitalters stiftet, ist der Anspruch ein anderer als der, den Ort des Gedichts aus der Zeit heraus zu stiften und Gemeinschaft und Gedicht in jahrzehntelangem Schreibprozess und als Reaktion auf die sich parallel fortwälzenden Geschichten zu verhandeln, wie er sich in den Langgedichten von Pound, Williams, Olson und Paulus Böhmer zeigt. Abgesehen von solcher Differenzierung, die einmal näher zu betrachten wäre, scheint es – pardon – schwachsinnig, jeweils zu entscheiden, ab wann ein Gedicht ein langes ist. Ab zwei, ab zweieinhalb oder doch drei Seiten? Ab den 430 Versen des Waste Land oder den paar hundert Seiten der Cantos? Wie soll etwas außer unproduktiver Haarspalterei dabei herauskommen, wird zudem noch eine trennscharfe Unterscheidung zwischen so etwas wie einem epischen Langgedicht und einem zyklisch organisierten Texttyp eingefordert? Mit solcher Hütchenspielerei ist nichts zu gewinnen, Gattungstheorie at it’s worst hieße der Preis.
Auf eine lexikale Definition wird man sich nicht einigen können, sie wird vorbehaltlos nicht greifen. Und trotzdem wird das Kind oft und gern beim Namen genannt: In den letzten 15 Jahren etwa haben sich u.a. Paulus Böhmers sämtliche Bände, Gerhard Falkners Gegensprechstadt – ground zero, Ulf Stolterfohts holzrauch über heslach und Neu Jerusalem, Kerstin Preiwuß’ Rede sowie die weiteren Übersetzungen von William Wordsworth, Inger Christensen, Ezra Pound, T. S. Eliot, Wladimir Majakowski, John Ashbery, Jeffrey Yang, Yang Lian usw. alle das von Literaturwissenschaft und Presselandschaft zugesprochene Dekorum Langgedicht verdient. Und es sollte keine Schwierigkeit darstellen, noch Hölderlin den Stempel aufzudrücken, die handlungsärmeren Balladen Droste-Hülshoffs entsprechend zu etikettieren. In nahezu jeder zweiten Publikation aus dem Bereich der Gegenwartslyrik dürfte man einen Text antreffen, den man problemlos ein Langgedicht nennen könnte. Zusätzlich zeigt sich aktuell mit Ann Cottens Verbannt! die Selbstzuschreibung Epos – zuletzt so prominent vielleicht in Bezug auf Enzensbergers Der Untergang der Titanic reaktiviert – keinesfalls als tot. Die Konfusion, so viel ist klar zu sehen, wuchert nach wie vor erfrischend. Was haben aber alle diese Texte gemein? Im besten Fall nichts, außer dem Verdacht, es handle sich um Gedichte. Was war noch einmal ein Gedicht?
Ich denke, dass es genau darum geht. Selten erkundigt sich schließlich jemand, was ein kurzes Gedicht ist. Verse sind ja doch in jedem Maß Herdentiere; ob ein einzelner ad hoc und ausnahmslos für ein Gedicht gehalten werden würde, ist letztlich dieselbe Frage wie jene nach dem langen Gedicht: Was ist man bereit, ein Gedicht zu nennen? Und das, finalement, ist aus mehreren Gründen nicht unwichtig, da dieser Tage mal wieder das Revival der Lyrik – wie alleine seit den 60ern und Höllerers Thesen schon zigmal – beschworen wird. Es ist interessant, die Frage nach dem Wesen des Gedichts zu stellen, da die rhetorische Frage nach dem Mehrwert und der Funktion der Lyrik, dem zarten Pflänzchen oder der Königsgattung, je nachdem, woher man kommt, eben überhaupt nicht interessant ist, wenn sie derart gestellt wird. So wie nicht zählt, wer man ist, sondern was man tut, lautet die Frage, auf deren Antworten man gespannt sein dürfte: Was kann das Gedicht sein, was alles wäre von ihm zu glauben, zu wissen und worauf wäre mit ihm zu hoffen? Leider führt bisweilen die in den Raum gestellte Frage danach, was ein Gedicht sein kann, standesgemäß zur mehr oder minder strikten Segregation dreier Positionen:
1. ›Was ein Gedicht ist, lässt sich nicht (abschließend) beantworten.‹
2. ›Was ein Gedicht ist, will ich nicht beantworten.‹
3. ›Was ein Gedicht ist, kann ich nicht beantworten.‹
Ergänzt werden können die orthodoxen Hardliner:
4. ›Was ein Gedicht ist, darf man nicht beantworten.‹
Frage 1 gilt es dankend aufzunehmen und ihren Vorbehalt als Tugend zu verstehen. Um abschließend mit der Provokation des Schlussakkords von Höllerers letzter These zu sprechen: eine Theorie des Langgedichts als Vorbereitung für eine spekulative Theorie der Lyrik.
1Vgl. Böttiger, Elefantenrunden. Walter Höllerer und die Erfindung des Literaturbetriebs, Berlin 2005, S. 7 u. ausführlicher 165: »Was Höllerer anfaßt, gelingt ihm. Sogar noch die Bonmots, die andere über ihn machen, gelingen ihm. Am Mittwochabend, dem ersten Neujahrstermin der Fernsehlesereihe ›Ein Gedicht und sein Autor‹, kursierte der Satz, den Arnfrid Astel in einer Diskussion gesagt haben soll: ›Zur Hölle mit den kurzen Gedichten, zu Höllerer mit den langen.‹«
2Ebd.
3Finden kann man die Thesen zum langen Gedicht in Akzente (1965, Bd. 2), S. 128-130, wiederabgedruckt in Hans Bender / Michael Krüger (Hg.), Was alles hat Platz in einem Gedicht. Aufsätze zur deutschen Lyrik nach 1965, München 1977, S. 7-9. Enthalten sind auf den folgenden Seiten auch einige Beiträge der anschließenden Diskussion u.a. von Karl Krolow, nochmals Höllerer, Horst Bienek und Günter Herburger.
4Grundlegend für das hier angerissene Verständnis von Ästhetik, Literatur und Politik und ihrem jeweiligen Verhältnis zueinander sind die Arbeiten Jacques Rancières.
5Hieran ist Höllerer höchstselbst mit seinen später erfolgten Reflexionen und Kommentaren bei Symposien im Übrigen nicht ganz unschuldig.
6Höllerers Freundschaften, Korrespondenzen und sein sich stets im Wandel befindliches Interesse an den verschiedensten Spielarten lyrischer Gedichte ist tatsächlich der wohl schönste Beleg, dass es nicht gilt, sich aus Angst um seine Kredibilität als Sachverständiger für eine Strömung oder Tendenz von Lyrik entscheiden zu müssen. Keineswegs ist hier also gedacht an eine grundsätzliche Opposition zu dem, was landläufig unter der catch-phrase Hermetik gehandelt wird. Jede Poetologie ist in der Lage, ihren Prinzipien gemäß gelungene oder weniger gelungene Texte zu produzieren.
7Einen ingeniösen gattungstheoretischen Erklärungsansatz des Langgedichts können auch die englischsprachigen Literaturwissenschaften bisher – aus gutem Grund, betrachtet man den heterogenen Textkorpus – nicht aufbieten. Diskutiert wird zumeist das long poem als nachromantische Fortführung des Epos, das Verhältnis von Gedicht und Geschichte, selten die Länge, Fragestellung zur Lyriktheorie werden nicht verhandelt.
8In Sprache im technischen Zeitalter 31 (1969), S. 251.