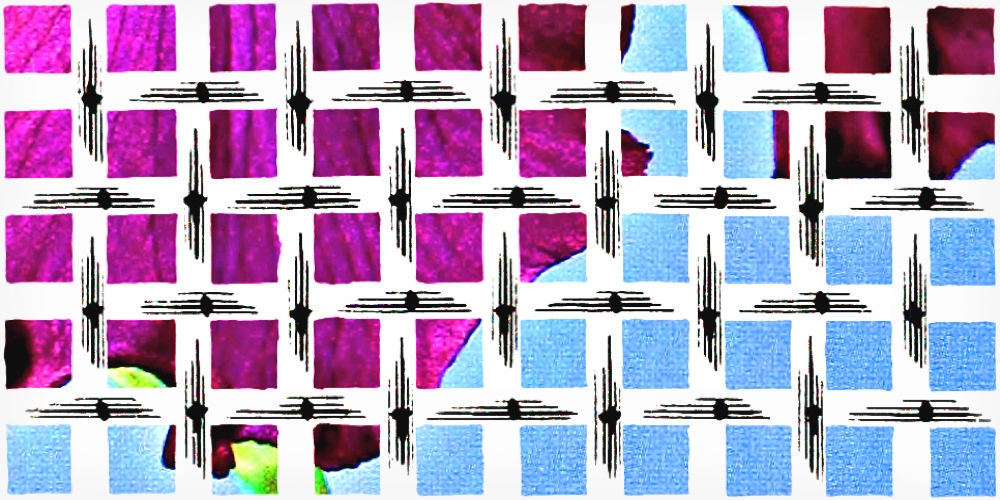Anfang Juni stand ich vor dem Torbogen des Schlossparks. Die hohen Flügeltüren aus schweren Holzbalken waren geschlossen. Links und rechts ein Maschendrahtzaun, wo früher die Mauer verlaufen war. Wie in den frühen 1920er Jahren, als es hier zu Szenen kam, die den Showdown meines neuen Romans bilden. Seine Heldin, Elisabeth Petznek, war zwischen 1910 und 1930 hier Schlossherrin gewesen, wie auf der chromblitzenden Tafel an der Tormauer in avancierter Kleinschrift vermerkt ist. 1883 war sie als Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich auf die Welt gekommen. Die einzige Tochter Kronprinz Rudolfs und Enkelin Franz Josephs, deren Geburt noch mit allem Pomp und Prunk der Habsburgermonarchie gefeiert wurde, bis der Erste Weltkrieg und ihr Leben als Frau sie zur Sozialistin machten.
Das Tor war fest verschlossen. Ich lehnte mein Rennrad an das Gemäuer. Seitlich der Einfahrt stand ein schmaler, bis in Kopfhöhe ragender Kasten. Ebenfalls verchromt. Neben- und untereinander, erst auf den zweiten Blick erkennbar, die Briefschlitze offenbar allesamt hinter dem Schlosstor versammelter Adressaten: Schloss Schönau Management KG, Schloss Schönau Finanz GmbH, Hotel Schloss Schönau sowie eine Segovia Privatstiftung. Jede der Beschriftungen klar und unauffällig ins Chrom gestanzt. Daneben ein Nummernfeld zur Code-Eingabe und zwei silberne Tasten zum Anläuten, Firma Hotel und Privat. Über all dem thronend, eine große, dunkle Wölbung aus Glas, aus der mich, wie aus einem wimpernlosen Auge, das schwarze Rund einer Kamera anblickte.
Anstatt anzuläuten, fotografierte ich: Den hohen Chromsockel, die Briefschlitze, das Auge, das Tor und die kulturkundliche Tafel. Kurz überlegte ich, meinen Besuch damit zu beschließen, läutete dann aber bei Firma Hotel an. Augenblicke später, ohne dass ich danach gefragt hätte, schallte mir aus dem Chromgehäuse entgegen, dass nichts frei sei. Es war halb zehn, morgens, ich hatte noch nicht einmal eine Stunde auf dem Rad hinter mir und dennoch das Gefühl, mich für die Tatsache rechtfertigen zu müssen, nach etwas anderem als einer Übernachtungsmöglichkeit zu fragen. Aus den Lautsprecherschlitzen der Gegensprechanlage rauschte es, bevor ich umständlich antwortete, einen Roman über die ehemalige Schönauer Schlossherrin geschrieben zu haben und deshalb einen kurzen Blick auf Schloss und Park werfen zu wollen. Erneut leises Rauschen. Dazu vermutlich ein genauer Blick aus dem Kameraauge auf mich in meiner Radmontur. Einige Momente später, zu meiner Überraschung, nicht nur ein weitaus freundlicherer Ton, sondern auch die Feststellung, zu wissen, wer ich sei, da man mich hier bereits einmal gesehen habe! Ob mit diesem Hier der Platz vor dem Kameraauge oder das Schloss selbst gemeint war, ließ sich nicht einschätzen, da die unsichtbare Sprecherin meine Antwort gar nicht erst abwartete, sondern den Mechanismus des Toröffnens in Gang setzte. Sie in ihrem Glauben zu belassen, fiel mir leicht, konnte ich doch kaum etwas dagegen einwenden. Nicht nur einmal war ich hier gewesen, nicht nur hinter diesen Mauern und im Inneren des Schlosses, ich hatte mich sogar bis ins Innere seiner früheren Besitzerin vorgewagt. Mit meinem Bleistift, mit meinen Fingern auf der Notebook-Tastatur und den Bildern ihres Lebens in meinem Kopf. Seitenblicke auf die entsprechenden Kartenausschnitte oder Satellitenbilder auf Google Maps waren dafür selten nötig gewesen. Kaum öfter das Studieren alter Aufnahmen oder Beschreibungen. Ganz zu schweigen von der Suche nach letzten Zeitzeugen.
Unter ähnlichen Vorgaben hatte ich bereits vor 15 Jahren an meinem Roman Der Räuber gearbeitet. Auch ihn hatte es, wie es so schön heißt, in Wirklichkeit gegeben. Damals galt es, die zu Fuß absolvierte Fluchtstrecke eines Mannes zu erzählen, der in den 80er-Jahren mit einer Ronald-Reagan-Maske Banken überfallen und mit seiner Pumpgun einen Menschen erschossen hatte, gleichzeitig aber einer der besten Langstreckenläufer des Landes gewesen war. Ich hatte mich sehr kurzfristig zum Schreiben des Romans entschieden, die Geschichte seines Stoffs war in Grundzügen recherchiert, doch als ich mir vornahm, im Zuge eines einmonatigen Italienstipendiums den Roman nicht nur zu beginnen, sondern bereits weite Strecken davon zu schreiben, waren vor der Abreise nur mehr zwei Wochen übrig, in denen auch eine Wohnung gestrichen und der Umzug über die Bühne gebracht werden musste. Die Landschaft der Räuberflucht kannte ich deshalb vor der Italien-Abfahrt bestenfalls kursorisch, nahm anstatt genauer Recherchen lediglich die Wanderkarte Wienerwald-Süd an den Schreibtisch in Paliano mit und las im Schreiben alles davon ab: Bildstöcke, Rastbänke, Hügelformen, Wald- und Wiesenverläufe, Gipfelkreuze, Wegverzweigungen, Siedlungen, Straßen sowie mögliche Schallverläufe von Lärm und Geräuschen. Ganz genau hatte ich es im Schreiben vor mir, war mir nur an einer einzigen Stelle unsicher, dem Versteck des Räubers, das ihn vor der Entdeckung rettete, als er umzingelt war. Dazu fand ich in der Landkarte keine Hinweise, ebenso wenig in alten Zeitungsartikeln zu seiner Flucht. Ich wusste lediglich, dass die Wälder westlich von Mödling am Ende des Zweiten Weltkriegs ebenso zur Front wurden, wie auch die Hügelketten des Traisentals – die Wälder meiner Kindheit. Dort hatten wir uns in den Laubansammlungen von Schützengräben und Gefechtsstellungen trotz der Warnungen der Eltern beim Versteckenspielen verborgen.
Dass eine solche Idee ein Lektorat überlebte, oder gar kritische Buchlektüren, wagte ich kaum zu hoffen. Doch eine bessere Idee hatte ich nicht. Wenige Wochen nach dem Bucherscheinen dann ein Treffen mit einer Kritikerin, die im Gespräch schnell auf diese Stelle zu sprechen kam und mir erzählte, in genau solchen Gruben habe sie sich in ihrer Mödlinger Kindheit im Wienerwald stets versteckt. Die genaue Beschreibung solcher an der Fluchtroute des Räubers gelegenen Stellen habe sie erstaunt. Nur wenig später die beinahe identische Reaktion Kurt Neumanns, dem Leiter des Literarischen Quartiers Wien: Er fand im Roman einen Waldrand wieder, der ihm schon seit Jahren als Geheimplatz zum Pilzesammeln diente. Auch er staunte, doch mindestens ebenso tat es ich, wusste ich doch genau, an der Stelle noch nie gewesen zu sein. In den folgenden Wochen und Monaten kam es öfters zu solchen Rückmeldungen. Fast immer betrafen sie die Leerstellen dessen, was ich an faktischer Recherche über die Taten dieses Mannes und seiner letzten langen Flucht zusammengetragen hatte. Unweigerlich angesichts dessen die Anflüge eines Glaubens, Erfindung und Vermutung des Erzählens rückten der Wirklichkeit näher als das Faktische selbst. So verlockend aber eine solche Annahme ist, sie führt in die verkehrte Richtung. Entscheidend ist nicht, wie sehr ein Wald dieser oder jener Wald ist, eine Grube voller Herbstlaub diese oder jene Herbstlaubgrube, oder ein Schloss in seiner Architektur, seinem Prunk und seinen Ausblicken genau dieses eine Schloss – würde doch darin alles wieder nur so eng und unvorstellbar, wie all die Einzelheiten, die mir bei meinem Gang rund um Schloss Schönau in die Augen stachen. Kein Bild mehr, keine Ahnung, stattdessen mathematisches Abgleichen und der gefährliche Sog jenes Starrens nach Richtig oder Falsch, in dem sogar die Augen ihren wichtigsten Impuls verlieren. Den unmerklichen Lidschlag, das kurze Schwarz in allem Erleben, das wir ständig und mit gutem Grund übersehen. So als wäre es nichts, während es alles ist. Wie jene Lücken, die das Schreiben nie füllt, erst das Lesen. In jedem Kopf anders, in jedem wie neu, als Lücken voller Wahrheit.