Das Ende einer lang gezogenen Kurve. Eine Gedenkstätte am Straßenrand. Bis heute wirkt sie improvisiert, obwohl der kitschige Bildstock, die metallene Justitia mit Schwert und Waage, die zur Begrenzung aufgestellten Kerzen und die Farbkopien mit Verschwörungstheorien keinerlei Zufälligkeit bergen. Vor über neun Jahren war ein schwarzer Wagen aus dieser Kurve geflogen, vorbei an den Einfamilienhäusern, den kleinen Gärten, und mit dem Betonsockel eines Gartenzauns kollidiert. Es hätte auch ein Schlafzimmer sein können oder ein Kinderzimmer. Doch Zufall oder Glück, im richtigen Moment war ein niedriges Mäuerchen im Weg, das den Wagen zum Stillstand brachte. Die Kerzen erzählen von diesem Glück bis heute nichts, leuchten nicht für die verschonten Anwohnerinnen und Anwohner, sondern brennen immer noch für den stockbetrunkenen Kamikaze. An den Hausmauern schob sich erstes Abenddunkel hoch, als ich jene Stelle erreichte. Zugezogene Vorhänge, die Schemen von Zimmerlichtern und Bildschirmflimmern.

Immer wieder blendeten die aus der Kurve kommenden Autos auf. Mein Kleinbus stand im Halteverbot. Das wusste ich, kannte die beflissene Ader österreichischer Landbevölkerung, fühlte mich aber bei ganz anderem ertappt. Als durchschauten die Augen hinter den Aufblendlichtern nur zu gut, dass zu dem VW-Bus mit dem Wiener Kennzeichen kein Trauernder gehört, der sich die Ehre des hier Verstorbenen mit Verschwörungstheorien zurechtbiegt. Metergenau betätigten sie ihre Fernlichter an der Stelle, an der skrupelloses Tempo jenen Mann hatte abheben lassen, in dessen Gesicht stets das frivole Grinsen vorsätzlich kalkulierter Ertapptheit aufgeblitzt war. Jedem Angriff war er damit begegnet. Selbst der eigene Tod verlor sich darin zwischen Kitsch und Karikatur. Als Draufgabe noch der Satz seines Nachfolgers als Landeshauptmann: Mit seinem Tod sei die Sonne vom Himmel gefallen. Nun gleißende Scheinwerfer-Augen, die immer wieder aufs Neue meinen Schatten über jene Stätte huschen ließen, die ich in meiner Vorstellung so oft schon aufgeräumt hatte, all die Kerzen und Blumen, die Rosenkranz-Kettchen und Billetts, die Statue, den Bildstock und den Schaukasten mit seinen billigen Kopien.

Über den Karawanken stauten sich dunkle Wolken. Ich fuhr weiter, überquerte im letzten Licht des Tages einen breit aufgestauten Fluss, bog in das weite Tal Richtung Westen, um noch ein Stück länger der untergehenden Sonne zu folgen. Im Fluss dunkle Eisschollen, am Himmel die Wolkenschuppen des Föns. Ich horchte auf, als in den Radio-Nachrichten Schnee angekündigt wurde. Eingeschneit in meinem Bus aufzuwachen, der mir in den nächsten beiden Wochen Gefährt wie auch Unterkunft sein sollte, gab der Fahrt ins nunmehr Finstere ein Ziel.
*
Eine dünne Schneehaut an der windabgewandten Seite meines Wagens. Innen die bunten afrikanischen Tücher, die meinen Übernachtungsplatz in dem von Sitzbänken befreiten VW-Bus verbargen. Ein anderer Sichtschutz war zwei Tage nach Weihnachten nicht aufzutreiben gewesen. Ob ich auf solche Weise meine Vorstellung realisieren könnte, inmitten von Dörfern in aller Seelenruhe zu übernachten, etwa direkt gegenüber dem Bäcker, dem Tourismusamt oder dem Wirtshaus, war mit meinem Erwachen auf einem Parkplatz, an dem vermutlich nur deshalb kein Camping-Verbotsschild prangte, da bereits die Zufahrt verboten gewesen war, nicht beantwortet.

Es herrschte Stille, dann wieder das Auftosen des Südwindes, der die ganze Nacht am Wagen gerüttelt hatte. Kurz vor acht Uhr die ersten Schneemobile. Ich blinzelte hinaus, entdeckte einen Spaziergänger mit Hund am Seeufer, kurz darauf passierte ein verschlafener Liftwart meinen Wagen, auch er scheinbar unbeeindruckt von den bunten Stoffen, dem weißen Wagen. Es war dennoch Zeit, in Richtung der regulären Parkplätze an der Passstraße zu verschwinden. Kaum hatte ich umgeparkt, tauchten die ersten Autos auf. Langsam wurde der Schneefall dichter, ein Skilehrer lief in schwerer Montur Richtung Arbeit. Auf meinem Gaskocher kochte Teewasser, der Motor lief, langsam wurde mir warm. Vor ein paar Jahren hatte ich das seltene Glück von Spiegeleis hier erlebt. Eis, so durchsichtig, dass jeder Schritt im Schwarz des Wintersees auftrat. Einzig an den Spannungsrissen waren Dicke und Festigkeit erkennbar gewesen. Ein solches Spiegeleis habe es noch nie gegeben, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der Passhöhe gesagt. Noch nie, hieß hier oben: nicht seit hundert Jahren. Bis Anfang des letzten Jahrhunderts wäre keiner auf die Idee gekommen, auf einem solch windigen Pass sesshaft zu werden. So schön der See auch ist, so unergründlich die von nichts als der Zeit geschliffenen Bergkuppen.

Heute lebt man davon. Am besten in Wintern, in denen Adria-Tief um Adria-Tief Schneefall bringt. Einen solchen Winter wie aus dem Bilderbuch hatte ich eben auch vor ein paar Jahren hier verbracht. Woche für Woche war die Schneedecke gewachsen, als Polster auf den Dächern, als Wände, die Wege und Straßen zu Kanälen machten. Die Hütten und Häuser, die zu beiden Seiten des Sees Wiesen, Hänge und lichte Wälder in Siedlungen verwandelt hatten, wurden im Weiß beinahe wieder unsichtbar. Hieß es an einer Stelle Almhüttendorf, nannte es sich an der anderen Chalet-Siedlung, wurde die eine in ihrer Ursprünglichkeit beworben, rühmte sich die andere mit der Exklusivität kanadischer Rundhölzer. Ein Großteil war nicht nur zu mieten, sondern arbeitete an der Rückseite der tatsächlichen Nutzung auch als Anlageobjekt oder Aktienpaket vor sich hin. Nicht unsichtbar, doch weniger erstickend wurde sogar der seit Jahrzehnten die Uferanhöhe des Sees überwuchernde Hotelkomplex. Zwischen China-Turm, türkischem Hamam und beheiztem See-Abschnitt nannte man darin alles Landschaft. Nutzte man all die Wellness-Ländereien einigermaßen aus, konnte man dort eine Woche oder länger verbringen, ohne einen Schritt ins kalte, windige Draußen zu setzen.
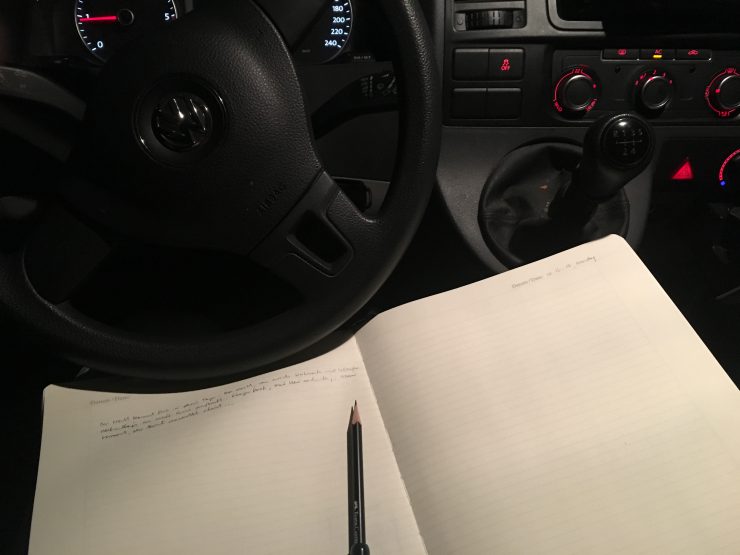
Ich nippte am heißen Tee, sah zu, wie ringsum Autotüren aufgingen, Skischuhe zugeschnallt, Helme aufgesetzt wurden. Für Augenblicke das Bild, als handelte es sich um Mondpioniere, die mit geschulterten Skiern und jenem schlingernden Schritt, wie ihn allein Skischuhe erzeugen, die Lifte ansteuerten. Ich fragte mich, ob auch die Herausgeberfamilie der meistgelesenen Zeitung des Landes dieses Jahr schon hier angekommen war. Erholung brauchte sie gewiss. Tag für Tag arbeitet sie mit ihrem Blatt daran, jenem Bevölkerungsteil, der zwangsläufiger Verlierer einer Politik der Märkte und des Kapitals ist, jedweden Impuls zur politischen Äußerung zu nehmen, indem sie Wut, Verzweiflung und Scham über die missliche Lage in die breiten Bahnen der Aggressionsabwälzung lenkt. Gezielt wird gegen Flüchtlinge und Asylanten getrommelt oder ein Mechanismus bedient, der hierzulande auf Jahr und Tag mit schlafwandlerischer Selbstverständlichkeit funktioniert: Wenn es Sündenböcke braucht, genügen Codewörter, den Rest besorgen die entsprechenden Instinkte. Dabei von den Juden nach Möglichkeit nicht zu reden, in den entscheidenden Augenblicken dennoch nichts anderes zu meinen als das, womit Väter wie Großväter sich die Welt bereits erklärt hatten, ist wirklich keine leichte Arbeit. Nur zu verständlich, dass das Herausgeber-Ehepaar jedes Jahr aufs Neue mit Kind und Kegel ihrem schwarzen Familien-Großraumwagen entsteigt und zum Durchatmen im Hotel verschwindet. Müßig hingegen die Rechnung, dass ihre Kosten bereits nach einer Urlaubswoche weit über dem Jahreseinkommen jener Haushalte liegen dürften, deren hauptsächliche Informationsquelle sie täglich produzieren. Müßig wie auch jeder weitere Satz über die finanzielle Rendite dieses Tagewerks. Da selbst die Unsummen derart schamloser Gewinne zu billigen Ziffern werden, sobald einem vor Augen tritt, welche Ungestalt in diesem Land sich selbst im schönsten Schnee immer weniger versteckt.























