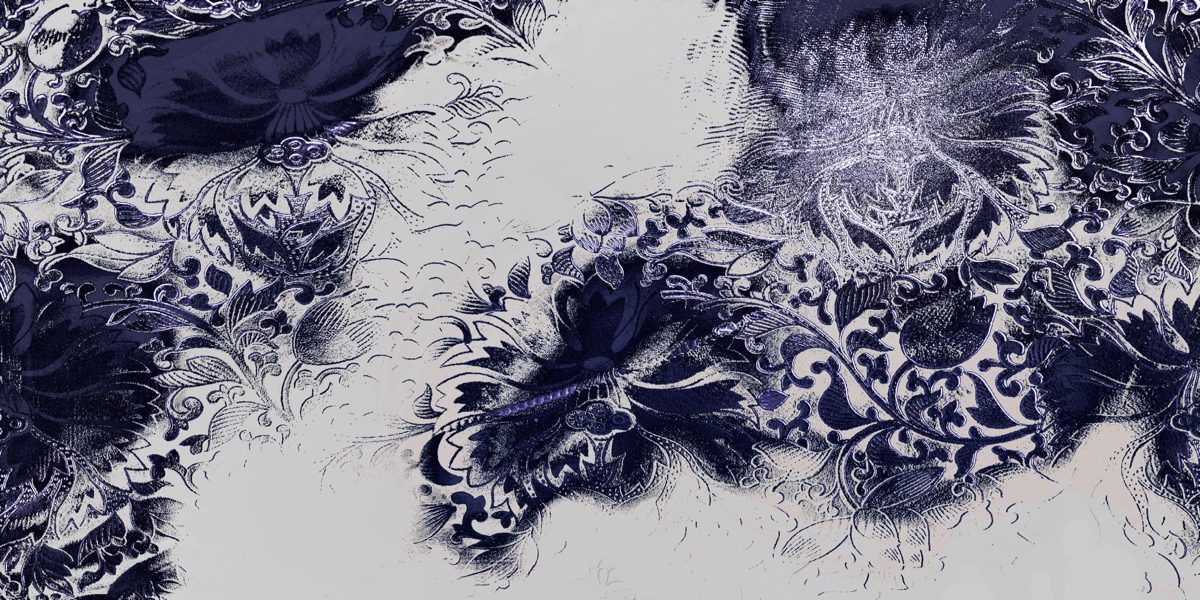Als meine Eltern bei ihren regierungskritischen Aktionen im Westdeutschland der 80er-Jahre beschimpft wurden, sie sollten doch nach drüben gehen, dachte ich als Kind, drüben sei Rumänien. Dass man zur Strafe in Richtung Osten geschickt werden sollte, war klar, Naher und Ferner Osten waren außerhalb meiner Vorstellung. Ich dachte, sie sollten ans Ende Europas gehen, möglichst weit in den Ostblock, Rumänien sei die Höchststrafe: bitterarm und bitterkalt, gefährlich und irgendwie vergiftet. Wahrscheinlich setzte sich meine Vorstellung zusammen aus Transsilvanien, der Securitate, Dracula, Peter Maffay, einem Umweltskandal und der Walachei. Dass mein kindlicher Eindruck weiter Bestand hat, merkte ich erst, als ich neulich einen Anruf aus Bukarest erhielt, dass sie dort meine Komödie Mein Herz ist rein spielen wollten. Ich musste lachen.
Weil meine Eltern damals die Anfeindungen unkommentiert ließen und also die Möglichkeit nicht auszuschließen war, dass wir umziehen werden mussten, las ich Literatur zum Thema aus der heimatlichen Stadtbibliothek. Nicolae Ceausescu (Titel und Diakritika entfernt) erscheint auf Bildern dieser Zeit wie eine Mischung aus Chico von den Marx Brothers und Monsieur Verdoux, dem rosenzüchtenden Witwenmörder von Charlie Chaplin. Er hat die Lippen eines Clowns und lächelt oft, neben Honecker wirkt er wie ein Lebemann. (Welches Diktatorengesicht scheint im Rückblick nicht lächerlich? Welche Statur trägt die Figur eines Autokraten?) Ceausescu hat nur vier Jahre die Schule besucht, mit elf zieht er allein vom Dorf nach Bukarest und lernt Schuhmacher. Die kommunistische Partei in Rumänien war mitgliederschwach, der Aufstieg leicht für die Getreuen. Als sie dann an der Macht waren, gab es entsprechend viele potenzielle Feinde. Die Brutalität der Regierung wird auch mit ihrem Verfolgungswahn erklärt. In den 24 Jahren seiner Präsidentschaft soll Ceausescu nur einen einzigen Witz erzählt haben. Vielleicht ist sein Lächeln verächtlich gemeint oder es ist kein Lächeln, sondern ein Defekt.
Inzwischen ist mein Bild des Landes überlagert von Trinker-, Irren- und Kinderheimen, in denen eiskaltes Wasser die einzige Behandlungsmethode ist. Und davor schleichen Schieberbanden, Straßenkinder, Hundefänger und Roma durch das Immergrau. Alles in körnigen Aufnahmen einer VHS-Kamera aus den späten 80er-Jahren. (Rasch noch eine rumänische Novelle schreiben, bevor ich von der Wirklichkeit dort belehrt werde.) Und vom Ehepaar Ceausescu bleiben die Bilder ihres Endes, wie sie an dürren Tischen vor den schäbigen Wänden einer Kaserne sitzen, und sich widersetzen nach dem Urteil den Fesseln aus Seil (»Ich bin auch Eure Mutter«, fleht die Mutter der Nation die Soldaten an, »Tod den Verrätern«, ruft ihr Mann zuletzt). Wie billig und nüchtern die Schüsse klingen im Verhältnis zu Dolby Digital. Und wie das Blut aus dem Kopf der Frau hinabläuft und jemand ins Bild kommt, nur um ihren Tod zu ertasten. Ohne Musik. Kein Nachruf. Nach 24 Herrschaftsjahren. Nie wieder habe ich Bilder gesehen, die so schlicht vom Ende einer Epoche erzählen und deshalb unheimlich wirken, als wären sie jederzeit wiederholbar. Die sich der Dramaturgie widersetzen, dass nach dem Tod ein Kommentar zu folgen hat oder ein Neuanfang. Bilder von unbeholfenen Aufständischen (einer säubert sich während der Verhandlung die Fingernägel), von kindischen Herrschern und deren leblosen Körpern, verrenkt kurze Zeit später. »Wir wollen Freiheit für die Jugend. Und Zukunft«, klagt bitter und giftig eine verwundete Frau in Videogramme einer Revolution, dass auch diese Zukunft nicht unbelastet werde sein können. Securitate in Konstanza.
Wenn ich meine Vorstellung ernst nähme, führe ich nicht nach Rumänien. Ich sage sofort zu, als die Dramaturgin mich zur Premiere am Teatrul de Comedie einlädt.
*
Am Abend vor der Abreise habe ich noch ein Protokoll der Verurteilung der Ceausescus gelesen. Ich träume also schlecht (»Ich akzeptiere dieses Gericht nicht«, wiederholte der Angeklagte) und mache mich um 4 Uhr 47 müde auf den Weg nach Schönefeld. Im Zug spricht ein Mann, der sich im Verlauf des Gesprächs als argentinischer Musiker herausstellt, mit einem Freund in den USA eine halbe Stunde per Headset über eine neue Veröffentlichung von Brian Eno (»The intro is awesome«, meint der S-Bahn-Fahrgast, aber das Gegenüber scheint nicht einsehen zu wollen, dass in dieser Musik überhaupt etwas wie ein Intro existiere, sie sei doch eigentlich ohne Anfang), bis der Mann drüben zum Dinner muss und der hiesige Mann fast eingeschlafen ist und aussieht wie ein Trinker im Selbstgespräch. »Wir sagen Ja zur modernen Welt!« Flughafen Schönefeld dagegen riecht an Gate C penetrant nach dem Dünger der umliegenden Felder, um die Reisenden einzustimmen auf ihre Flüge nach Skopje, Minsk und Saarbrücken.
Ich lese Peter Handkes Spiel vom Fragen, auch um zu lesen, welche Stücke sich bewähren in unvertrauter Umgebung, wie die alten Sätze klingen in der neuen Fremde: »Schaut doch, wie schön! Es ist gerade Frieden hier im Hinterland und darum kann ich das sagen. Ich bin wohl zum Rühmen geboren, denn nichts andres in mir hat Stimme«, sagt die Figur Mauerschauer gleich zu Beginn des Stücks. In der Wartehalle eines Flughafens mit Blick auf die braunen Felder hinter den grauen Rollfeldern hat dieser Anfang eine erhebende Wirkung.
Der Verlag hat mir György Dragománs Scheiterhaufen mit auf den Weg gegeben, aber Literatur des Landes zu lesen, in das ich reise, ist wie Street View zu nutzen, bevor ich dort bin, es lenkt. Reingeschaut hab ich trotzdem, bei Street View und beim Scheiterhaufen, und deshalb nehme ich Schal und Mütze mit, obwohl es Frühling sein soll in Bukarest.
Im Warteraum sitzen fast ausschließlich Rumänen, sportlich gekleidet und hundertprozentig verkabelt und vernetzt. Nur ein zerfurchter alter Mann streunt verloren durch die Gänge, im grauen Anzug, mit dunkler Schiebermütze und zwei prächtig goldenen Ohrringen, wie ein Pate aus einer anderen Zeit. Die überschminkte Tochter ist derweil im Netz und schaut in den Trends, wie schmal heute die Augenbrauen zu sein haben. (Auf der Probe neulich habe ich die Bühnen-Hospitantin gefragt, was sie denn ständig in ihrem Telefon mache, und sie zählte mir Netzwerke auf, die ich nicht kenne (flickr, tumblr, instagram). »Und nach was suchst Du da hauptsächlich?«, fragte ich. Und sie, eine Antwort wie ein Stücktitel: MÖBEL UND DEPRESSIONEN. Der Nachfolger von Shoppen & Ficken.)
*
Am Flughafen nimmt mich die Dramaturgin Monica in Empfang und hat mir Wasser mitgebracht (vom Leitungswasser wird abgeraten) und wir rauchen zur Begrüßung mit dem Fahrer. Auf der Fahrt in die Stadt gibt es eine Einführung ins rumänische Theater vorbei an IKEARALDIREALTOTAL. Ion Țiriac hat tatsächlich ein Autohaus und Opel wirbt auf Deutsch mit dem weltweit unverständlichen Slogan: »Wir leben Autos.« Es gibt zwölf Theater in Bukarest, die meisten unterstützt von Staat oder Stadt, das Teatrul de Comedie liegt günstig im Zentrum, die Eintrittspreise sind moderat, die Schauspieler fest angestellt (viele machen Film und Fernsehen nebenher), es gibt ein treues Publikum, neuerdings auch zahlreich junges. Vor der Premiere meines Stückes gab es bereits fünf öffentliche Vorstellungen, um die Reaktionen zu prüfen. Heute kommen die Kritiker, aber ihre Kritiken haben keinen wesentlichen Einfluss auf den Zuschauerzuspruch. Verrisse gibt es nicht, Theater ist kein Kampfsport. Monica wirkt sehr gelassen, freundlich, ihr Englisch ist frischer als meins.
Das Hotel liegt in der renovierten Altstadt, von der Terrasse schaue ich auf den Irish Pub, die Nationalbank, und leicht erhöht auf einem Hügel über der Stadt prunkt das »Haus des Volkes«. Ein Dutzend Kirchen und 40 000 Wohnungen wurden für den Palast abgerissen, fast 40 % des Bruttosozialproduktes hat der Bau in seiner Hochzeit verbraucht, Ceausescu kam in manchen Wochen täglich auf die Baustelle, um Extras zu fordern, und hat die Eröffnung nicht mehr erlebt. Und als ich Monica frage, ob sie mit Wut auf das Monument blicke, schaut sie mich an, als wäre sie enttäuscht von meiner Überheblichkeit: »Es ist das zweitgrößte Regierungsgebäude der Welt nach dem Pentagon. Es ist unser Wahrzeichen.« Ganz fertig ist es nie geworden, immer noch stehen Räume seit der Eröffnung ungenutzt und leer, während an anderen Stellen schon wieder Renovierungsarbeiten notwendig werden. Vielleicht ist das die Wahrheit dieses Zeichens: Die Arbeit am »Haus des Volkes« findet kein Ende, Leere und Betrieb, die säkulare Kathedrale. »Derzeit (2010) kümmern sich 170 Techniker um die Unterhaltung des Gebäudes. Da 2008 die Stromrechnung 1,7 Millionen Euro betrug, werden die Glühlampen nach und nach durch Energiesparlampen ersetzt«, schreibt Wikipedia, das Lexikon des Volkes.
*
Auf den aufgeputzten Straßen ziehen mit der üblichen Unverschämtheit amerikanische, englische und deutsche Junggesellenhorden durch die Altstadt, auf der Suche nach dem vertrauten Vergnügen in exotischer Umgebung zu günstigem Preis. Und wundern sich, gerechter Trick, dass die Weinpreise auf dem Niveau von Paris angesetzt sind. Man nennt nämlich Bukarest das Paris des Ostens (Budapest, Odessa und Beirut aber auch). Mir kommt es bisher eher vor wie der dunkle Neffe von Wien, 50 Jahre verheiratet mit einer unmöglichen Frau und jetzt wieder um Kontakt bemüht (zu lang für die Touristeninformation).
*
»Aber warum fällt mir das Schönfinden heutzutage schwerer und schwerer?«, fragt der Mauerschauer bei Handke und hier, jetzt beim Gang entlang der Schwerverkehrsstraße, würde ich antworten: ALTER! (ich müsste schreien, weil es sehr laut ist) AUGEN AUF! Denn wie sich hier die Zeiten streiten, Historien belagern, Geschichten bekämpfen, das gab es nie zuvor, denn es kommt immer noch etwas hinzu und nichts verschwindet, Cézanne!, es transformiert sich zu wilder Collage, z. B. hängt wie eine zweite Haut über der Fassade eines ergrauten Wohnhauses aus der Zeit König Carols I. ein tennisfeldgroßes Reklameplakat von Hornbach, auf dem sich eine Frau beim Schneiden einer Hecke heftig verletzt hat (falsche Heckenschere, besser Hornbach). Die Hausbewohner erhalten dafür einen Mietzuschuss wegen der Sichtbehinderung und der Verdunkelung ihrer Wohnungen, erklärt mir Monica, und eine Hausgemeinschaft habe vor Kurzem mehrheitlich gegen einen Mitbewohner gestimmt, der geklagt hatte, weil er etwas von der Stadt sehen wollte statt immer nur die Hornbach-Hecke. Der Verkehr auf dem Platz vor dem Haus ist tatsächlich sehenswert, es staut sich ständig auf der Splaiul Independenței am Podul Națiunile Unite, treue Dacias ärgern korrupte Range Rover, kommunistische Autobusse erniedrigen lebensmüde Mofafahrer, es wird Nähe gesucht, und aus den hinteren Reihen wird das autodestruktive Nervenspiel in freien Rhythmen beifällig behupt. »Jedes Hupen ein ›Fuck you‹«, lerne ich später, als engagierte Rumänen über den Fatalismus der anderen Rumänen diskutieren. Zwei Straßen weiter finden sich die wenigen Fußgänger unter dem Vordach einer kleinen Kirche ein, weil es zu regnen begonnen hat, und drinnen knien alte Frauen mit Kopftuch vor einem goldenen Altar, und mild mahnen die Ikonen. Und Dir fällt das Schönfinden schwer, Mauerschauer?
*
Am Abend komme ich ins Theater und werde am Ende der Nacht durchgehend begeistert gewesen sein (verspätete Spoiler-Warnung!). An der prächtigen Fassade blättert kunstvoll der Putz, um das Theater an seine Vergänglichkeit zu erinnern (eine Glasfront kann das nicht). Der Saal fasst 300 Plätze, es gibt einen Balkon, das Bühnenbild ist zurückhaltend offen für die Situation. Die Zuschauer haben sich schön gemacht, ohne angestrengt zu wirken. Am Anfang der Vorstellung klingeln noch Telefone, man redet auch während des Spiels noch über das Geschehen auf der Bühne und erklärt einander die Witze, wenn sie vorbeigerauscht sind. Kein Lachen muss sein Niveau beweisen, scheint mir. Vielleicht bin ich auch nur erleichtert, wie leicht alles wirkt. Und froh zu spüren, wie eine Verbindung entsteht zwischen lebendigem Publikum und gelassenen Spielern, die aufeinander reagieren, als wären sie gemeinsam im Wohnzimmer. Und begeistert, wenn ich daran denke, wie eine Replik aus meinem Oberstübchen im Berliner Hinterhof übersetzt und übertragen in den Mund eines rumänischen Fernsehstars hier auf die Bühne kommt und 300 Unbekannte laut lachen lässt: »Monogamie ist eine Ordnungs-Phantasie. Man hat halt lange geglaubt, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, müsste man die Intimbeziehungen regulieren. Ist nicht der Fall. Ob die Leute Gruppensex haben oder sich auspeitschen lassen. Egal. Hauptsache, Du kommst halbwegs ausgeschlafen zur Arbeit«, verkündet die Figur Wolfgang Braumeister und bekommt Szenenapplaus für seinen Return, ohne dass ich verstehen könnte, was genau daran jetzt hier so witzig ist. »Wir reden gerne über die Probleme der Deutschen, weil wir uns freuen, dass sie auch welche haben«, erklärt mir später der Regisseur und Übersetzer Vlad Massaci auf die Frage nach der Übertragbarkeit der Konflikte, »vielleicht macht es uns schon froh, diese Probleme auch zu kennen.« Mich macht es froh, wenn gelacht wird, weil etwas geschehen sein muss davor, und das Lachen eröffnet dem Denken eine Möglichkeit und plötzlich (Ende offen).
Sandu Pop spielt den gekränkten Frauenheld mit einer zaghaften Selbstironie, die den Frauenhelden erst zu einem heutigen Frauenhelden macht (meine Erfahrung). Delia Nartea verteidigt ihre Figur und deren Glauben mit der Würde, die es braucht, um ihre Alltagsuntauglichkeit komisch finden zu können. Distanz ist Schwäche, zeigt das Spiel hier, zumindest in der Komödie (Was ist der Gewinn, wenn Spieler ihre Figuren vorführen wie Beispiele? Was wären die Typen einer heutigen Commedia? Was macht der Fortschritt in der Kunst?). Alexandru Conovaru spielt den verstörten Studienrat als wäre er einer, aber ohne Brille und mit Lederjacke beim Wein auf der Feier danach ist er ein neugieriger Charmeur. Schön, Dich kennenzulernen, noch einmal, jetzt, toll, umarme ich eine ehemalige Figur meines Stückes, entfernt bekannt zugleich. Er stellt mir Fragen zu seiner Figur, die ich nicht beantworten kann, weil diese Figur heute Abend lebendiger war, als ich sie gedacht haben hätte können, und ich Sorge habe, diese Lebendigkeit nachträglich zu beschädigen. Wir feiern im Hinterzimmer einer Bar, die dem Intendanten gehört, und er drückt bloß eine Klingel und die nächsten Karaffen kommen zu uns Schlaraffen und wir laben uns und loben uns und lieben uns vorübergehend. Der Intendant spielt seit 1971 selbst an seinem Theater und umarmt mich mit Komplimenten auf Rumänisch, denen ich unübersetzt zustimme (»Wir leben Autos.«).
Über eine große Feier wie diese mit ihren Details und Nuancen (römisch und rumänisch), Körpern, Blicken und Gesten, Demonstrationen und Spielen (War ich besser als der Spieler bei der Uraufführung? Tiefer?), Rhythmus, Soli und Chor, Witz und Verstrickung, Unverständnis, aufscheinende Vergangenheit, aufreißende Möglichkeit, Störung, Lösung, Lallen, Fallen, die Taktung der Abschiede und den Tag danach müsste auch einmal jemand sehr feierlich und nüchtern schreiben, denke ich trunken kurz vorm Traum im Bett über der Stadt, unter dem Blick des Volkspalastes (»Ich akzeptiere dieses Gericht nicht«, wiederholte der Angeklagte).