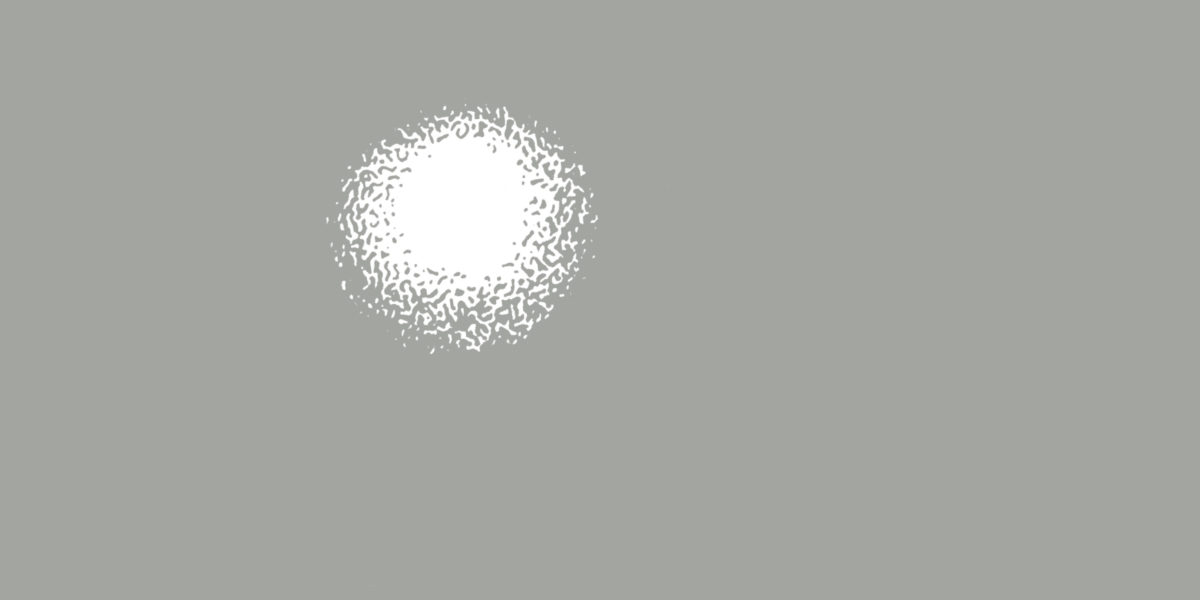Nahe der Wohnsiedlung, in der ich aufgewachsen bin, genau genommen an deren von unserem Wohnblock aus gesehen hinterem Ende, wenn man am Rosengarten und an der Kirche vorbeigelaufen war, an diesem linken hinteren Ende lag das KGM. Der Konsumgroßmarkt war 1973 errichtet worden und damit ungefähr zehn Jahre bevor wir, damals noch als Vater-Mutter-Kind-Kind-Kleinfamilie, in die Wohnsiedlung ziehen sollten. Ich erinnere das Einkaufen in diesem Konsumgroßmarkt, im eigentlichen Sinn keine Shopping Mall, weil es zwar alles, wirklich alles dort zu kaufen gab, aber eben nicht von Einzelhändlern auf eigene Rechnung in separaten Läden angeboten. Damals wusste ich nicht, wofür die Abkürzung stand, ich wusste nur, dass es, wenn unser Vater meine Schwester und mich zum Einkaufen mitnahm, dort ein Dreh-und-Trink geben würde und manchmal nach dem Einkauf auch noch ein Langos, fettig in einer Imbissbude auf dem Parkplatz rausgebacken und mit Knoblauchöl bestrichen. Mein Vater kochte nicht gerne.
Ich lese den Wikipedia-Eintrag zu Shopping Centern, Einkaufszentren oder Malls, bereits da ist sich Wikipedia nicht sicher, wie man nun im Deutschen dazu sagen soll. Erbaut worden sei die erste Mall in Minneapolis im Jahr 1956, von einem aus Österreich vertriebenen Architekten namens Victor Gruen. Schon 1947 plante er ein Kaufhaus mit Parkdeck auf dem Dach, etwas, das es bis dahin nicht gegeben hatte. In den USA gibt es nach wie vor rund 43 000 Einkaufszentren, die einen Anteil von 55 Prozent am Einzelhandelsumsatz ausmachen, lese ich in dem Eintrag auch noch.
Verließ man die Siedlung nicht linker Hand Richtung KGM, sondern rechter Hand, so kam man zur Bahn, und folgte man der Straße unter der Bahnunterführung hindurch, dann kam man irgendwann, vielleicht nach einem Kilometer (oder ist es doch mehr, meine kindliche Erinnerung hat keine Distanzen mit aufgenommen) zur ersten Shopping Mall, die ich jemals betrat: das Shopping Center Nord, SCN. Eröffnet wurde es am 12. Oktober 1989, und dass kurz darauf Geschichte geschrieben werden sollte, war mir damals nicht klar. Mit der Schwester meines Vaters gingen wir dort als Kinder Flanieren, wochentags arbeitete sie in Linz als Krankenschwester, am Wochenende nahm sie mich und meine Schwester manchmal zu sich, damit unser mittlerweile alleinerziehender Vater etwas Freizeit für sich haben konnte. Immer fuhren wir mit dem Auto dorthin, obwohl der Weg von ihrer Wohnung nicht weit war. Wir kuckten in die Schaufenster, meist gingen wir dann doch nur zum Supermarkt im Untergeschoss, um eine Packung TK-Mischgemüse zu kaufen, mit dem wir später selbstgemachte Pizza belegten, vielleicht auch noch eine Flasche Schweppes Bitter Lemon, das meine Tante so gerne trank. Manchmal aber verzichteten wir auch auf den Einkauf und fuhren stattdessen weiter auf der Ausfahrtstraße zu McDonalds: Das waren die guten Tage!
Ich war vielleicht zwölf oder auch schon dreizehn Jahre alt, als ein neues Mädchen in meine Klasse kam. Ihr Name war Aida, sie war aus Linz nach Wien gezogen und sie sollte bloß bis zum Ende des Schuljahres bei uns bleiben, dann war sie plötzlich wieder verschwunden. Mit ihr schwänzte ich das erste Mal Schule, wir nahmen das Klassenbuch mit, damit unser Fehlen nicht eingetragen werden konnte, doch wir hatten die Rechnung ohne unseren Klassenvorstand genannten Klassenlehrer gemacht, der unseren Eltern trotzdem Bescheid gab. Davon wusste ich noch nichts, als Aida und ich vor McDonalds saßen – es war sonnig, war es im Frühjahr? Vielleicht sogar kurz vor Schulschluss? –, und dort in der Sonne aß ich nicht ein, nicht zwei, sondern drei McFlurrys hintereinander. Ich hatte früh aufgehört, Fleisch zu essen, und McDonalds verlor als Verkörperung des pflichtbewusst verhassten amerikanischen Kapitalismus bald seinen Reiz für mich. Vielleicht war das tatsächlich eines der letzten Male, die ich bei McDonalds war, an einer Hand meine ich abzählen zu können, wie oft ich danach noch in einer Filiale war – ich erinnere mich an einmal in Beijing und an einmal in Eisenhüttenstadt.
Später, vielleicht war es auch dasselbe Jahr, in dem ich im Frühjahr mit Aida bei McDonalds Schule geschwänzt hatte, klaute ich das erste Mal in meinem Leben. Wieder schwänzte ich Schule, wahrscheinlich war es der Herbst desselben Jahres, mein letztes Jahr vor dem Schulwechsel in die Oberstufe an ein anderes Gymnasium, und weil es schon kühl war, waren wir ins SCN gefahren. Bei H&M, den es mittlerweile auch in Österreich gab, klaute ich an jenem Tag ein langärmeliges Lurextop, das blau-silbern schimmerte. Meine Freundin Karin, die ein Jahr älter war und zu jener Zeit schon Heroin rauchte, zeigte mir, wie man es verstecken musste. Ich war aufgeregt wie vor einer der Schularbeiten genannten Klausuren, auf die ich doch meistens gute Noten schrieb und vor denen ich selten etwas zu befürchten hatte.
Viele Jahre später, im Jahr 2018, fahre ich das erste Mal nach Chișinău, in die Hauptstadt der Republik Moldau. Mein Freund gibt dort einen Workshop, und ich streife umher, erkunde die Gegend. Ein Lyriker, den wir kennenlernen, sagt zu mir: Wenn du neu in eine Stadt kommst, dann musst du drei Orte aufsuchen, den Bahnhof, um das Verhältnis der Menschen zu Zeit und Raum zu verstehen; den Friedhof, um die Beziehung zum eigenen Tod und den Vorfahren zu erkunden; und den Markt, den Basar, das Warenhaus – weil spätestens seit Georg Simmel klar ist, dass Handelsbeziehungen auch etwas über Kultur aussagen. Ich laufe also über den Markt, der mich an so viele Märkte, die ich gesehen habe, erinnert – Bangladesh in Jerewan, Arizona im bosnisch-kroatischen Grenzland –, später erkunde ich das UNIC genannte Kaufhaus. Es besticht dadurch, dass sich auf der letzten Etage an allen Ecken kleine Schneidereien befinden, man dort also nicht nur Stangenware erwerben kann, sondern auch eigene Entwürfe anfertigen lassen kann.
Den Sommer 1999 verbrachten wir beinahe ausschließlich im B7, einem sogenannten Ekazent – dass das eine Verkürzung des Begriffs Einkaufszentrum war, wussten wir schon damals, wir fanden es bescheuert. Es hatte auch nichts von einem mondänen Shopping Center, geschweige denn einer Mall, es waren ein paar Geschäfte genannte Läden, die dort, nicht mal unter einem Dach, ihre Waren feilboten. Ich erinnere mich an einen Eissalon, und wenn ich heute im Netz recherchiere, welche Läden es dort gibt, dann ist es die übliche Ansammlung von Apotheke, Nagelstudio und Solarium, dazwischen ein paar Boutiquen und zwei Supermärkte der REWE-Kette. Meist trafen wir uns dort am frühen Nachmittag, die meisten wohnten in einer der Genossenschaftssiedlungen, die nebendran lagen. Ich selbst musste mit dem Bus etwa fünfzehn Minuten von der Gemeindebau genannten sozialen Wohnbausiedlung hinfahren, nachdem ich aus der Memphis light-Zigarettenschachtel meines Vaters ein paar Zigaretten genommen hatte, und aus der Kokosnussschale, in der er Fünf- und Zehn-Schilling-Münzen sammelte, ein paar Münzen, damit wir uns im Supermarkt Wassereis kaufen konnten, aus dem wir die Farbe saugten, oder Alkopops namens Hooch, die uns kichern machten. Wir wollten rappen wie Tic Tac Toe und Schwester S, meine beste Freundin wollte Paddy Kelly heiraten und ihre ältere Schwester den jüngeren Angelo.
Als es dann kalt wurde, wichen wir zum Schuleschwänzen und Rumhängen auf das Donau Zentrum aus. Auf Wikipedia heißt es darüber, es »wurde 1975 mit 22.800 m² eröffnet, die heutige Verkaufsfläche beträgt 100.750 m²«, es hat sich seit seiner Eröffnung also vervierfacht, und würde ich heute noch einmal dorthin gehen, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. Gegenüber von Kleiderbauer, gleich nach dem straßenseitigen Eingang, konnte man zu Meinl gehen, dort billigen Rotwein und eine Black-Jack-Cola kaufen, damit auf die Toilette verschwinden, die halbe Cola ins Klo schütten oder schnell trinken, dann den Korken des Rotweins mit einem kleinen BIC-Feuerzeug in die Flasche drücken, um dann den Rotwein in die Colaflasche zu kippen. Fertig war das Mixgetränk. Damit setzten wir uns auf die roten Metallbänke, die zwischen den Ladenflächen angebracht waren, in ihrem Rücken meist Pflanzen, vielleicht auch ein Wasserbecken mit einem kleinen Wasserfall, neben jeder Bank ein großer Aschenbecher. Wir rauchten viel, es war unser Hobby in diesen Jahren.
Es gibt ein Einkaufszentrum, das ich gut kenne, obwohl ich es nie betreten habe. Es hieß NAMA – auf Deutsch: Uns – und stand im Zentrum der kroatischen Stadt Vukovar, die im Winter 1991 dem Erdboden beinahe gleichgemacht wurde und im Rahmen der sogenannten friedlichen Reintegration 1996 an den nun unabhängigen kroatischen Staat zurückgegeben wurde. Dort verbrachte ich nach meinem Matura genannten Abitur ein European Voluntary Service in einer Jugendorganisation. Und beinahe täglich führte mich mein Weg an dieser Ruine vorbei, wenn ich zum Einkaufen ging oder auf einen Nescafé ins Crni Mačak. Mein Freund Darko erzählte mir, dass er dort das erste Mal in seinem Leben Rolltreppe gefahren war, vor dem Krieg sei das gewesen, also ungefähr zu der Zeit, in der ich das erste Mal im SCN war. Darko war so alt wie ich, und 1991, erzählte er, sei er, als die Stadt eingenommen worden war, mit seiner Mutter an der Hand von seinem Elternhaus Richtung NAMA gelaufen – und die Straßen seien voller Toter gewesen.
Im selben Jahr, in dem ich in Vukovar war, veröffentlichten zwei tschechische Filmakademiestudenten ihre Abschlussarbeit. Der Film hieß Český sen, Der tschechische Traum, und dokumentierte akribisch die einzelnen Schritte einer Werbekampagne bis zur Eröffnung eines neuen Hypermarktes. Der Clou: Den Hypermarkt gibt es nicht, am Tag der Eröffnung laufen all die Shoppingwütigen auf Attrappen zu, und die Enttäuschung ist groß, als sie das schließlich entdecken. Wir feierten den Film damals für seine Konsumkritik, erst später wurde mir klar, wie zynisch dieser Film auch war, unterschlug er doch die Armut, die für manche Menschen der Grund gewesen sein muss, sich auf die billigen Eröffnungsangebote stürzen zu wollen.
In Leipzig schließlich sollten kurz nach meinem Umzug dorthin die Höfe am Brühl im Stadtzentrum eröffnet werden, und wenn ich heute mit Freunden spreche, die noch immer dort leben, dann erzählen sie Geschichten von Verdrängung, von steigenden Mieten, von der Veränderung. Für mich bedeutete Leipzig noch eine unglaubliche Freiheit, und ich weiß, dass es mich mit seinen vielen Brachen an meine Kindheit erinnerte, an dieses Wien, das gerade erst aus seinem Dornröschenschlaf zwischen dem Osten und Westen Europas erwacht war. Ich frage mich manchmal, ob die Malls die Konkurrenz durch Amazon überleben werden, und wenn ja, ob ich das gut finde. Vor einiger Zeit schickte mir ein Freund, der in den USA aufgewachsen ist, Fotos, die jemand von der Shopping Mall seiner Kindheit aufgenommen hatte, der Great Northern Mall bei Syracuse, Bundesstaat New York. Sie steht mittlerweile beinahe leer, und es hat etwas Trauriges, diese Konsumarchitektur ohne Waren und Menschen zu sehen – der Boden ist braun gefliest, in den Lichthöfen finden sich eingerahmte Grünpflanzenbeete und an manchen Stellen sieht man noch die Ladenschilder von Claire’s oder Macy’s oder Toys R Us.
Einige Tage, nachdem ich die Arbeit an diesem Text begonnen habe, treffe ich eine Freundin, bevor ich mich auf den Weg zum Flughafen mache. Wir treffen uns in der Shopping Mall an der S-Bahn-Station Landstraße, von der meine Bahn zum Flughafen fahren wird. Es ist eine dieser Malls, wie sie auch in Shanghai an jedem U-Bahnhof zu finden sind – hochpreisige Bäckereien, ein paar Fashion-Läden, dazwischen Gastronomie, aber keine Verweilmöglichkeiten mehr. Zu sehr ist man darauf bedacht, an diesen Orten nicht mehr zum Aufenthalt, sondern zu ausgedehntem Konsum einzuladen. In einer RAUCH-Saftbar sitzen meine Freundin und ich mehrere Stunden, und ich erzähle ihr von meinem Liebeskummer. Sie hört mir zu, fragt nach, gibt mir Ratschläge, und ich finde sie unglaublich weise und lebenserfahren dabei. Als ich in der S-Bahn zum Flughafen sitze, denke ich daran, wie angenehm anonym der Aufenthalt in der Mall war. Ob vielleicht genau deswegen diese Nähe zwischen meiner Freundin und mir Platz hatte? In dem Caféhaus, in dem ich zuvor gewesen war, war es mir unangenehm gewesen, über Privates zu sprechen. In der Anonymität der Shopping Mall hingegen war Platz für die Intimität eines Gespräches zwischen Freundinnen.
Zurück in Berlin komme ich spätabends in meiner Wohnung an, die keine fünf Minuten von Karstadt am Hermannplatz entfernt ist. Mehrmals pro Woche gehe ich dorthin, ich gehe in den Bioladen und zu Rewe, ich gehe in die Haushaltsabteilung, ich kaufe Kurzwaren, Badematten, Leitz-Ordner, Druckerpapier, farbige Umschläge, ich gehe zur Post und lasse in der Schmuckabteilung eine Halskette reparieren. Es hat gedauert, bis ich das Restaurant auf dem Dach entdeckt habe, mehr noch, dessen Dachterrasse, auf der man mit einer Bionade in der Hand wunderbar sonnenbaden kann. Ein Gefühl von Urbanität stellt sich dabei ein, unten die Autos, der Markt, die U-Bahn und die Menschen, von denen es am Hermannplatz immer zu viele zu geben scheint. Ein letztes Mal sitze ich in diesem Jahr draußen, bevor der Herbst endgültig Einzug halten wird. Mein Liebeskummer ist vorüber. Ich richte meinen Blick auf die Stadt.