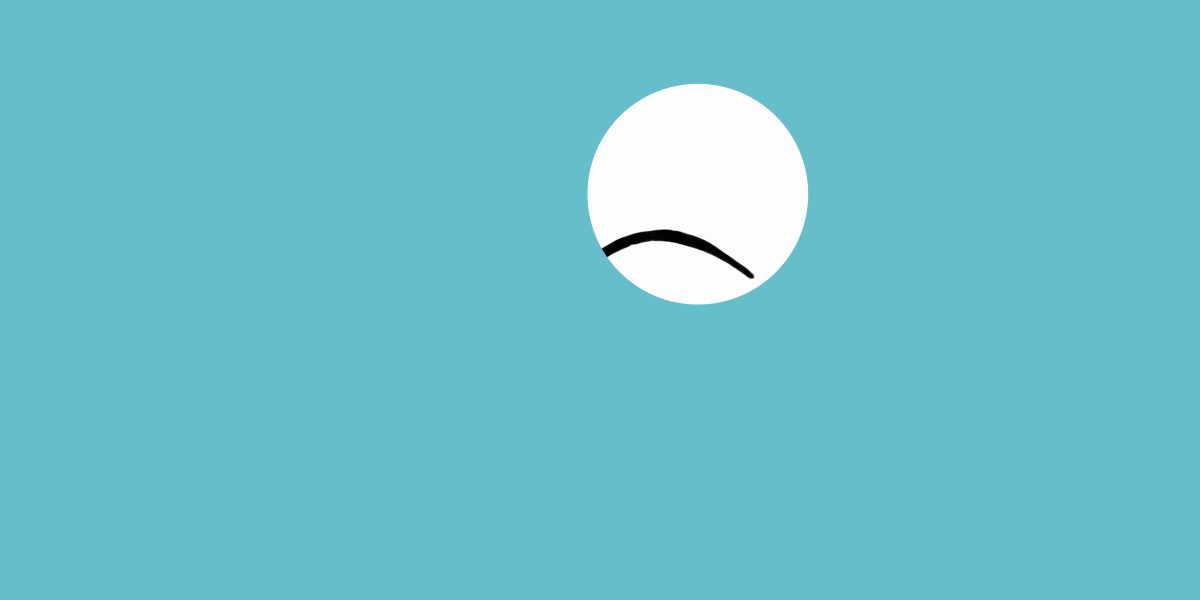Laudatio auf Marion Poschmann zum Joseph-Breitbach-Preis 2023
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Marion!
Zu Ehren der Preisträgerin möchte ich Sie zu einem kleinen Parcours durch ihr Werk einladen. Dabei setze ich zur besseren Orientierung ein paar Blink- oder Leuchtzeichen: grün, grau und schließlich transparent, aber doch strahlend, denn wir haben es mit einer wahren Virtuosin der Lichtmetaphorik zu tun.
Stets fallen bei der Lektüre der Poesie und Prosa Marion Poschmanns, die heute Abend mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet wird, erlesene Grüntöne auf. In ihrem Debütroman Baden bei Gewitter aus dem Jahr 2002 schildert sie den Anblick eines Ententeichs im Stadtpark. Über dem kleinen Gewässer schweben Wolken, von denen es heißt, sie seien proper, glatt und zum Greifen nah wie Seifenstücke. Das Wasser darunter erscheint zunächst türkis. Doch beim Näherkommen dunkelt der Teich in den Augen der jungen Ich-Erzählerin nach, und zwar »moosfarben, spinatartig, algengrün«. Die Bronzestatuen, heißt es weiter, stünden »in entspannter Haltung auf ihren Sockeln, Patina auf den Schultern wie Rückstände eines Bades in diesem grünlichen Wasser«.
»Schwimme mit leichtem Körper still im Lichtgrünen, darauf der Dampf lagert«: So heißt es in Ernst Augustins Hochstaplersaga Das Badehaus über die Rückkehr eines falschen Sohnes in sein Elternhaus im fiktiven holländischen Kurort Hagel. Im Werk auch dieses höchst originellen Autors, der im Brotberuf Psychiater war, verschwimmen ebenfalls die Bewusstseinszustände des Ich-Erzählers mit sich wandelnden Farbeindrücken. Augustin war wie Marion Poschmann ein Anhänger des Nouveau Roman, in dem es nicht vordringlich um so etwas Konventionelles wie Handlung geht. Man denke etwa an Michel Butors geheimnisvollen, kriminalistisch getönten Roman L’emploi du temps (Der Zeitplan): Darin versucht ein junger Franzose ein Jahr lang vergeblich, sich in einer feindselig wirkenden englischen Industriestadt zu akklimatisieren. Doch die Topographie von Bleston vernebelt sich ihm immer wieder, wodurch die Zeit allmählich eine räumliche Dimension erlangt.
Sie habe einen Bewusstseinsroman schreiben wollen, erklärte Marion Poschmann einmal programmatisch, einen Wahrnehmungsroman, der die Handlungslosigkeit feiere: »[…] eine Handlung wie die Knitterfalten meines Duschvorhangs: zufällig und bedeutungslos, […] ein Muster, bestehend aus lauter unscheinbaren Eindrücken, die sich erst en masse, in bestimmter Ballung zu einem Ereignis auswachsen können«. So schreibt Marion Poschmann in Mondbetrachtung in mondloser Nacht. In diesem Band erteilt sie erhellende poetologische Selbstauskünfte. Zuweilen bleibt die Handlung ihrer Prosatexte stehen, verharrt das Erzählen wie eine irisierende Libelle in der Luft: Dann überlässt die Autorin ganz den Farben und Formen das Feld.
Marion Poschmanns Psychiatrie- und Post-DDR-Roman Die Sonnenposition ist vor zehn Jahren erschienen. Darin werden Lebensabschnitte der Anstaltsinsassen durch Tapetenmuster symbolisiert. Ein verheißungsvoller »manilagrüner« Autolack wiederum steht für die »Sehnsucht nach Flucht«. Dass dieser Parforceritt samt Pausen gelingt, dass man sich an dieser Symphonie des Lichts in Romanform nicht sattliest, ist Marion Poschmanns Sprache zu verdanken, der Sprache einer Lyrikerin.
»Baden« ist das allererste veröffentlichte Wort ihres Werks, das mittlerweile rund 14 Bücher umfasst und mit einer kaum überschaubaren Zahl an Preisen und Stipendien bedacht wurde. Dazu zählen Aufenthalte in der Villa Massimo und in der Villa Kamogawa des Goethe-Instituts in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto mit ihren prächtigen Shinto-Schreinen. Auch als deutschsprachige Pionierin des Nature Writings wurde sie mehrfach geehrt. Heute kommt mit dem Joseph-Breitbach-Preis eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen hinzu. Schon als Kind wollte die 1969 in Essen geborene Marion Poschmann Schriftstellerin werden.
Baden also. Für Martin Luther war die Sache klar: »Wo ein melancholischer und schwermütiger Kopf ist, da hat der Teufel sein Bad zugerichtet.« Als besonders gefährlich galt das Baden in freien Gewässern, dort, wo es gewittern kann, und wo eventuell Medusen und andere Quallenarten in ihrer mehr oder minder transparenten, chiffonartigen Eleganz dahintreiben. Ihnen hat die Autorin bereits in ihrem Debütroman ein eigenes Kapitel über einen Tag am Strand gewidmet, ebenso wie den lumineszenten Meeresbewohnern. Diese Tiere leuchten aus eigener Kraft im Dunkeln der Tiefsee. Doch davon später mehr.
Zurück zur Farbe Grün: Marion Poschmann und mich verbindet unter anderem das Interesse und die Sympathie für Osteuropa. Kennengelernt haben wir uns anlässlich ihres Schwarzweißromans 2005. Im Oktober 2017 hatten wir die Gelegenheit, im Rahmen des deutsch-ukrainischen Schriftstelleraustauschs Eine Brücke aus Papier Charkiw zu besuchen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine war von 1921 bis 1934 die Hauptstadt der von Moskau relativ unabhängigen ukrainischen Sowjetrepublik. Charkiw ist traditionell ein Ort der Industrie, der Universitäten und der Kultur, vor allem der Architektur. Die für die Stadt charakteristischen kühnen konstruktivistischen Bauwerke sind von unschätzbarem kulturhistorischem Wert. Sie trugen Charkiw vor hundert Jahren den Ruf eines ukrainischen Chicagos ein; inzwischen haben die russischen Aggressoren schätzungsweise 8000 Gebäude zerstört.
In jenen für die Ostukraine noch halbwegs friedlichen Oktobertagen jedoch erfreuten wir uns als Spaziergängerinnen der Gestaltung zahlreicher Fassaden in Milch- bis Pfefferminzgrün, ganz gleich, ob es sich um Verwaltungsgebäude oder eine tannenumstandene und damit zweifachgrüne Apotheke handelte.
Und nun begegnet Mathilda, die Hauptfigur von Marion Poschmanns gerade erschienenem Roman Chor der Erinnyen, diesem spezifisch slawischen Grün an ihrem hiesigen Arbeitsplatz. Durch die plötzliche, unbegründete Abreise ihres Mannes aus dem inneren Gleichgewicht geraten, versucht die Lehrerin für Mathematik und Musik, zumindest vor ihrem Referendar Contenance zu wahren: »[…] sie gingen am Mintgrün vorbei, der Farbe von osteuropäischen Anstaltsfluren, sie wollte dem Referendar gegenüber eine lässige Bemerkung dazu machen, aber er hatte sich von ihr abgewandt, als wolle er sich noch einmal sammeln, und das akzeptierte sie natürlich.«
Mathilda ist die Frau des Bartforschers Gilbert Silvester, der in Chor der Erinnyen allerdings nicht namentlich genannt wird – zu enttäuscht ist Mathilda von ihm. Vielleicht hätte Gilbert Silvester auf die lateinische Bedeutung seines Nachnamens – der zum Walde gehörende – schon früher achten sollen, um seine Ehe zu stabilisieren. Als er eines Morgens von dem Alptraum erwacht, Mathilda habe ihn betrogen, nimmt er ohne zu überlegen den ersten Transkontinentalflug – nach Japan, ins scheinbar beruhigende Dunkelgrün der Kiefernwälder.
»Wir sind so gerne in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat«, behauptete Friedrich Nietzsche. Gilbert und Mathilda hatten bei einer USA-Reise den Zauber der Laubfärbung während des Indian Summer verpasst. Jetzt, in einer tiefen Krise, erhält er unverhofft eine zweite Chance zur seelischen Regeneration im Wald: in der – wie es heißt – »geisterhaften Großelternstille« der Kieferninseln Matsushima, die der Haiku-Erneuerer Matsuo Bashō im 17. Jahrhundert verewigte. Marion Poschmann hegt seit ihrem bereits erwähnten Schwarzweißroman eine Vorliebe für eher passive Protagonisten, die sie in den Osten schickt. Dort nehmen sie die fremde Umgebung in einer Art träumerischer Osmose in sich auf.
Mit ihrem außergewöhnlichen mimetischen Vermögen veredelt Marion Poschmann Japan- und andere Klischees in Poesie. Das gelingt ihr nicht zuletzt deshalb, weil ihre Erzählfiguren, auch das jeweilige lyrische Ich, mit einer gehörigen Portion Selbstironie ausgestattet sind. Ich zitiere aus dem Gedicht Selinecereus grandiflorus (Königin der Nacht) aus dem Band Geistersehen: »ich war die Blumenmalerei auf einem Teetablett, schwarzgründig, unerreichbar«. In einem anderen Gedicht verbringt das lyrische Ich die Nacht in einer beengenden Gartenmöbelhülle und damit einem Dreifach-Kompositum.
Mit dem Roman Die Kieferninseln feierte Marion Poschmann ihren bislang größten internationalen Erfolg: Das Buch wurde in zehn Sprachen übersetzt und stand 2019 auf der Shortlist des Londoner Man Booker International Prize. Chor der Erinnyen bildet nun den Komplementärroman dazu. Er schildert die Ehekrise aus der Sicht der hiergebliebenen Mathilda, deren dunkle Haarpracht morgens auf dem Kissen einem Medusenhaupt ähnelt. In ihrer Enttäuschung ergeht sich die sonst so beherrschte Lehrerin mit mehr oder weniger geschätzten Jugendfreundinnen bei Wanderungen im heimischen Mischwald, jenem domestizierten Restgrün, das Marion Poschmann stets mit Leidenschaft thematisiert. Etwa in der dunkel glühenden, vom Romantiker E.T.A. Hoffmann inspirierten Hundenovelle, einer hochallegorischen Erzählung über die Entstehung des melancholischen Bewusstseins in unserer Zeit. Albrecht Dürer stellte auf einem berühmten Stich die Melencolia als sinnierende geflügelte Frau unter einem Regenbogen dar. Zu ihren Füßen kauert ein ausgemergelter Hund. Er wird in der Astrologie mit dem Saturn in Verbindung gebracht, dem Gestirn der Melancholiker.
Es verwundert nicht, dass sich eine so originelle und mythologiegeschichtlich versierte Autorin wie Marion Poschmann von dem unerschöpflichen Themenkomplex der »schwarzen Galle« angezogen fühlt. Bereits in ihrem nach Verschlossene Kammern zweiten, von der Kritik vehement gelobten Lyrikband Grund zu Schafen hatte sie gleich im ersten Gedicht Dürers kleinem Rasenstück eine lichtdurchflutete Reverenz erwiesen. Damals schon war es ihr um das Aufzeigen von »Geometrien der Melancholie« gegangen, desgleichen um Gartenarchitektur, um die Geometrie künstlicher Landschaften wie dem Bernsteinpark Kaliningrad oder dem Park des verlorenen Mondscheins im japanischen Matsushima.
In der Hundenovelle streift eine einsame Laborantin durch das Brachland einer aufgegebenen Industrielandschaft. Diese erscheint als Spiegelbild ihrer seelischen Verwahrlosung. Ihre Isolation empfindet sie dabei als Geschenk: »Immer war zuviel Geschwätz um mich gewesen, zuviel Unruhe.« Das ist, bevor sie dem schicksalhaften schwarzen Rüden Pompi begegnet, der im Hundesalon nicht um ein Bad herumkommt.
Dem Geschwätz und der Unruhe wollen fast alle Poschmann’schen Romanfiguren entfliehen, introvertiert, wie sie sind. Mathilda aus dem aktuellen Buch hält Smalltalk für einen Austausch von Energie, nicht von Informationen – mithin für überflüssig. Sie ist die Tochter der putzwütigen Roswitha, einer Frau mit dem zweiten Gesicht. Diese Fähigkeit machte sie für den Bundesnachrichtendienst interessant. Und jetzt entdeckt die Tochter ihre eigenen, bislang brachliegenden Verbindungen zu den Rachegöttinnen der griechischen Antike. Daraus erwachsen Mathilda übersinnliche Fähigkeiten. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, sondern eine Ermunterung zum Lesen ausgesprochen.
Im Gegensatz zum Zufallsgrün ihrer Prosa hat Marion Poschmann in dem Gedichtband Nimbus eine wahre Feier jener Farbe ausgerichtet, die Goethe so sehr schätzte, dass er sie in seinem Arbeitszimmer fortwährend um sich haben wollte: Grün, allerdings in einer edel verhüllten, gräulichen Variante namens Seladon. Die Bezeichnung stammt von dem liebeskranken Ritter Céladon aus Honoré d’Urfés einst populären Schäferroman L’Astrée. Diesem Farbton widmet sie einen eigenen Zyklus von sechs »Seladon-Oden«. Sie schreibt: »süchtig nach jenem unhaltbaren Farbton, / ein zaubrisches Grau, das ins / Unbestimmte zu kippen beginnt, / sobald man sich nähert«. Damit wird eine Farbe romantischer Herkunft zum poetischen Nukleus.
Vor zwei Jahren – nach dem Erscheinen von Nimbus – besuchten wir gemeinsam die Münchner Ausstellung Seladon im Augenmerk. Jadegleiche Porzellane und ihre Meister:innen in Longquan, China. Inmitten der Porzellanschätze, deren grünliche Glasuren täuschend echt wie Wasser wirkten, spürte ich, dass mich Marion Poschmanns Gedichte ein anderes, neues Sehen gelehrt haben. Nichts ist ihr zu unscheinbar, aber auch kein Phänomen zu sperrig, um daraus nicht Poesie gewinnen zu können, eine Grundhaltung, die ebenso ihre Prosa prägt. Ihre Naturgedichte seien keine Erlebnislyrik, konstatierte sie selbstbewusst in einem Gespräch mit Sarah Kirsch anlässlich deren 70. Geburtstag im März 2005. Vielmehr entstünden sie in Berlin neben einer Großbaustelle, beim Lärm von Presslufthämmern.
Mischt man die Nicht-Farben Schwarz und Weiß, entsteht Grau: Die chromatische Programmmusik von Marion Poschmanns Schwarzweißroman erinnert an Alexander Skrjabins Farbenklavier und an das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch. Die namenlose Ich-Erzählerin hat gerade ihr Examen bestanden und befindet sich daher in einem existenziellen Schwebezustand. Über Moskau fliegt sie in die sagenumwobene Arbeiterheldenstadt Magnitogorsk im Ural, um ihren Vater zu besuchen. Mit anderen deutschen Ingenieuren arbeitet er im größten metallurgischen Kombinat der Welt. Vage geht es dabei auch um »Wiedergutmachung« für den Zweiten Weltkrieg.
In Magnitogorsk erwartet die Reisende, die eher eine Probandin ist, eine ermattende Symphonie von Grautönen. Die »zentrale Farbe des Ostblocks« verschluckt jede andere Nuance und damit jede Individualität, bis auf ihren roten Mantel mit Pelzbesatz. Im harmlosen deutschen Winter erschien er ihr kälteresistent und verleiht ihr jetzt, in einer Klimazone ganz anderen Kalibers, einen rührend-naiven Rotkäppchen-Touch. Wie der orientierungslose Franzose in Michel Butors Der Zeitplan büßt die westliche Beobachterin ihre Koordinaten ein. »Die Ränder der Dinge verwahrlosten«, heißt es mehrfach. Erst im letzten der dreißig Kapitel, die verheißungsvolle Überschriften wie »Methan Butan Propan«, »Heißmangel« oder »Himmlische Heerscharen« tragen, erst im Schlusskapitel »Terra incognita« ist es der Erzählerin vergönnt, einen Nachmittag »wie in einem Quadrat mit stabilen Begrenzungen« zu verweilen – eine Hommage an das ikonische Schwarze Quadrat. Am Ende verschwindet sie im Weiß des Schnees.
Mit dem Schwarzweißroman und seiner umfassenden Materialprüfung im Geiste der Romantik liegt das Negativ zum verhängnisvollen sowjetischen Entwurf des Neuen Menschen vor. Man könnte ihn und Die Sonnenposition am ehesten Marion Poschmanns historisch-politische Romane nennen. In beiden Texten lässt sie die Protagonisten eine ebenso umfassende wie faszinierende Analyse von Materialien und Ideologemen unternehmen. Die Sonnenposition vollzieht im Innerdeutschen eine West-Ost-Bewegung wie es der Schwarzweißroman in Richtung Russland tut.
In der Sonnenposition hat es einen jungen Bonner Psychiater nach Brandenburg verschlagen, in das sogenannte Ostschloss. Dort brennt des Nachts sinnlos Licht. Der 32-jährige Altfried träumt davon, ein Polarlicht zu sehen. Während der Mahlzeiten, die Ärzte und Patienten gemeinsam einnehmen, bröckelt durch die Erschütterungen im Saal die Dekoration von der Decke – eine vielstrahlige Sonne aus Stuck. Schwer hat der »praktizierte Sozialismus« mit seinem Fortschrittsglauben dem einstigen feudalen Prachtbau zugesetzt. Die Besucherin in Magnitogorsk hingegen beklagt den »drückenden Idealismus« der konstruktivistischen Gebäude.
Altfried liebt seinen Beruf. Studiert hat er in der Psychiatrie-Hochburg Bonn. Im dortigen Park befanden sich einst »Tobezellen«, in denen motorisch unruhige Patienten gefesselt wurden, wenn nicht gerade ein Zwangsbad anstand. Altfried resümiert: »Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Friedrich Nietzsche – alle fähigen Personen, die mit Bonn in Kontakt kamen, endeten bekanntlich in völliger Zerrüttung.« Mit solchen ironischen Seitenhieben auf das fröhlich bis sentimental in sich ruhende Rheinland entwirft die Essenerin eine Art negativen Heimatroman.
Altfrieds Vater hat ein furchtbares Vertriebenen-Schicksal erlitten, doch der Sohn will von den einstigen Ostgebieten nichts wissen. Dennoch spürt er die historische Belastung der Enkelgeneration. Marion Poschmann hat selbst ostpreußische Familienbezüge. Oft handeln ihre Gedichte von Randzonen und Körpern als »Depots der Geschichte«. Nun kommt die rätselhafte Verbindung von Materie und Licht hinzu.
Transparent bis transluzent: Wie die große polnische Dichterin Wisława Szymborska hegt Marion Poschmann ein Faible für Wolken. In jedem ihrer Texte sind sie präsent, als dunkel drohender Nimbus oder als harmloser Kaffeedampf, der sich als »Porzellanwolke mit hohem Schweif« in der Luft manifestiert. Die Wolken, so Wisława Szymborska in ihrem gleichnamigen Poem, seien nicht verpflichtet, mit uns zu vergehen, sondern: »Sie fließen, ohne dass wir sie sehen«.
In ihrer Vorlesung Wappentier Qualle – zur Poetik des Bildes an der Berliner Freien Universität hat die Preisträgerin die vielgestaltigen durchsichtigen Quallen gewürdigt. Die Wolken, erläutert sie, seien stofflich nichts anderes als Medusen der Luft. Mehr Transparenz geht kaum, außer vielleicht in jenem rätselhaften »Güterzug aus wasserfarbenem Plastik«, von dem Fujiwara Akiko in einem Gedicht spricht. Marion Poschmann hat es kürzlich für eine von ihr mitherausgegebene Anthologie japanischer Dichtung der Gegenwart übersetzt. Deren Titel lautet Eine raffinierte Grenze aus Licht. Diese Grenze steht zwischen dem Transparenten und dem Opaken, zwischen dem unermüdlichen Erkenntnisinteresse der Autorin und dem Resträtsel der Materie.
Liebe Marion, gäbe es einen wasserfarbenen Blumenstrauß, ich würde ihn Dir hiermit überreichen. Herzlichen Glückwunsch zum Joseph-Breitbach-Preis!