Es wäre wohl übertrieben zu behaupten, wer Adornos Uromi kennt, der kennt den ganzen Adorno. Schließlich ist es ein Text, der bequem auf eine Normseite passt. Der ganze Adorno dagegen füllt immerhin zwanzig Bände Gesammelte Schriften, die jeweiligen Teilbände nicht eingerechnet. Andererseits: Selten hat der Philosoph und Kulturkritiker Adorno sein Werkzeug auf engstem Raum so sichtbar gemacht und wohl ebenso selten mit solch gewaltigem Waffenarsenal auf einen so kleinen Spatzen geschossen wie hier: Uromi.
Die Ärmste, möchte man fast denken. Unsere liebe, sehr alt gewordene Urgroßmutter. Gerade verstorben und von der trauernden Familie in der Todesanzeige liebevoll als »Uromi« angezeigt. In welchem Blatt die Anzeige stand, wissen wir nicht. Vielleicht in der FAZ? Immerhin stammt Adornos Text aus dem Jahr 1967, da hätte er sehr gut beim Frühstück im Frankfurter Westend in der FAZ lesen und die Anzeige entdecken können. Gegebenenfalls im Regionalteil, denn im überregionalen Teil wird eher vornehm gestorben.
Normalerweise würde der bürgerliche, gebildete Zeitungsleser die Rede von der Uromi milde lächelnd zur Kenntnis nehmen und dann schnell Richtung Feuilleton oder Finanzen weitereilen. Nicht so Adorno. Adorno reagiert idiosynkratisch und bekommt eine Art Wutanfall, dessen Energie schließlich in einen kritischen Kommentar umgeleitet wird.
Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen der Lektüre der Todesanzeige und der Niederschrift des Essays vergangen ist. Die begriffliche Verve, mit der Adorno gegen diesen Fall rhetorischer Biederkeit einschreitet, und das schwere terminologische Geschütz, das er auffährt, lassen vermuten, dass der Text unmittelbar im Anschluss entstanden sein muss.
Wobei der sprachliche Sachverhalt, das Symptom, noch einigermaßen ruhig diagnostiziert wird: »Uromi war die Großmutter. Man hatte das idiomatische Omi, für Großmama, um eine Generation erweitert.« Was peinigend genug sein kann für einen Denker des Nichtidentischen. Aber was bedeutet diese Erweiterung des idiomatischen Omi um eine Generation genau? Es versetzt die Omi »ins barbarisch Wilde oder in industrielle Reklame, beides gleich grausig …« Das Wort Omi wird als Uromi zudem zur »Grimasse«, »der infantile Kosename wird zur Maske von Unheil«.
Ist es unangemessen, wenn der überraschte Leser hier zurückfragt, welches Unheil denn damit gemeint sei? Man kommt nicht umhin, an die Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu denken. Will Adorno uns daran erinnern? Wahrscheinlich ja. Seine ganze Philosophie ist schließlich eine Erinnerung daran. Aber wir belassen es an dieser Stelle bei der Frage. Sie ist in gewisser Weise zu groß, wie der Zugriff Adornos hier insgesamt überdimensioniert erscheint. Die Uromi der Todesanzeige scheint dem Philosophen geradezu in die Glieder gefahren zu sein, und er sucht sie mit seiner ganzen kritischen Begriffsmacht und dialektischen Intelligenz abzuschütteln: »Der vergebliche Versuch, sie ins fragwürdige Leben der Familie zurückzurufen, verwandelt sie in ein Totes schon zu ihren Lebzeiten.« Darüber wäre ebenfalls länger nachzudenken. Und natürlich auch über den Satz, der nun folgt. Er ist der apodiktischste des ganzen Essays: »Die Uromi ist ein prähistorisches Monstrum.«
Prähistorische Monstren werden durch die Vorsilbe »Ur-« gebildet. Und sie neigen dazu, uns auffressen zu wollen. Während Omi uns lieb hat, verschlingt Uromi uns. Uromi ist also nicht die positive Steigerung von Omi – noch älter, noch lieber, noch großmütterlicher –, sondern der Umschlag ins barbarisch-bedrohliche Gegenteil davon.
Die Vorsilbe »Ur-« hatte Adorno schon einmal, fünfunddreißig Jahre früher, zu einer Glosse mit eben dem Titel Der Ur angeregt. Darin entdeckt er in einer nicht näher benannten Zeitschrift, »die auf gute Manieren hält«, einen Artikel, bei dem es sich um eine Apologie des Urmenschen in uns handelt. So heißt es in dem Artikel beispielsweise: »Die urtümliche Welt, der urtümliche Mensch sind aus ihrem Schlafe erwacht.« Das erinnert an den Gottfried Benn der dreißiger Jahre, an seine »Gehirne[…] mit Eckzähnen«, oder auch an den Ernst Jünger der damaligen Zeit. Aber es ist zugleich eine über einzelne Autoren hinaus verbreitete intellektuelle Stimmung, die hier anklingt, ein vitalistischer Zeitgeist.
Adorno nennt in der Glosse darum auch keine Namen, ihm geht es um das Symptomatische, denn die in dem Artikel geäußerte Sorge, »daß der Urmensch in uns fortbestehen möge«, und »die Freude, daß er sich so kräftig regt«, münden in einer Utopie, in der sich Urtümlichkeit und technische Moderne vereinen: Der Urmensch wird hier mit dem »Flieger« zusammengebracht. Moderner Mensch und Urmensch werden eins, und Archaik ist zugleich Aufbruch: »Wo der Ur grast, ist der Aufbruch nicht weit«, resümiert Adorno, und dieser Aufbruch hat, wie wir wissen, in die Katastrophe geführt.
Möglicherweise hat die begriffliche Wut, die Adorno gegen die so harmlose Todesanzeige aufbringt, hier ein Motiv. Die zufällige Lektüre hat offenbar aus dem Stand heraus seine ganze Verachtung gegen jedes ursprungsmythische Denken mobilisiert, denn dieses hat, wie wir wissen, in der Tat Anteil an dem Unheil, welchem das »Uromi« der Anzeige die kindlich-familiale Maske aufsetzt.
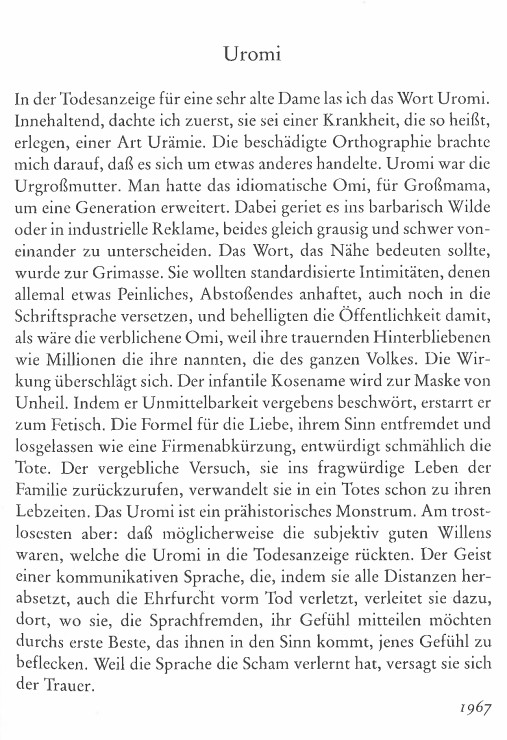
In: Theodor W. Adorno – Gesammelte Schriften 20.2: Vermischte Schriften II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1986, S. 571

















