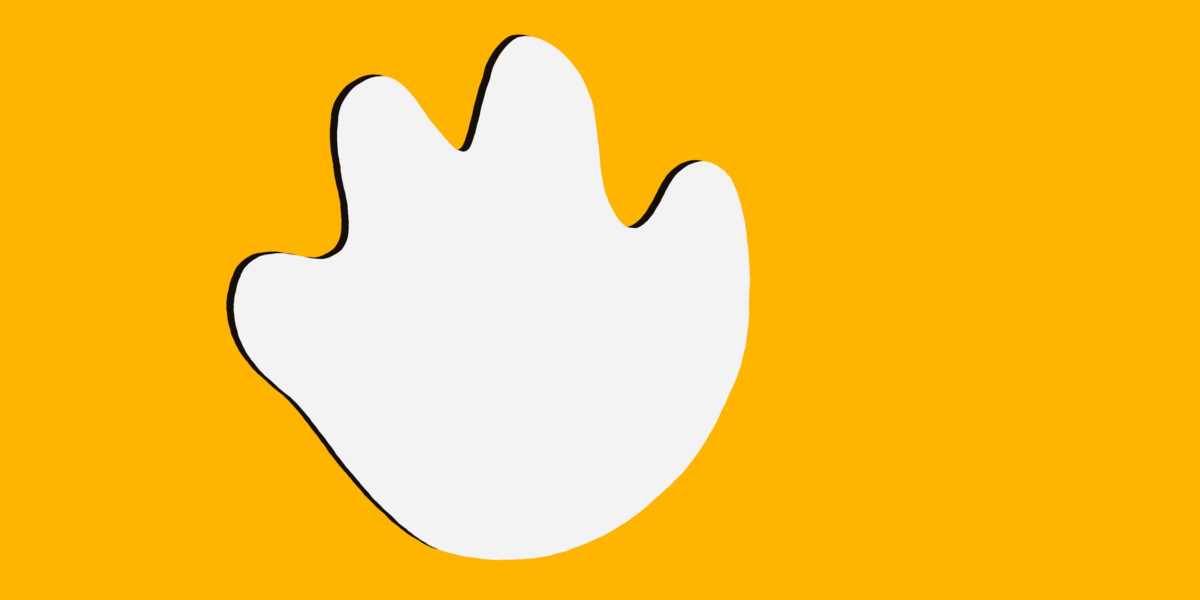»Also fahren wir«, sagt am Anfang meines neuen Romans Benzin Vinz, die Hauptfigur, zu seinem Lebensgefährten Alexander. Die Worte, die eigentlich eine Frage sein sollen, brechen ihm beim Sprechen weg. Die beiden stecken in einer Beziehungskrise, und zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass die bevorstehende Reise nach Südafrika schwerwiegende Folgen für sie haben wird. »Aber dann richtig, sagte Alexander. Sie gingen jeder in sein Zimmer, den Koffer packen.«
Für eine Tour ins Gebirge packt man Wanderschuhe ein. Leichte Kleidung für tropische Temperaturen auf der Südhalbkugel der Erde. Wasserfestes Equipment, wenn man eine Paddeltour plant. Medikamente zur Behandlung von Reisekrankheiten, Immodium, ein Breitbandantibiotikum, Malariaprophylaxe. An all das hatte ich gedacht, schließlich sollte mich meine Recherchereise in die Hochlagen der südafrikanischen Drakensberge führen und in die schattenlosen Buschsavannen Simbabwes, und was mich auf der sechstägigen Kanufahrt auf dem Sambesi erwartete, konnte ich nur mit Herzklopfen erahnen: eine erbarmungslose Sonne zum Höhepunkt der Trockenzeit, Stromschnellen, Tsetsefliegen. Gegen die Schlafkrankheit gibt es kein wirksames Medikament, wohl aber gegen Schlaflosigkeit, wie sonst soll man in einem von Krokodilen und Flusspferden umlagerten Zelt nachts Ruhe finden? Am meisten Sorge bereitete mir eine Gefahr, gegen die ich keinerlei Vorkehrungen treffen konnte: Von meinem Roman standen etwas mehr als hundert Seiten, kurz vor meinem Aufbruch hatte ich das Kapitel beendet, in dem die Protagonisten Vinz, Alexander und Unami die Grenze zwischen Südafrika und Simbabwe passieren. Es war ein aufreibender Trip durch die Hölle afrikanischer Grenzbürokratie, nun stand ich mit den dreien auf der staubigen Straße von Beitbridge – und kannte ihr Ziel nicht.
Die letzte Unterkunft hatte ich in Victoria Falls gebucht; die weltgrößten Wasserfälle und der gigantische Abenteuerspielplatz, in den der Tourismus diesen Ort verwandelt hat, jene tiefe, vom Sambesi wütend durchschäumte Kluft, die sich dort zwischen Mensch und Natur, Mensch und Mensch auftut, sollten die Schauplätze des Romanfinales sein – ein Sturz vom Rand unserer globalisierten und widersprüchlichen Welt ins Ungewisse. Zwar war damit die Richtung für meine Figuren vorgegeben, doch ich wusste nichts von ihrem Weg, und wesentlich beunruhigender als die politische Lage in Simbabwe und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts war die Aussicht, in diesem Land nichts zu finden. Nichts, was meinen Roman voranbringen würde.
Die Bergschuhe und die UV-Schutzkleidung habe ich gebraucht, auch das Immodium. Die Badehose hingegen blieb trocken, Abkühlung im Sambesi war trotz schwülheißer 43 Grad verboten, wegen der Krokodile. Auch die Schlaftabletten blieben unangetastet. Ich wollte nämlich gar nicht schlafen, nachts auf den Inseln mitten im Fluss, erschöpft vom stundenlangen Kampf mit dem Paddel gegen die Unwägbarkeiten des großen Stroms. Ich wollte sehen, hören, fühlen, mir das Zischeln der trockenen Schilfgräser ins Gedächtnis brennen, die dunkle, zwischen Wehklagen und Hohngelächter schwankende Tonart der Flusspferdlaute (g-Moll?), das unablässige Murmeln des Flusses, kaum drei Meter vom Zelt entfernt, dann plötzlich weit weg, wie aus den Tiefen eines Traums. Doch ich schlief ja nicht und konnte also nicht träumen. Mein Körper war in heller Aufruhr, noch nie hatte ich Wahrnehmung als so schmerzhaft empfunden in ihrem verzweifelten Festklammern an die menschliche Sprache, an meine Sprache als Schriftsteller. In einer Finsternis, die den Lichtstrahl der Taschenlampe einen Meter von der Hand entfernt bereits vollständig verschluckte, zogen Satzfetzen vorüber, doch ich war zu sehr mit mir selbst und meinen Unzulänglichkeiten beschäftigt, um sie einzufangen und in meine Kladde zu notieren, als Rohmaterial für die spätere Niederschrift des Romans. Worte waren im Allgemeinen auf dieser Reise sehr klein, und auch auf die anderen Medien, die mich in meinem Wahrnehmen unterstützen sollten, war wenig Verlass. Auf keinem der mit nach Hause gebrachten zweitausend Fotos war es mir gelungen, die Sonne festzuhalten, die mittags im Norden stand und die Vinz auf jedem seiner Wege einem Gefühl fundamentaler Orientierungslosigkeit aussetzt. Keine Sequenz aus dem stundenlangen Videomaterial konnte die Farbe des Sambesi wiedergeben, sein warmes, seltsam dickliches Wasser, wie Blut, würde ich später schreiben, denn tatsächlich kam mir dieser Strom verwundet vor, aufgerieben von den Wasserfällen und den Schluchten, durch die er sich zwängen muss, misshandelt vom Kariba-Staudamm, einem der größten der Erde, der ein ganzes Volk in seinen geistigen und spirituellen Beziehungen zu ihrem Fluss grundlegend verletzt hat. Auf den Mythos des Sambesi-Gottes war ich im Internet gestoßen, nun fand ich ihn festgeschrieben auf einer Schautafel des Tonga-Museums in Binga, einer künstlichen Siedlung an den verdorrten Ufern des Stausees, wo man das umgesiedelte Flussvolk, las ich im Bericht eines Zeitzeugen, »wie Müll ausgekippt« hatte. Die zivilisationskritische Legende war mir nur auf Englisch zugänglich, in der ehemaligen Kolonialsprache, und ich ahnte, dass in der mündlichen Überlieferung, die sie hervorgebracht hatte, noch ganz andere Bedeutungsebenen anklangen – welche, das wusste ich nicht, doch ich spürte deutlich die Diskrepanz. Der Flussgott, von der Tourismusmaschine in Victoria Falls zum Souvenir degradiert, war aus seiner eigenen Geschichte verschwunden, die in dieser schriftlichen, der Welt zugänglichen Form erst seit dem Bau des Dammes in den 1950er Jahren existiert, poetisches Beiwerk eines kolonialen Großprojekts, ein zu Folklore erstarrtes Märchen mit einem darin gefangenen Schrei. Im Roman, so viel stand fest, würde Vinz sich auf die Suche nach dem Aufenthaltsort dieser mythischen Figur machen, besessen von der Idee, zu einer neuen Sprache zu finden, die nicht nur seine Liebesbeziehung retten soll, sondern ihn, den Schriftsteller, vorm Sturz in die Bedeutungslosigkeit seines Wirkens.
Aber wie dokumentiert man das? Was sollte ich in diesem Land recherchieren? Ich hatte mir kein Thema gestellt, sondern eine existenzielle Falle. Mein Englisch, in dem ich mich einigermaßen sicher glaubte, wurde auf dieser Reise porös. Die Worte zerbröselten mir im Mund, was ich sagen und fragen wollte, kam mir hohl vor, phrasenhaft. Ich stammelte meine Anliegen hervor, hatte Schwierigkeiten, mich zu verständigen und meine Gesprächspartner zu verstehen, für die Englisch, die offizielle Landessprache von Simbabwe, auch eine Fremdsprache ist. Und wie dieses Gefühl benennen, als eines Morgens während der Kanutour, mein Begleiter und ich krochen gerade aus unseren Zelten, der Fluss beinahe an unseren Füßen leckte? Die Boote, die wir am Abend zuvor an Land gezogen hatten, waren abgetrieben, die Insel, auf der wir kampierten, zu einer Sandbank geschrumpft. In der Nacht hatte man am hundert Kilometer flussaufwärts gelegenen Staudamm, wo zu jener Zeit umfangreiche Sanierungsarbeiten stattfanden, Wasser abgelassen. Für solche Fälle gebe es ein Warnsystem, bemerkte unser Guide beiläufig, aber das funktioniere nicht immer. Im angeschwollenen Fluss grunzten die Hippos.
Rückblickend ist in den Wirren dieser Reise eine Empfindung besonders scharf: das Unbehagen, dass es in solchen Momenten nichts Unnützeres gab als all die mitgeschleppten Sicherheiten in meinem Gepäck und in meinen Erinnerungen nichts Fremderes als mich selbst. Jener Andere in mir, den ich zur Hauptfigur meines Romans machte und, weil es keinen Ort für ihn gab, auf eine Reise ans Ende der Sprache schickte, konnte erst lange nach meiner Rückkehr im Schreiben gebannt und durch die Korrektive des Erzählens in einen Menschen verwandelt werden. Die Protagonisten sind schon weit in ihrer Geschichte vorgedrungen, als Vinz seiner Entfremdung von Alexander in seinem Tagebuch Ausdruck verleihen will und dabei einen tiefen Widerwillen, ja eine Art Ekel vor seiner eigenen Sprache empfindet: »als müsste er mit bloßen Händen einen Kadaver anfassen, der zu großen Teilen bereits verwest war«.
Im Roman findet die hier beschriebene Flussfahrt nur in Vinz’ Erinnerung statt, sie ist abgestorbenes, vom Notmittel des Schreibens wiederbelebtes Material und doppelt verfremdet, im Zerrspiegel der Figur und in meiner eigenen Wahrnehmung – nur so konnte ich überhaupt literarisch verarbeiten, was an der Oberfläche der Sprache nichts weiter war als ein Safari-Trip, mit den Wildtieren, für die man bezahlt. Mein Smartphone wurde mir übrigens, anders als der Roman einen glauben lassen mag, nicht geklaut, und das Gefühl, aus diesem armen Land wesentlich reicher zurückgekehrt zu sein, als ich zuvor dorthin aufgebrochen war, war ein Schriftstellerglück mit einem dunklen, irgendwie fauligen Kern – der Scham.
Das Notizbuch habe ich dennoch gut gebrauchen können. Nicht nur, dass Zera, der River Guide, jene Sätze hineinnotierte, halb Befehl, halb Beschwörung, mit denen er die Flusspferde dazu brachte, den Weg freizugeben, wenn ein Rudel im Wasser jedes Weiterkommen unmöglich machte. Sein Hippo Talk floss später im Originalwortlaut auf Shona und auf Englisch in den Roman ein. Auch kenne ich jetzt die korrekten Bezeichnungen diverser einheimischer Bäume und Pflanzen an den Ufern des Sambesi: Shaving Brush Combretum, Bob Marley Tree, Sterculia Africana, ein für den Roman unnützes Wissen, denn Vinz, der ahnungslose Tourist, kann diese Namen ja doch nicht kennen; ihm bleiben zur Beschreibung der afrikanischen Vegetation, die an ihm vorüberzieht, Akazie, Baobab und unbestimmte Büsche. Kaum literarisch verwertbar auch die nächsten Seiten im Notizbuch mit den Additionen und Subtraktionen des Reisebudgets, die immer zum gleichen Ergebnis kamen: Mir drohte das Bargeld auszugehen, in einem Land ohne Bankautomaten. Auf einer Seite steht in fremder Handschrift: sawubona – single, sawibona – plural, ich erinnere mich beim besten Willen nicht mehr, wer diese Worte in meine Kladde notiert hat und zu welchem Zweck.
Die letzte Seite ist eine Liste der Namen jener Menschen, die mir auf meiner Reise ihre Kontaktdaten aufschrieben, Handynummern, die heute zum Teil nicht mehr aktiv sind oder damals schon nicht existierten: Innocent, Clever, Rudo, Charity, Ngoni. Von denen, die mir heute noch Nachrichten schreiben, weiß ich, dass die Menschen in Simbabwe auch nach Robert Mugabes Rücktritt im November 2017, drei Wochen nach meiner Rückkehr nach Deutschland, nicht aufhören wollen, auf Veränderung zu hoffen. Sie alle haben ihren Auftritt im Roman, wenn auch nicht als sie selbst, sondern als Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache, einer Begegnung.
Zu Hause habe ich alle Fotos und Videos auf eine Festplatte geladen und gewissenhaft archiviert, um langes Suchen zu vermeiden, in jenen Momenten, wenn ich beim Schreiben auf die Vergegenwärtigung meiner Erinnerungen angewiesen bin. Fast nichts aus dieser Materialsammlung habe später noch einmal angeschaut. Nach fünf Wochen und fast sechstausend in Südafrika und Simbabwe gefahrenen Kilometern befand ich mich am gleichen Punkt wie vor meiner Abreise, und auch meine Figuren standen noch immer am Rand des Grenzortes Beitbridge auf der staubigen Straße, die nach Norden führte, und sahen mich erwartungsvoll an. Ich zuckte hilflos mit den Schultern und bat sie, ins Auto zu steigen. Dann schrieb ich das Ende des Kapitels neu: »Alexander, Unami und Vinz. Sie fahren abwechselnd, der Sonne entgegen in ein Land, das neue Namen braucht.«