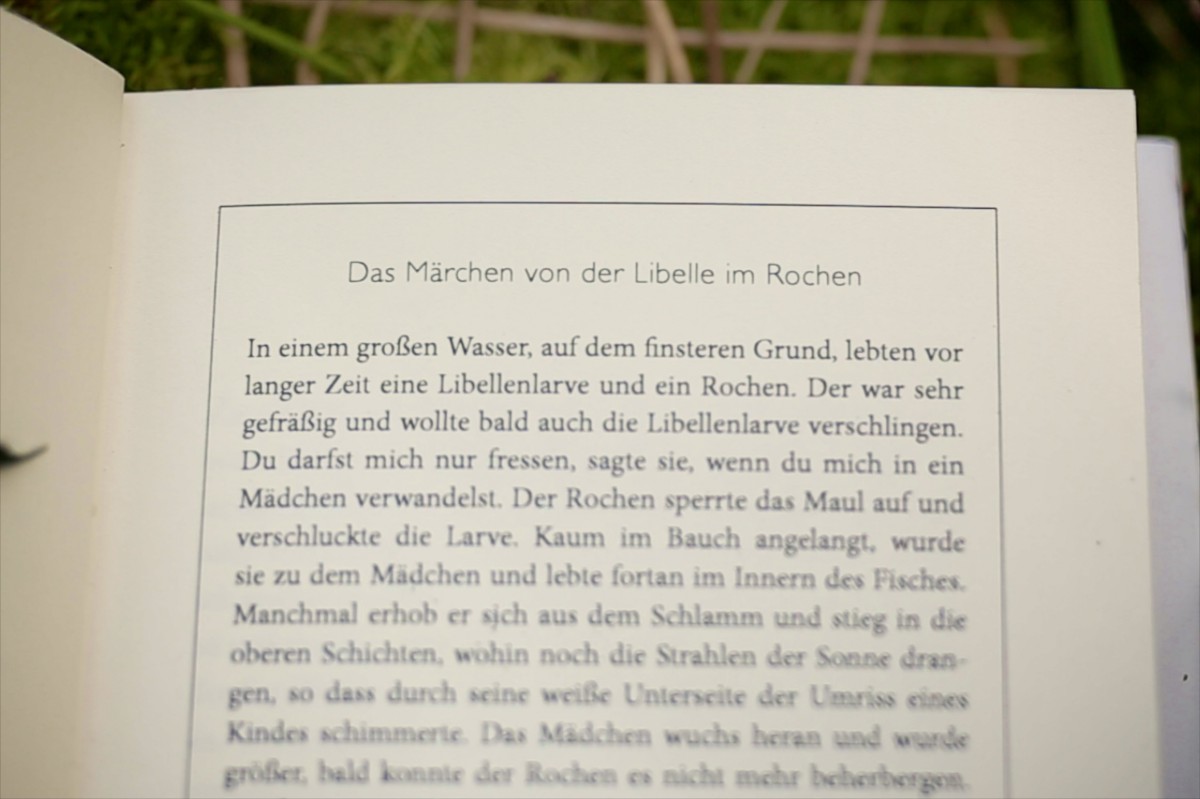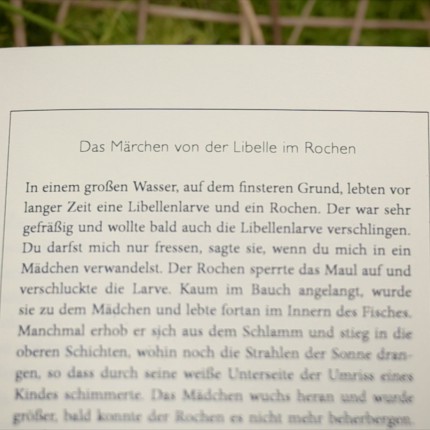Das Jahr der Libelle
zwei. Winter

Gunther Geltingers Roman Moor ist im September im Suhrkamp Verlag erschienen.
All unser Sehnen gilt in der dunklen Jahreszeit dem Frühling, und keine andere Jahreszeit erscheint dem Mitteleuropäer so lang wie der Winter. Dabei hat nach dem Gregorianischen Kalender der Sommer 92 Tage, der Winter auf der Nordhalbkugel bringt es nur auf 89. Dennoch ist der Sommer meist »schon wieder vorbei« oder »gar nicht erst gekommen«. Schneit es noch an Ostern, vermisst man in den Rabatten die Narzissen, Botinnen des Frühlings, Symbol für das Ende des Wintergrübelns, eines unproduktiven Gefangenseins in der eigenen Haut. (In Ovids Metamorphosen allerdings erkennt Narkissos beim Blick ins Wasser die Unerfüllbarkeit seiner Liebe, ohne dass diese Erkenntnis ihn von seinen Qualen erlöst. Er verzehrt sich vor seinem eigenen Ebenbild zu Tode. Die Baumnymphen am Teich finden statt seines Leichnams eine Narzisse, sie verströmt einen betäubenden Duft).
Der Sommer ist unser Fernweh, der Winter die Heimat. Wartend verbringen wir fast unser ganzes Leben in ihm, hoffend auf ein besseres Leben, anderswo und als jemand anderes. Die Libelle entwickelt sich im Wasser, je nach Art dauert ihr Larvenstadium vierzig Tage bis fünf Jahre, und wenn die Begriffe Jugend, Adoleszenz und Alter überhaupt auf die Lebensabschnitte des Insekts zutreffen, verbringt es seine ganze Kindheit im kalten Winterdunkel des schlammigen Grunds.
Die Libelle und ihre Larve sind zwei unterschiedliche Tiere. Die Libellenlarve atmet durch Kiemen, die Imago, das ausgewachsene Tier, besitzt Lungen. Libellen fliegen, ihre Larven hingegen bewegen sich mit den Beinen auf dem Grund oder indem sie das Wasser aus ihren Kiemen schwallartig ausstoßen und so durch den Rückstoß nach vorne schnellen. Imagines fangen die Beutetiere mit den Vorderbeinen aus der Luft, die Larven hingegen räubern im Wasser mit der Fangmaske, die später, nach der letzten Häutung, die Mundwerkzeuge der Libelle bilden, die vor allem zum Zerkleinern der Nahrung dienen.
Diese optimale Anpassung an den Lebensraum hat die Libelle im Lauf der Jahrmillionen zu einem »perfekten« Insekt gemacht – sie beherrscht zwei Lebensräume gleichzeitig und zählt zu den widerständigsten und ältesten Insekten der Erde. Die Wechselwirkungen zwischen Innen und Außen sind aufs Feinste aufeinander abgestimmt – es ist dieser vollkommene Dialog zwischen dem Organismus und der Umwelt, eine Art Geheimsprache, die wir als archaisch und mythenbildend empfinden.
Der Mensch hingegen kann dieses wortlose Zwiegespräch mit der Natur durch Sprache zwar mimetisch abbilden, aber nie so verinnerlichen, dass die verschiedenen Stadien seines Lebens optimal an die Umwelt angepasst sind. Sprache verläuft asynchron zur physischen, geistigen und psychischen Entwicklung des Menschen, stets bildet sich zwischen dem Ist-Zustand des Innen und dem des Außen eine Sollbruchstelle. Darin entsteht Zeit und mit ihr die verwandelnde Kraft des Erzählens. Die griechischen Tragödien umreißen die elementaren Verwerfungen des menschlichen Daseins als Conditio humana. Der Mythos macht das individuelle Trauma allgemeingültig und nimmt ihm den Schrecken – Märchen spenden, so grausam ihre Handlung auch ist, Hoffnung und Trost. Das Erzählen des eigentlich Unfassbaren ist der Kern jeder Therapie, es kann den Gesamtschaden für das Individuum verringern, sollte entweder das innere (biologische oder psychische) oder das äußere (familiäre, soziale, gesellschaftliche) System kollabieren. Echo, die Bergnymphe, unterhielt im Auftrag von Zeus seine Gattin Hera mit Geschichten, damit er selbst Zeit für seine Liebesabenteuer hatte. Als Hera den Betrug entdeckte, raubte sie zur Strafe Echo die Sprache und verdammte sie dazu, fortan nur noch die letzten Silben des Gehörten zu wiederholen. Als Echo sich in den schönen Jüngling Narkissos verliebte, konnte sie ihm ihre Liebe nicht gestehen und trat ihm zur wortlosen Umarmung gegenüber. Narkissos aber, seinem eigenen Spiegelbild auf dem Wasser verfallen, verschmähte ihre Liebkosung. Echo zog sich in eine Höhle zurück, stellte das Essen ein und verzehrte sich in ihrem Unglück, bis sie nur noch Stimme war. Seitdem sprechen die unzugänglichen und menschenleeren Winkel der Natur, die einsamen Wälder, schroffen Berghänge und finsteren Schluchten, unsere Sprache. Aus der Leere zurück schallt unsere eigene Stimme. Universeller kann Trost kaum sein.