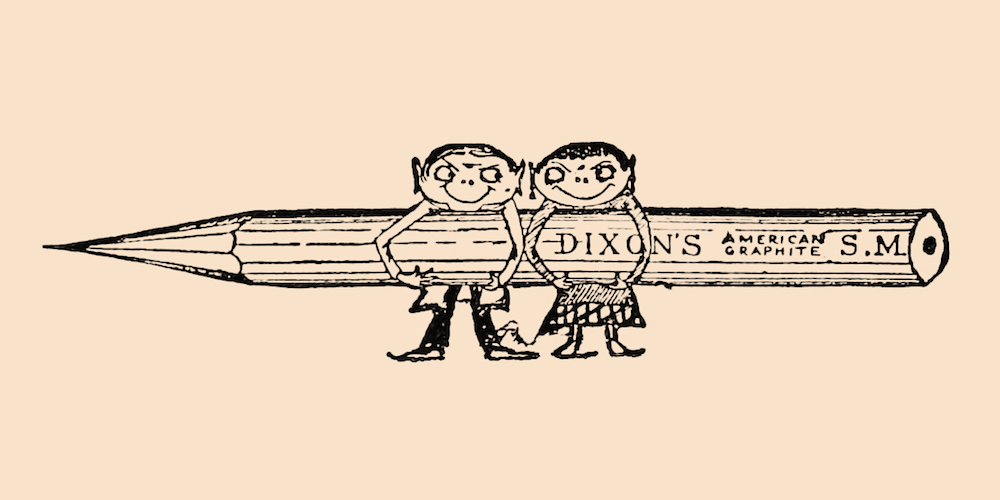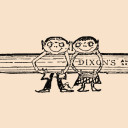In jener Zeit, als das Schreiben noch ein Wunder war, schnupperte ich an der Spitze jedes Bleistifts. Leicht metallisch, fast wie Blut. Am Anfang war das Ding. Und dem Ding wohnte ein Zauber inne, und wenn ich es zur Hand nahm, verwandelte ich mich in einen Zauberer.
Urplötzlich konnte ich kritzeln, obwohl ich es nie vorher geübt hatte.
Vermutlich ist es nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass der Bleistift der Schlüssel zu meiner Existenz als Schriftsteller war. Und ist. Eigenartig: Trotz aller anderen Schreibgeräte, mit denen ich im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte versucht habe, Gedanken, Empfindungen, Ideen, Träume sichtbar zu machen, kehre ich immer wieder zu einem gewöhnlichen Bleistift zurück.
Zur Zeit handelt es sich um den Dixon Ticonderoga. Made in Mexico. Black Graphite, Point for Smooth, Easy Writing. Angeblich der beste Bleistift der Welt, steht drauf. Kann ich nicht beurteilen, mir mangelt’s an Vergleichen. Was ich jedoch feststelle: Er schreibt sich wie von selbst, weich und schwungvoll. Und der rosafarbene, runde Radiergummi am hinteren Ende funktioniert astrein. Angeblich existiert die Herstellerfirma seit 1795. Respekt! Die Spitze riecht genau wie früher, und den Spitzer, den ich benutze, habe ich tatsächlich aus der Schulzeit herüber gerettet. Keine Ahnung, warum er nie verloren ging, ich bin zehn Mal umgezogen und warf jedes Mal eine Menge Zeug in den Müll, vor allem Schulsachen. Der Spitzer hat sich durchgemogelt. Allein wegen ihm sollte ich meinen nächsten Roman mit der Hand schreiben, mit dem Dixon Ticonderoga.
Warum mache ich das eigentlich nicht? Weil ich mittlerweile generell wenig mit der Hand schreibe? Stimmt nicht. Fast alle meine Recherchen, Notizen und Skizzen KRITZELE ich mit einem Kugelschreiber auf winzige karierte Blocks und übertrage das Wenigste davon in den Computer. Meine Handschrift gehört mir. Manchmal staune ich, dass ich die seltsamen Gebilde überhaupt noch enträtseln kann. Bei einem meiner jüngsten Romane schrieb ich ganze Kapitel mit der Hand, im Zug, im Hotel, im Gasthaus irgendwo auf einer Lesereise. Das war dann die erste Fassung, und als ich sie abtippte, machte ich einige Korrekturen, und das Kapitel blieb so bis zur Drucklegung. Ich brauchte es kein drittes oder viertes Mal zu schreiben – wie sonst, wenn ich den Text gleich in den Laptop haue.
Auch so eine Besonderheit: Beim Tippen hauen meine Finger auf die Tasten, als trügen sie einen Kampf auf Leben und Tod aus. Beim Schreiben mit der Hand dagegen entwickeln sich die Sätze aus einem friedvollen Fließen heraus, beinah geräuschlos. Natürlich muss ich regelmäßig mein Handgelenk ausschütteln, wie einst in der Schulbank, aber auch diese Geste erinnert mich in ihrer Vertrautheit an meine Anfänge als Schreiber, an meine ersten Schritte auf Papier, an den Beginn der wunderbaren Freundschaft zwischen meiner Fantasie und ihrer Synchronstimme, dem Alphabet.
Doch schon als Vierzehnjähriger wurde mir klar: So kann’s nicht weitergehen, es muss ein neues Werkzeug her, die Stifte reichen nicht mehr aus für einen, der ein Schriftsteller sein oder erst mal einen darstellen will. Ich brauchte eine Maschine. Und zwar eine eigene, nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Transportieren. Schließlich würde ich eines Tages unterwegs sein, in einem Hotel leben, in einem Wohnwagen, in einer Absteige in der schlecht beleuchteten, zwielichtigen Peripherie einer Großstadt, aus der ich meine Storys sauge, den Nektar meiner Autorenexistenz.
Meine Mutter besaß einen alten Kasten, den man aufklappen konnte, dann kam eine Schreibmaschine zum Vorschein. Diese war sauber geputzt und sah aus wie unbenutzt. Schon mal schlecht. Trotzdem schrieb ich ein paar Sachen darauf, Gedichte, Kurzgeschichten, Sätze, die nur deshalb aufs Papier kamen, weil ich das Tippen so überragend fand. Ich schrieb mit meinen beiden Zeigefingern, mit sonst keinem. In Büros staunte ich über Sekretärinnen, deren zehn Finger über die Tastatur sausten und nie ihr Ziel verfehlten, und wenn doch, trocknete das Tippex schneller als ich einmal blinzeln konnte. Faszinierend. Und in keiner Weise inspirierend.
Vom ersten Moment an hielt ich mein System für das beste. Zwei Finger mussten genügen. Zumal ich überzeugt war, dass alle wahren Schriftsteller niemals in ihrem Leben eine Sekretärinnenausbildung absolviert und dieses total übermotivierte Zehnfingersystem erlernt hatten (damals benutzte ich statt des Wortes übermotiviert das viel treffendere Wort bescheuert).
Zwei Finger waren genug, um eine Welt zu erschaffen.
Aber ich hatte noch immer keine eigene Maschine. Niemand gab mir Geld für so eine Anschaffung. Was, schreiben? Was denn schreiben? Ist ja lächerlich. Mach deine Hausaufgaben, und dann hilfst du mir im Haushalt. Gedichte schreiben will er!
Also suchte ich mir einen Ferienjob. Ich kellnerte. Das hatten schon mein Großvater und meine Großmutter getan, und aus irgendeinem Grund fand ich die Arbeit für einen angehenden Autor angemessen. Und wie es der Zufall will, traf ich in dem Restaurant einen Kellner, der heimlich einen Roman geschrieben hatte. Den Titel weiß ich bis heute, Kinderkrieg im Gurkenland. Weil ich ihm von meinen eigenen Arbeiten erzählt hatte, ließ der Mann mich das Manuskript lesen. Es gefiel mir, die Geschichte handelte von Erlebnissen eines Jungen im Krieg, die Bilder waren plastisch und die Sätze klar und anschaulich. An manchen Stellen schlug ich dem Autor Verbesserungen vor, und er bedankte sich. Den Roman hatte er auf einer Schreibmaschine ordentlich getippt, und jetzt schrieb er mit der Hand die Korrekturen hinein, was ich professionell und cool fand. Immer wieder habe ich im Lauf der folgenden Jahre Ausschau nach dem Buch gehalten, fragte Buchhändler danach, suchte im Internet – keine Spur. Vielleicht ist es nie erschienen, vielleicht unter einem anderen Titel, aber auch der Name des Autors war nirgendwo zu finden.
Ich denke oft an ihn, an das geheime Manuskript in dem kleinen Zimmer, das zum Restaurant gehörte, an die Ernsthaftigkeit, mit der er über den Roman sprach, an sein Lob für meine unfertigen Geschichten und Theaterstücke. Wir waren beide Papierarbeiter und Kellner, eine perfekte Kombination, wenn man vom Schreiben nicht leben kann und gern unter Menschen ist, zumindest ab und zu.
Schließlich hatte ich das Geld zusammen. Ich fuhr in die Kreisstadt, wo ich zur Schule ging und mich in den einschlägigen Geschäften bereits umgesehen hatte, und kaufte mir meine erste eigene Schreibmaschine. Eine Olympia Monica in grün, wahlweise mit rotem oder schwarzem Farbband und großen kräftigen Typen, auf denen meine zwei Zeigefinger bloß so herumturnen konnten. Ein Prachtstück. Ich nahm noch einen Stapel Papier mit, dann schloss ich zu Hause die Tür meines Kinderzimmers und begann, meinen ersten Roman zu schreiben. Auf Seite fünf kam ich ins Stocken und auf Seite sechs war Schluss. Egal. Von nun an hatte ich meine Grundausstattung. Und auch wenn die Monica als Reiseschreibmaschine etwas schwer und unhandlich war, machte sie mich augenblicklich zu einem Handelsreisenden in Sachen Literatur. Wo immer ich hinkäme, man würde mich sofort erkennen.
Zwanzig Jahre lang schrieb ich jeden persönlichen Text, jeden Vers, jede Strophe eines Liedes, das ich komponierte, jede Story und ungefähr fünfzehn Anfänge eines Romans auf dieser Maschine. und das würde ich noch heute tun, wenn bestimmte Leute nicht den Computer erfunden und andere Leute mich gezwungen hätten, meine Manuskripte in Zukunft nur noch elektronisch abzuliefern.
Im Übrigen besaß ich inzwischen eine zweite, kleinere Maschine, eine Brother Deluxe in gelb, die hatte ich einer Freundin abgekauft für den unwahrscheinlichen Fall, dass meine Monica einmal schwächeln würde.
Ja, der Computer: Ist schon eine sagenhafte Erleichterung, dass man umstandslos Korrekturen vornehmen kann und nichts mehr ausschneiden und kleben muss, dass man in Windeseile Texte durch die Welt schicken kann, in allen erdenklichen Formaten. Dass man seinen eigenen Mist mit einem Fingertippen löschen kann. Und dass Textverarbeitung ein Kinderspiel geworden ist und einem alles Technische leicht von der Hand geht.
Schon schön.
Wieso muss Schreiben eigentlich leicht sein? Wieso muss das alles immer noch schneller gehen? Wieso ist das gut, wenn man vorher nicht mehr nachdenken muss, weil man weiß, dass man hinterher alles problemlos umschreiben kann? Unter uns: Ich fürchte, mein vergreister Toshiba und mein supermoderner Lenovo klauen mir auf vertrackte, undurchschaubare Weise meine Ur-Sätze. Das, was ich schreibe – so scheint mir – ist gar nicht das, was ich ursprünglich schreiben wollte, es ist nur eine Ansammlung von Buchstaben, die ich beim nächsten und übernächsten und überübernächsten Mal je nach Laune umstellen und durcheinanderwirbeln darf – wie ein Kind, das mit Legosteinen spielt und hofft, irgendetwas Bedeutendes würde schon dabei herauskommen.
Bin ich durch die Einführung des Computers zu einem Buchstabenverwalter geworden?
Schreibe ich nicht mehr, sondern tippe bloß noch? Betrügt mich mein Laptop um meine wahren Wörter? Ist das, was ich hier tue, eine neue Form des KRITZELNS?
Wenn ich den Laptop aufklappe, strahlt er mich an. In mehrfacher Hinsicht. Hat meine Monica nie getan. Die steht da und schaut mich herausfordernd an, die schleimt sich nicht ein, die fordert mich zum Duell, die leistet Widerstand und gibt niemals klein bei. Am Ende des Schreibens bin ich ausgelaugt, körperlich erschöpft – aber glücklich, nicht aufgegeben zu haben. Mein Lenovo stattdessen: grinst mich an, flüstert: Alles wird gut, entspann dich, mach dir keine Sorgen wegen der vielen Fehler und Ungereimtheiten, entsorge ich alles für dich, geht ganz easy, hol dir einen Cappuccino, ich schreib für dich weiter!
O Gott, ich höre Stimmen. Wo ist mein Bleistift? Ich muss dringend was notieren: MORGEN NEUES FARBBAND KAUFEN!