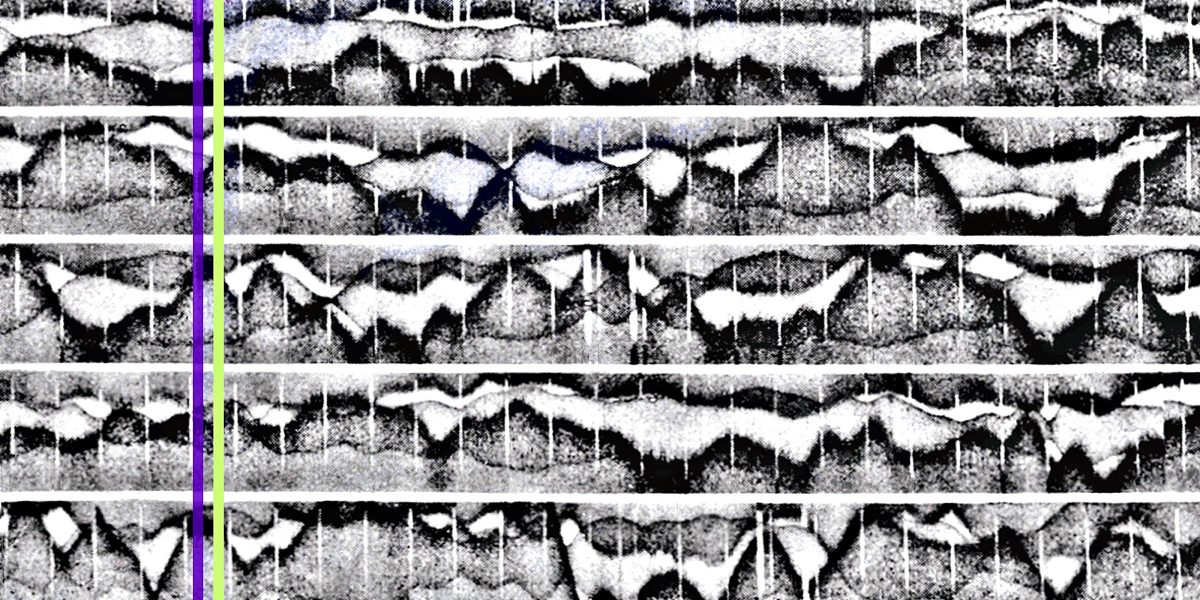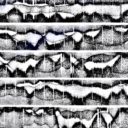1998 schrieb Rainald Goetz in seinem Weblog Abfall für alle (Weblog 1998/99, Buchpublikation 1999) von der »Steinzeit der elektronischen Welt«, in der man sich im Allgemeinen und er als Blogger im Besonderen befände. Diese »Steinzeit der elektronischen Welt« hat nicht nur Goetz, beispielsweise mit seinem Blog Klage (Weblog 2007/08, Buchpublikation 2008), hinter sich gelassen. Was der damalige Direktor des MIT Media Labs, Nicholas Negroponte, schon 1998, als Goetz noch an Abfall für alle schrieb, vorhersagte, ist eingetreten: Online zu sein, ist uns so selbstverständlich geworden wie Atmen und Trinken. Das Digitale ist banal geworden – oder wie Negroponte schon 1998 schrieb: »The Digital Revolution is over.«
Erregte zu Zeiten von Abfall für alle allein die innovative Publikations- und – in Hinblick auf die folgende Buchveröffentlichung – auch Produktionsplattform des Blogs Aufmerksamkeit, war das bei Wolfgang Herrndorfs ebenfalls aus einem Blog hervorgegangenem Buch Arbeit und Struktur (2013) nur noch eine Randnotiz. Sicherlich gibt es noch immer Experimente mit alternativen Produktions- und Publikationsformen wie Tilman Rammstedts Morgen mehr oder wie sie in den algorithmusbasierten Texten von 0x0a zu beobachten sind. Im Verhältnis zum Gros literarischer Publikationen ist in diesen Fällen aber von einer Avantgarde zu sprechen. Dabei haben nicht nur diese Texte in der Produktion mit Algorithmen und digitalen Produktionsmitteln zu tun. Wir können davon ausgehen, dass fast jeder Text, der heute gedruckt wird, parallel in einer digitalen Fassung veröffentlicht wird und in fast jedem Fall vor seinem Druck in einer solchen Version existiert hat. Ganz zu schweigen von der Rolle digitaler Hilfsmittel in der Produktion der Texte: Die Nutzung von Suchmaschinen und Online-Lexika ist Schriftsteller*innen in weiten Teilen der Welt nicht verboten. Insofern besteht der Unterschied zu den Projekten, die ihr Material unmittelbar durch Algorithmen generieren, nur graduell.
Verglichen mit Pionierprojekten wie Goetz’ Abfall für alle oder Kollektivarbeiten wie Null (online 1999, zugehörige Buchpublikation herausgegeben von Thomas Hettche und Jana Hensel 2000), kann man heute von einer zweiten Phase im Verhältnis von Literatur und Digitalem, sprechen. Eine Schilderung weiter Teile des alltäglichen Lebens ohne Bezug auf digitale Kommunikations- und Hilfsmittel ist unmöglich geworden. Diese Unmöglichkeit ergibt sich – »The Digital Revolution is over« – aus der Alltäglichkeit der von der Rede von der Digitalisierung begleiteten technologischen Innovationen. Diese Phase des Mediendiskurses wurde in anderen Kontexten – namentlich von Florian Cramer – als postdigital oder in Bezug auf bildende Kunst als post internet bezeichnet. Mit diesen Begriffsschöpfungen soll jeweils ausgedrückt werden, dass wir uns in einer Phase nach der Digitalisierung befinden. Die Banalisierung des Digitalen bedeutet jedoch nicht, dass Facebook, Laptops und iPhones in literarischen Texten der Gegenwart nur Nebenrollen einnehmen – ganz im Gegenteil. Der intermediale Bezug auf sie ermöglicht ganz eigene Formen des Schreibens und Erzählens.
Zwei vollkommen unterschiedliche Funktionen erfüllt beispielsweise der Bezug auf Facebook in den Romanen Lookalikes (2011) von Thomas Meinecke und Vor der Zunahme der Zeichen (2016) von Senthuran Varatharajah. Bei Meinecke finden sich kurze Einschübe zwischen längeren Textabschnitten, die in der Form von Benachrichtigungen des sozialen Netzwerks formuliert sind: »Barbara Vinken hat Thomas Meinecke eine Nachricht geschickt«, »Josephine Baker ist jetzt mit Justin Timberlake befreundet« oder »Christina Borkenhagen ist der Gruppe Leute, die ihren Nachnamen immer buchstabieren müssen, beigetreten«. Diese kurzen Sätze imitieren nicht nur den Stil der Benachrichtigungen, sie markieren im Text auch kleine Unterbrechungen, bevor in längeren Absätzen wieder neu angesetzt wird. Auf ähnliche Weise wie sie auf dem Bildschirm des Smartphones auftauchen, unterbrechen die Benachrichtigungen den Fluss des Textes – oder zumindest der Aufmerksamkeit – und stellen neue Verknüpfungen her. Der Bezug auf Facebook fügt sich auf diese Weise folgerichtig in Meineckes intertextuelle Poetik.
Dazu kommt die thematische Dimension: Die Frage der Lookalikes schließt an den Diskurs über Selbstinszenierung und Authentizität an, den die weite Verbreitung der sogenannten social networks hervorgebracht hat. Die Fragen nach Rolle und Selbstinszenierung, nach Eigenem und Anderem, nach Kopie, Zitat und Appropriation stellen sich für Meineckes Protagonist*innen genauso wie beim Posten eines Memes, der Auswahl eines neuen Profilfotos oder der Lektüre einer Timeline.
Bietet der Bezug auf Facebook Meinecke die Möglichkeit, einen Raum der Vernetzung und öffentlichen Inszenierung zu schaffen und plausibel zu machen, ist das soziale Netzwerk bei Varatharajah Ort des intimen Austauschs. Die Protagonisten von Vor der Zunahme der Zeichen, Ventil Vasuthevan und Valmira Surroi, erzählen sich ihre Familien- und Migrationsgeschichten über die Messenger-Funktion von Facebook. Senthil entdeckt Valmira in der Box »Personen, die ich vielleicht kenne« am Rande seiner Facebook-Timeline. Es bleibt über den ganzen Roman hinweg bei diesem Status, bei einer asymptotischen Annäherung über ihre Lebensgeschichten. Das knappe Verpassen des beziehungsweise der Anderen in Marbach, Berlin und an weiteren Orten drückt sich in den unerbittlichen timestamps des Messengers aus, die oft knapp beieinander liegen. Schließlich – in diesem Sinn der Höhepunkt des Romans – schreiben sie sich sogar Nachrichten zur gleichen Zeit, die im Gesprächsverlauf des Messengers jedoch auch wieder nacheinander angezeigt werden – als knappste Form der Verfehlung des Anderen. Facebook steht hier für die Erzeugung von Intimität, Annäherung und die, wenn auch verpasste, Möglichkeit der Nähe, während das Netzwerk bei Meinecke für Verzweigung und Offenheit steht.
Sie seien nur eine Facebook-Nachricht oder E-Mail entfernt scheinen uns bekannte Persönlichkeiten mit ihren Auftritten in sozialen Netzwerken zu suggerieren. Genau diese von Social-Media-Manager*innen gern verbreitete Verfügbarkeitsfiktion lässt Tilman Rammstedt in seinem Roman Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters (2012) grandios scheitern. Vergeblich schreibt der Protagonist, eine Autorfigur, die ebenfalls den Namen Tilman Rammstedt trägt, E-Mails an Bruce Willis, um seinen Roman zu retten. Diesen hat der fiktive Rammstedt mit seinem Bankberater fehlbesetzt, der zu den im Plot vorgesehenen Actionszenen gar nicht in der Lage ist. Was bei Meinecke als Rahmen für Verknüpfung und bei Varatharajah als Rahmen für Intimität funktioniert, scheitert bei Rammstedt. Dieses Scheitern birgt für den Roman produktives Potential: Es hilft der Figur Rammstedt, der sich durch die von Willis unbeantworteten E-Mails auf sich selbst zurückgeworfen sieht, über seine Schreibblockade hinweg.
Aus ganz anderen Gründen unerreichbar als Willis ist die Frau von Darius Kopp, dem Protagonisten von Terézia Moras Roman Das Ungeheuer (2013): Sie hat sich erhängt. Ihrem Ehemann hat sie ein Dateienkonvolut hinterlassen, das Kopp auf einer Reise durch den Osten Europas – und weiter – am Bildschirm seines Laptops liest. Dass der IT-Fachmann Kopp nicht den ihm ebenfalls zur Verfügung stehenden Ausdruck der Textdateien liest, sondern immer zum Laptop greift, hat nicht nur mit seinem Beruf zu tun. Mora hat die Seiten des Romans geteilt, sodass die Leserin, immer wenn Kopp in den Dateien liest, im unteren Teil der Seite ebenfalls den entsprechenden Abschnitt lesen kann. Sie inszeniert damit eine Eigenschaft digitaler Texte: Diese sind immer doppelte Texte. Hinter dem lesbaren Text auf der Benutzeroberfläche steht der unsichtbare Text der Programmcodes, der in seiner Ausführung den lesbaren Text erst hervorbringt. In ähnlicher Weise bringen die digitalen Tagebuchaufzeichnungen seiner Frau die Erzählung von Kopps Reise hervor, indem sie ihm Stichwörter geben, die sein Denken und Handeln bestimmen, wenn die Erinnerung die Gegenwart überlagert. Die Digitalität des Textes wird zur Metapher der Zeitverhältnisse.
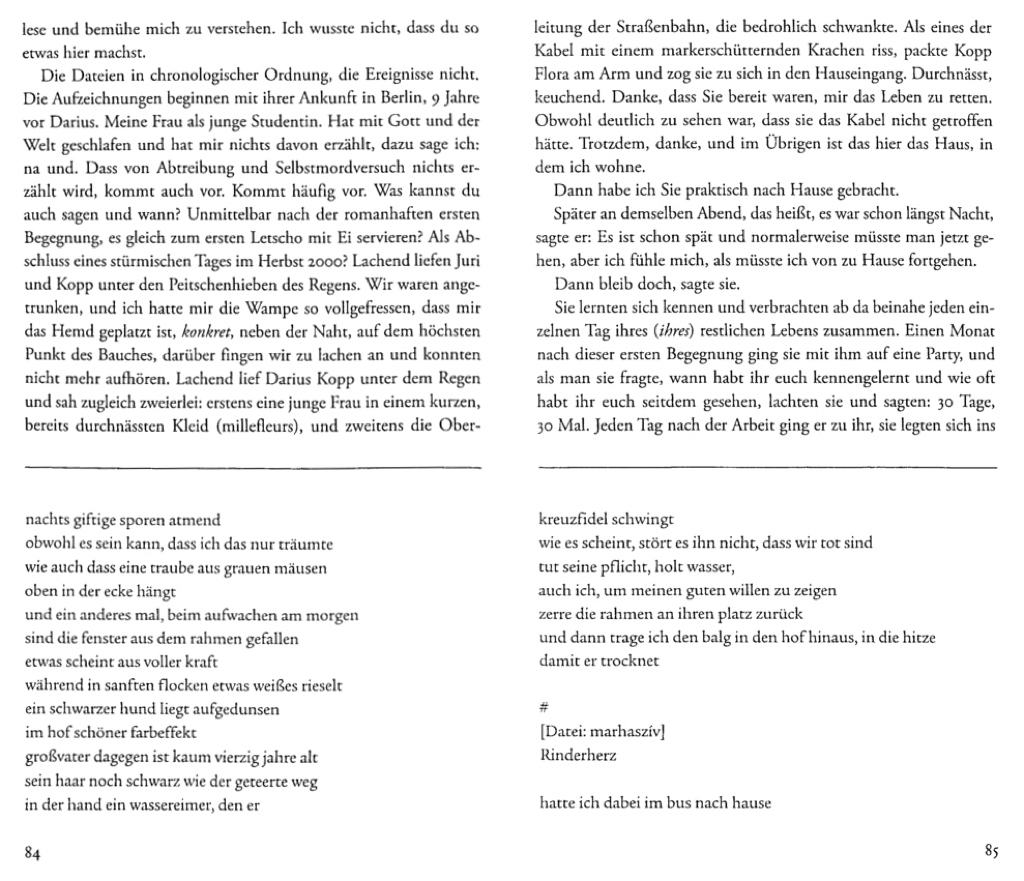
Was Kopp sein Laptop ist, ist Natalie Reinegger – ein sprechender Name, sie ist körperlich das Gegenteil von Arnold Schwarzenegger – ihr iPhone. Reinegger ist die Protagonistin von Clemens Setz’ Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre (2015). Das für Natalie wichtigste Programm auf diesem iPhone heißt NonSeq. Mit diesem Programm mixt sie durch Überschreibungen verschiedene Gesprächsaufnahmen, sodass diese sich überschneiden und die aufeinanderfolgenden Gesprächsfetzen möglichst wenig Sinn ergeben. Daher der Name: NonSeq ist eine Abkürzung für non sequitur. Die Formel wird üblicherweise in der Logik verwendet, man kennt aber auch verwandte literarische Verfahren, beispielsweise im Dadaismus. Oder in den Worten des Romans: »Es bedeutete, dass das eine nicht auf das andere folgte. Prinz Albert. Mehl. Ich löse Eiswürfel auf. Deshalb so viele zahme Hirsche.« Die App ist gewissermaßen die Extremform dessen, was auch die vielen Abschweifungen im Roman bewirken, die als Cliffhanger funktionieren. So verwundert es nicht, dass auch eine Reihung aufeinanderfolgender Kapiteltitel klingt wie ein NonSeq-Gespräch: »Kälte«, »Luminous Details«, »Wurfparabel«. Woran diese Form, Setz hat darauf selbst verwiesen, aber auch anschließt ist das geläufige Kommunikations- und Leseverhalten in digitalen Medien. Die Aufmerksamkeit ist nicht auf eine bestimmte Sache gerichtet, sondern bewegt sich von Moment zu Moment von einem Browsertab zum nächsten, von einem Chatfenster zum anderen, sodass eigentlich nicht zusammenhängende Elemente aufeinanderfolgen.
»Man braucht seit dem Netz ja einen neuen Ansatz«, stellt Ann Cotten etwas spöttisch in der Einleitung zu ihrem Versepos Verbannt! (2016) fest – und fasst es in Neo-Spenser-Strophen ab. In der Form setzt sich also der Spott über die fort, die jetzt in Facebook-Nachrichten schreiben. Cottens Epos handelt von Medienkonkurrenzen zwischen Fernsehen, gedruckter Presse, Netz und nicht zuletzt der Literatur wie Christiane Kiesow festgestellt hat. Die Erzählerin, eine auf die fiktive Insel Hegelland verbannte Fernsehmoderatorin, wird stets von den Bänden von Meyers Konversationslexikon begleitet, deren Wissen Grundlage eines Teils der deutschsprachigen Wikipedia ist. Die Inselbewohner besitzen genau drei Zeitungen, eine boulevardeske, das Wisch-Blatt, eine postmoderne, die Zy-Presse, und die rechte Na-Presse. »Das Internet« erscheint als Ejakulat der Nachtgestalt der Fernsehmoderatorin und geht schließlich pleite. So erledigt die Literatur das Netz in ein paar Strophen. Die hämischen Passagen zum Netz wirken stellenweise wie eine Retourkutsche auf die alarmistische Rede vom »Tod des Buches« in der Anfangsphase der Digitalisierung, in dessen Vollzug die Literatur in einer digitalen Wunderwelt aufgehen sollte. Auch diese spöttische Abfertigung des Digitalen in einem von ihm möglichst weit entfernten Art des Sprechens ist Teil der gegenwärtigen postdigitalen Phase. Erst nach der Digitalisierung kann man ablehnend auf diese reagieren.
Die digitale Revolution ist vorbei und sie hat Spuren hinterlassen. Ein Teil der postdigitalen Gegenwartsliteratur zeichnet sich nicht nur durch eine beiläufige Integration der digitalen Alltagswelt aus, sondern schöpft aus diesen Bezügen und Anschlüssen auch die Möglichkeit neuer erzählerischer Räume. Die damit einhergehenden Imitationsbewegungen, Überspitzungen und Umdeutungen machen nicht nur die Potentiale dieser intermedialen Bezüge deutlich. Sie verweisen im Vergleich auch darauf, dass es weder das Internet noch das Digitale gibt, sondern viele verschiedene Versionen und entsprechend viele Aneignungsformen.