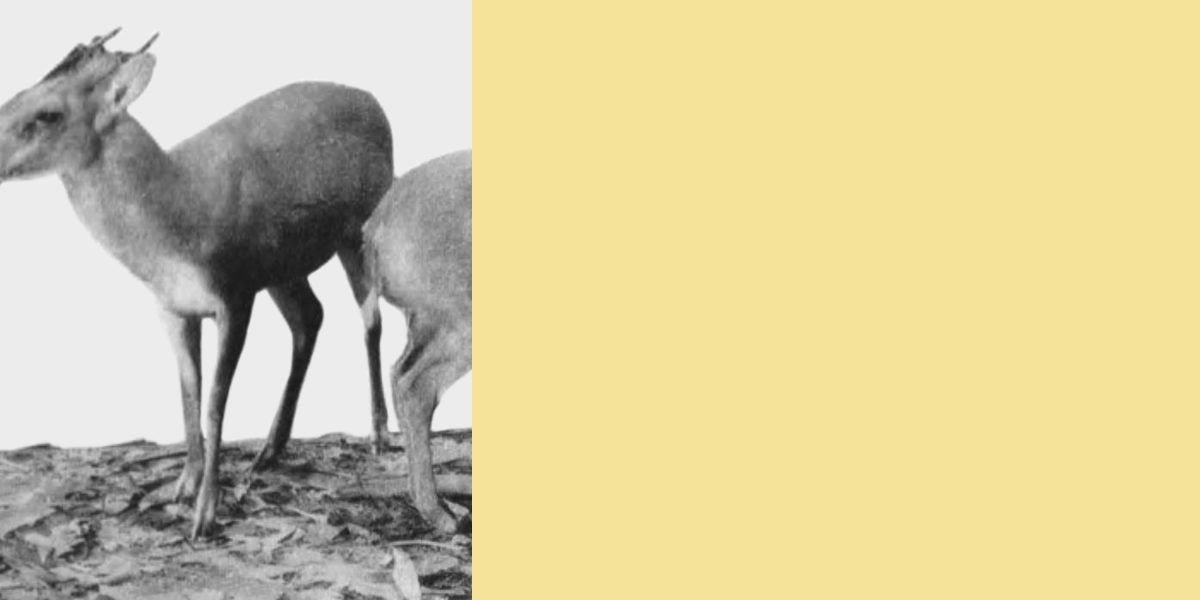(zu seinem 80. Geburtstag)
Schleef hat seinen sinnlichen Körper also zum Anschauen, aber auch wieder zum Denken (beide waren für ihn untrennbar) vorgestellt, auch vor meine Texte gestellt, die dadurch zum Glühen gebracht wurden und auf einmal mit Licht geworfen haben. Man kann zwar sagen, sie seien unterschiedliche Weisen des Vorstellens, aber welches Vorstellen, welche Sinnlichkeit, wo treffen wir uns da, ich und Schleef? Sprache kann ich nicht anders als sinnlich denken, selbst wenn ich antike Dramatiker zitiere. Es soll sein wie zum Anfassen. Marmorblöcke werden umgewälzt und zeigen ihr Geschlecht, jeder das seine. Schleef hat nicht nur den Zusammenhang und Zusammenhalt von Denken und Sinnlichkeit (nicht: Sinn und Sinnlichkeit) in seinem eigenen Körper dargestellt, indem er beide verschmolzen hat, sondern er hat, selbst wenn ich zart an den Saiten des Verstandes gezupft habe, ob er noch da ist, er hat also mein Angewiesensein auf den Verstand, mit dem ich etwas analysieren wollte, abgeräumt, durch die Körper, die er auf die Bühne gestellt hat, aber auch durch sich selbst, wenn er sich da hingestellt (ausgestellt) hat, und er hat dieses Konglomerat dann zur Anschauung ja: geprügelt, gezwungen. Er hat sich ihm aufgezwungen.
Keine Ungezwungenheit bei Schleef! Er hat dann das Sprechen durch fast unvorstellbare Exaktheit der Chöre wieder zurück in diesen dunklen Raum gescheucht, den ich nicht benennen kann, der Körper ist und aus dem Körper kommt, aus seinen Bedürfnissen und Sehnsüchten, was weiß ich. Er hat das Denken in die Körper zurückgetrieben, als wäre es ein Tier, und erst dadurch konnten sie denken, diese Körper, weil sie nichts andres als Körper sein durften, das heißt: konnten.