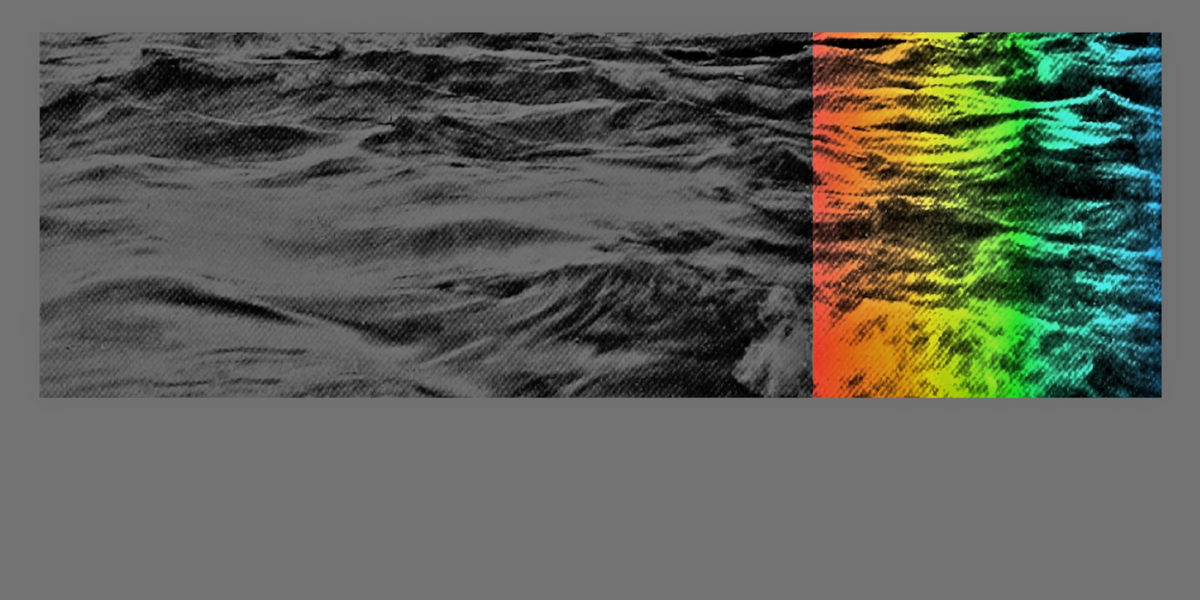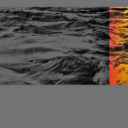Postmoderne Beliebigkeit hört dann auf, wenn die berühmte Titelmelodie von James Last einsetzt. Heutzutage muss einem fast gar nichts mehr peinlich sein, aber wenn ich sage (ich »gestehe« nicht, ich »statuiere« eher), dass ich Traumschiff liebe, begegnet mir immer kollektiver, lautstark artikulierter Unglauben. Da außer mir, meiner Familie und ein paar Leuten auf Twitter »niemand« (schenkt man diesem artikulierten Unglauben Glauben) Traumschiff guckt, darf ich davon ausgehen, dass das Entsetzen den kitschigen Grundkonstellationen, den Dialogen, die die Arbeit einer Schreinerin und nicht die einer Drehbuchautorin zu sein scheinen, und der nicht unbedingt vor Kreativität und Innovation platzenden Dramaturgie gilt. Das sind alles Aspekte, die man nicht nur akzeptieren, sondern vollends umarmen und begrüßen können muss, wenn man das Traumschiff lieben möchte in all seiner Traumschiffigkeit. Traumschiff bietet Monotonie und Verlässlichkeit mit genau dem winzigen Hauch Neureiz (das Reiseziel ändert sich schließlich immer!), der es interessant bleiben lässt. Wie der/die seit 30 Jahren Angetraute, der/die ab und zu ein Hemd in ungewohnter Farbe trägt.
Vergiss Subtilität oder Ironie, lass alle Hoffnung auf überraschende Wendungen fahren, hör auf, bei klischeetriefenden Dialogen das Gesicht zu verziehen, hör auf, dich zu wundern, dass überall auf der Welt Deutsch gesprochen wird. Und hoch geht’s auf die Gangway, ein buntes Getränk mit Schirmchen in der Hand. Beatrice weiß deinen Namen schon, keine Sorge.
Apropos Beatrice – ein schönes Beispiel für die subtile Raffinesse und Poesie des Traumschiffs liefert Otto Sander (ja, der!) in der (in meinen Augen) legendären Australienfolge, in der übrigens auch Ben Becker mitspielt. Als Otto Sanders Figur James Korthals auf Beatrice trifft, starrt er sie so eindringlich-blitzeblau an, wie er das als blauäugiger Schauspieler mit folgendem Redeauftrag nur tun kann: »Beatrice … ich fuhr mal auf einem Schiff, das hieß … Beatrice. Ja, es ist untergegangen. Ich war der einzige Überlebende.«
Wer so eingeführt wird, führt selbst nichts Gutes im Schilde.
Beatrice hingegen wird seit 1981 von Heide Keller gespielt und führt niemals etwas anderes als das Beste im Schilde.
Ben Beckers »Jerry« hingegen antwortet 30 Sekunden nach seinem Auftauchen – mit offener Hemdbrust vor seinem kleinen Flugzeug – auf die Frage einer hingerissenen Ärztin »Wohin fliegen Sie eigentlich?« mit »Ich bringe Babynahrung zu den Kindern der Aborigines.« Weißte auch da Bescheid. Zumindest, was den Charakter des raubeinigen Helden in Ben-Becker-Form angeht.
Nägelkauend war ich in meinen Sitz gepresst, während ich auf Gewissheit wartete, ob die Ärztin Ben Becker auf seinem supercoolen Schiff um die Welt folgen oder bei ihrem treudoof-langweiligen Evolutionsbiologen bleiben würde, der sich vor allem durch die Frage an Beatrice hervortut »Gibt es auf diesem Schiff eigentlich auch einen anständigen Rechner? Also einen Computer.« (Die Erstausstrahlung dieser Sendung war an Neujahr 2004, da musste man noch sichergehen, dass die Zuschauer*innen wissen, wovon man redet, wenn man »Rechner« sagt.)
Kleiner Scherz, natürlich wusste ich von Anfang an, wie es ausgehen würde. Wem die Traumschiff-Erfahrung fehlt, um Gewissheit zu haben, dem kann ich nur empfehlen, sich die Folge anzusehen. Eine cineastische Großtat.
Aber Sie wissen es eh schon, ohne die Folge gesehen zu haben, stimmt’s?
Das ist das Beruhigende an Traumschiff: die Schönheit des Schlichten, das Wissen um die Vollständigkeit des eigenen Wissens. Alles verläuft nach festen Mustern, alle sind eindeutig und unveränderlich markiert als gut oder böse, als dümmlich oder listig, als lustig oder als spröde. Klischees werden nicht vermieden, sie werden mit solcher Wucht inszeniert, jedes Mal aufs Neue, als ob das Drehbuch, die Regie und die Schaupieler*innen sie gerade neu für sich entdeckt hätten. Auf der Witze-Seite der aktuellen Micky Maus-Hefte stehen schließlich auch Witze, über die ich als Kind schon gelacht habe, und ich sehe immer noch Kinder, die sich darüber ausschütten vor Lachen. Es ist also durchaus arrogant anzunehmen, dass eine Scherz, eine Storyline, ein Personentypus überflüssig oder »over« sei, obwohl sie oder er das vielleicht für einige noch nicht ist.
Ich kann die Dialoge mitsprechen, obwohl ich die Folge noch nicht gesehen habe, und dass ich auf die Sekunde genau herunterzählen kann, bis die »Reiseführerszene«1 kommt, liegt nicht nur daran, dass ich Traumschiff gucke, seitdem ich denken kann – obwohl das ohnehin eine überflüssige Fähigkeit für den Konsum dieser Sendung ist, wie gerne geunkt wird – sondern genau daran, dass alles so wundervoll vorhersehbar ist. Es gibt keine menschliche Komplexität, auch keine Irrationalität und Ambivalenz. Es gibt nur Drama, Humor, Beatrice, Eisbomben und geistreiche Wortgefechte wie: »Ich werde den Vulkan besichtigen.« »Na, dann passen Sie aber auf, dass der nicht gerade dann Feuer spuckt.« »Ich finde es immer noch besser, der spuckt Feuer, als Sie Gift und Galle.«2
Das feste Team aus Beatrice, Käpt’n und Doc hat in 35 Jahren selten die Besetzung gewechselt: Sascha Hehn ist der insgesamt vierte Kapitän, Nick »Ah, Herr Kaiser, gut, dass ich Sie treffe« Wilder der zweite Doc und Heide Keller war immer schon Beatrice. Allerdings ist die Konstellation zwischen den dreien in jeder Besetzung gleich: Immer unterliegt allem ein freundschaftlicher Grundton, in den sich zarteste Anflüge des Flirtativen und der Konkurrenz mischen, aber wirklich nur hauchzarte. Die Konkurrenz zwischen Doc und Kapitän natürlich, falls irgendwer einen Zweifel hatte. Man ist straight auf dem Traumschiff. Selbstverständlich. Alle und immer. Soweit ich mich erinnern kann.
Da Traumschiff nicht vorgibt, etwas anderes zu sein als Unterhaltung auf einer Ebene, die alle bedient, die keinen Bildungsgrad ausschließen soll, die eine*n nebenher bügeln oder Raketen entwerfen lässt – beides ginge, ohne den Plot nicht mehr verfolgen zu können –, ist der Vorwurf der mangelnden »Qualität« des Dargebotenen eigentlich reiner Snobismus. Wer würde einer Orangenhändlerin vorwerfen, dass sie nicht auch noch Äpfel verkauft? Noch dazu einer Orangenhändlerin aus dem letzten Jahrhundert? Wirklich faszinierend ist an Traumschiff doch auch, dass es sich seit der ersten Folge aus dem Jahr 1981 keinen Millimeter bewegt hat, in keine Richtung. Zumindest scheinen sämtliche auftauchenden Figuren und Plots immer noch denselben Holzschnitten zu entspringen wie damals. Dadurch erscheint das Traumschiff wie aus einer anderen Ära, es scheint historisch, selbst wenn die Folge brandneu ist. Vertraut, gemütlich, ohne Anforderungen an die Zuschauer*innen. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Das ist das eine, das musste mal raus. Als ich jedoch intensiver über das Traumschiff nachdachte, darüber, was ich daran mag, kam ich logischerweise auch auf das, was ich nicht mag. Dazu gehört halt leider auch, dass es sich keinen Millimeter bewegt hat. Dass es nicht »anspruchsvoller«, komplexer, raffinierter oder weniger platt geworden ist, dafür liebe ich es von ganzem Herzen. Dass es aber auch nicht liberaler geworden ist, dass die Geschlechterklischees immer noch munter durch die Säle getragen werden wie Eisbomben mit Wunderkerzen3, dass Sexismus ein Anlass zum Schmunzeln ist, das tut halt doch weh, kommt aber im Komplettpaket mit der putzigen Patina. Leider.
Was am meisten weh tut und problematisch ist, ist jedoch der latente Rassismus, der sich in einer stur europäisch zentrierten Weltsicht zeigt, die aus dem vorletzten Jahrhundert zu stammen scheint. Dieser Tage bin ich im Zusammenhang mit Trump auf eine interessante Analyse zum Thema »Lovable Mysogynists« gestoßen, die sich die Frage stellt, warum dieser beliebte Typus so gefährlich ist für unser Denken. Der »Lovable Mysogynist« begegnet uns in vielen Serien und Filmen: Barney in How I met your mother, dessen einziger Lebensinhalt es ist, Frauen unter dreißig flachzulegen, das gesamte männliche Personal von Big Bang Theory, die alle möglichen ekligen Methoden anwenden, um sich Frauen anzunähern, aber – hihi – voll nerdig. Darum ist das auch alles wieder in Ordnung. Sie behandeln Frauen wie Dreck, aber im Grunde ihres Herzens sind es alles voll okaye Typen, über die man lachen kann. Dass die ständige Darstellung dieses Männertypus᾽ nicht förderlich ist für eine Gesellschaft, die Frauen ernst nehmen sollte, ist leicht nachzuvollziehen, denn die Gewöhnung an den »Lovable Misogynist« sorgt für Abstumpfung, und Abstumpfung führt zu Akzeptanz, wie zähneknirschend auch immer.
Man kann es dem Traumschiff kaum vorwerfen, dass seine Frauenbilder auf stupiden Klischees beruhen, denn das gilt genauso für die Männer. Richtig übel wird es dann, wenn die Storyline so geht, dass ein älterer Schmierlappen Preisausschreiben veranstaltet und immer hübsche, junge Frauen eine Kreuzfahrt gewinnen und dann auf der Kreuzfahrt ihrem großzügigen Spender begegnen, der sich beim Abendessen an ihren Tisch setzen lässt und dort seinen Schmierlappen-Charme tropfen lässt. Der Kapitän kommentiert das dann so: »Ab und zu zog eine von den jungen Damen dann in seine Luxuskabine um. Jaja. Die Deutschland4 ist kein schwimmendes Kloster.«5 Schmunzel. Schmunzel. Dass derartige Creepiness trotzdem nur mit einem »Tsts« verurteilt wird und die Traumschiff-Crew den Schmierlappen bei dieser Perfidie offenbar aktiv unterstützt, schiebe ich jetzt mal zur Seite, weil mir gerade etwas flau wird.
Es peinigt mich auch ungeheuerlich, zuzugeben, dass das Traumschiff so etwas wie ein »lovable racist« ist. Dass es für einen öffentlich-rechtlichen Sender eine Frechheit ist, das Traumschiff 2005 kommentarlos in die Gewässer der Militärdiktatur von Myanmar zu lenken, muss wohl kaum diskutiert werden. Dass dort unter den Passagieren kein Wort zur politischen Lage fällt, ist klar, da gibt es nur »Oh, so schöne Tempel!« »Ach, guck mal, das ist der uralte Tanz der Weisen.« (Aussagen erfunden, ich mag mir das nicht nochmal angucken.) Das Traumschiff ist nicht dazu da, politisch zu sein und sich zu positionieren, so viel steht fest. Dann sollte es aber auch nicht nach Myanmar fahren. 2011 wurde schließlich auch die Route geändert, als es nach Japan gehen sollte. Aber Fukushima verträgt sich so schlecht mit Bermuda-Shorts und Händchen haltenden Paaren am Strand.
Das sind die offensichtlichen Dinge. Dabei zeigt sich der »lovable racism« des Traumschiffs in fast jeder Folge, und ja, auch ich sage: »Kihihihi, wie dumm«, und gucke es weiter, weil ich Traumschiff zu sehr liebe, um das nicht zu zur Seite zu schieben. Und das ist falsch, und ich wünschte, das ZDF würde ein wenig sensibler, denn schwer ist es nun wirklich nicht, daran etwas zu ändern. Das beliebteste Absurdum des Traumschiff-Universums ist: Überall auf der Welt wird Deutsch gesprochen. Manchmal wird das kurz erklärt, wenn die Person wichtig wird – für eine Tändelei sind Unterhaltungen schließlich durchaus entscheidend –, aber meistens wird es einfach hingenommen. Und natürlich wird auch deshalb überall Deutsch gesprochen, weil man das Traumschiff nicht untertiteln kann (obwohl: Warum eigentlich nicht?), da die Handlung ohne Unterbrechungen vorangetrieben werden muss und kein*e Zuschauer*in ausgeschlossen werden soll. Alles verständlich. Aber umso unverständlicher ist es dann, dass ein relativ zuverlässiger Marker für die »Bösen« ist, dass sie nicht Deutsch sprechen. Zusammen mit Sonnenbrille und Zigarette wird dadurch meist klar, dass sie die Fiesen sind.
Die »Eingeborenen« führen vorzugsweise Tänze in Kokosnussbikinis auf, allesamt sind sie liebreizende, demütige Menschen und nehmen dankbar die huldvollen Gaben der deutschen Gäste an.
Dass das alles für mich trotzdem bisher kein Dealbreaker war, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Traumschiff aus einer anderen Zeit zu stammen scheint, in der noch keine Sensibilität für diese Problematiken da war, ein verstaubtes Relikt, dessen nostalgischer »Charme« gerade darauf basiert, dass es weiß und straight und zu 100% unreflektiert ist.
Es ist ein Gruß aus der Vergangenheit, und wie oft entschuldigt man menschenverachtende Aussagen mit dem Hinweis: »Damals war das halt so! Zeitgeist!« Ich will Traumschiff nicht mit Luther oder Lovecraft vergleichen, nicht zuletzt deshalb, weil es in der Gegenwart produziert wird. Aber es ankert in den Gewässern des Unterhaltungsfernsehns von vor 40 Jahren.
Da ist es gemütlich, in diesem Weltbild, in dem Reflexion der eigenen Position keinen Platz hat, der Muff der Vertrautheit durchweht alles, wie in einem gründlich beschlafenen Bett, dessen Bezug mal dringend in die Wäsche müsste. Aber man legt sich halt noch einmal hinein, weil Frische auch immer etwas Neues und Aufregendes ist, und das möchte man ja nicht immer. Oder, ein etwas appetitlicheres Bild: Eingelaufene Schuhe sind die bequemsten, da vergisst man auch mal gerne, auf wem man mit ihnen herumtrampelt.
Während ich diesen Text schrieb, platzte die Eisbombe (ein Kalauer auf Traumschiff-Niveau): Heide Keller kündigte ihr Ende als Beatrice an. Sie, die gute Seele, die mehr Traumschiff war als jedes der Kreuzfahrtschiffe, die in all den Jahren als Traumschiff dienten. Vielleicht wird das auch für mich endlich ein Anlass sein, mich vom Traumschiff-Gucken loszueisen. Neujahr 2018 wäre dann mein letztes Käptns Dinner. Wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich etwas finde, das ebenso schlicht gestrickt ist.
1Wenn ein* Reisend*e oder wie seit Neuestem der Kapitän ein paar interessante Fakten über Größe, Kultur und Natur des Ziellandes herunterspult, unterlegt mit einer Montage »wunderschöner Landschaftsaufnahmen«.
2Singapur
3Übrigens ist die traditionelle Schlussszene, der Einlauf der Kellner*innen mit den Eisbomben und den Wunderkerzen, logistisch so anspruchsvoll zu drehen, dass mitunter diese Szenen mehrfach verwendet werden.
4Die Deutschland war das von 1999-2014 amtierende Traumschiff
5Sambia, 2003