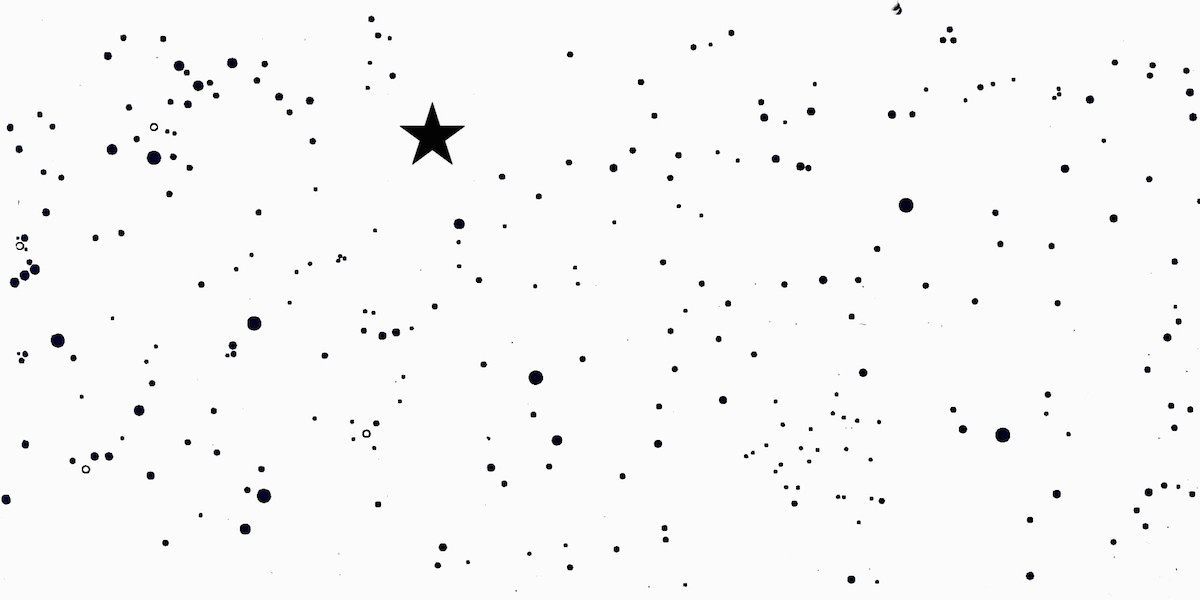Der Text entstand großteils 2013. Aus gegebenem Anlass wurde er aktualisiert. Es ist die Chronologie einer Fan-Beziehung.
Erst gab es den Dadaismus, den Surrealismus, den Existenzialismus, die Beatgeneration, die Hippies, 68er und die Freaks. Und dann David Bowie. Teils vermittelnd stand der Bowieismus zwischen dem bewusstseinsrevolutionären Mainstream der späten 60er, den Punks und der großen Auffächerung in den 80ern und war eine in vielen Richtungen kompatible Übergangs- und Brückentechnologie.
Ich war acht und lag krank im Bett, als David Bowie vorbeikam. Neben dem Bett stand ein leerer Plastikeimer der Firma Nadler. Mein Vater arbeitete bei Möbel-Kraft in Bad Segeberg. Was in der Kantine von Möbel-Kraft übrigblieb, brachte er in Plastikeimern nach Hause. Ab und an musste ich kotzen und schlief dann wieder ein. Neben dem Bett stand ein Radio, und im Radio lief The Laughing Gnome von David Bowie. Ich liebte das alberne Kinderlied mit den quietschenden Stimmchen sofort: »Ha ha ha, hee hee hee / I’m a laughing gnome and you can’t catch me.« Das war mein erster Kontakt.
Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wann ich The Laughing Gnome tatsächlich zum ersten Mal gehört hatte. Das Lied war ein Flop gewesen. Wahrscheinlich war es 1969 im Radio gespielt worden, kurz nach der Mondlandung, die in England mit Space Oddity von Bowie illustriert worden war.
Näher lernte ich Bowie 1973 kennen. Ich war elf oder zwölf und hörte jeden Samstag die Internationale Hitparade mit Wolf-Dieter Stubel im NDR. The Jean Genie war gerade rausgekommen und auf Platz zwei der englischen Charts. Beim Trampolintraining hatte ich am Trampolin gestanden und mit K. über die Internationale Hitparade gesprochen. K. war schon 16 und kannte sich mit Rockmusik aus. Ich hatte erzählt, wie toll ich The Jean Genie fände, und er hatte vor Bowie gewarnt. Weil der nicht echt wäre, wie Johnny Cash zum Beispiel.
David Bowie war also nicht allseits anerkannt, berühmt und verehrt, wie ich beim Hören der Internationalen Hitparade mit Wolf Dieter Stubel gedacht hatte, er war auch verdächtig.
The Jean Genie fand ich trotzdem großartig und wünschte mir die dazugehörige LP Aladdin Sane zu Weihnachten. Der Titel erinnerte an die Fernsehserie Bezaubernde Jeannie, und bei Aladdin Sane dachte ich an Aladin und die Wunderlampe. Meine altmodischen Eltern müssen sich komisch gefühlt haben, als sie die Platte kauften: Wie sieht der denn aus!
Es war meine erste Platte. Ich hörte sie im orange gestrichenen Partykeller der Eltern, der eigentlich nur zu Silvester benutzt wurde. Die Platte war eine unbekannte Insel, ein fremdes Land, durch das mich der bleiche David Bowie mit seiner Wunderlampe führte.
Am Anfang war sie komisch; je öfter man sie jedoch hörte, desto schöner wurden die einzelnen Stücke, deren Worte ich nicht richtig verstand, obgleich die Bravo eine Übersetzung von Drive-In Saturday gedruckt hatte.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mit zwölf war mir das seltsam schwanenhafte Design der Platte ein bisschen peinlich gewesen. Das Gesicht fand ich super und den blauroten Blitz, der dem Androgynen so etwas Offensives gab. Die Zeichnung des nackten Bowiekörpers bis zu den Hüften im Innersleeve war mir dagegen peinlich.
Die Platte roch gut. Man legte sie ganz vorsichtig auf. Die Nadel erweckte sie dann zum Leben. The Jean Genie war die Oase des Bekannten, bei dem schönen Liebeslied Prettiest Star konnte man träumen, das spätexistenzialistische Time, ein großer Evergreen, mit den berühmten Bowielyrics: »Time – falls wanking to the floor«. Die überkandidelten Lieder Aladdin Sane und Lady Grinning Soul, das tolle Drive-In Saturday. Das Album erschloss sich ganz langsam, bis man verstand, wie die einzelnen Stücke aufeinander abgestimmt waren. Man musste sich erst hineinhören, um sie zu verstehen, d.h. genießen zu können. Eigentlich erschloss sich mir Aladdin Sane erst ein paar Jahre später.
Es war die große Zeit von David Bowie. Seine berühmteste Kunstfigur, Ziggy Stardust, war gerade gestorben, Übergangsfiguren waren erschienen. In den Charts begegneten die Hits des einen denen des anderen Albums. Man verfolgte sie jede Woche und fieberte mit den einzelnen Titeln, als wären The Jean Genie, Life on Mars?, Drive-In Saturday und später Rebel, Rebel Lieblingsfußballmannschaften oder Vertreter der eigenen diffusen Gefühlswelten oder Wünsche.
Dass Bowie den gleichen Vornamen hatte wie David Cassidy und mit Marc Bolan befreundet war, fand ich auch gut.
Ich informierte mich in der Bravo über meinen Star, erfuhr Geheimnisse, wie dass sich Aladdin Sane auch als »a lad insane« lesen lässt und dass es in seiner Familie Fälle von Wahnsinn und Selbstmord gab, ich übersetzte Lieder am Tonband und träume von England.
Mein allerliebstes Bowie-Lied war Life on Mars?. Ich kaufte mir die Single und fand das Cover total toll. Und den Text, der in der Bravo übersetzt war. Gern wär ich das Girl »with the mousy hair« gewesen. Es war noch schöner als seine ältere Schwester aus She’s Leaving Home von den Beatles.
Im Sommer 1974, auf einer Jugendverschickung in die Normandie, fühlte ich mich irgendwie als Botschafter meines Helden, als ich mutig Rebel Rebel auf der Jukebox in einem Café in Grandcamp-Maisy drückte. Mit Mädchen, die nicht so genau wissen, ob sie eigentlich Jungs sind, konnte ich mich gut identifizieren.
In meinem Zimmer hing das große Piratenposter von David Bowie. Die Eltern wollten, dass ich es wieder abmache. Die Kodierungen des Ganzen waren ihnen klarer als mir. David Bowie kam ihnen vermutlich wie ein Mitschnacker vor. Udo Lindenberg dagegen interpretierte den Geschlechtertausch in der Popmusik als Fortschritt: »Und dann Mick Jagger und jetzt David Bowie, der seinen Gitarristen auf der Bühne küsst / Und wieso auch nicht, ist doch ganz egal/ ob du ein Junge oder ein Mädchen bist.« Bowies Gitarrist, Mick Ronson, fand es aber nicht so gut, dass Bowie auf der Bühne an seiner Gitarre leckte.
Nachdem ich mit 14 Woodstock gesehen hatte, entfernte ich mich wieder aus der Gegenwart. Statt David Bowie hing nun ein romantisches Mädchenbild von David Hamilton und später dann Ché Guevara neben dem Schreibtisch. Ein paar Jahre studierte ich Hippiemusik, Hermann Hesse, Aldous Huxley, 1968 und die Autoren der Beatgeneration, nahm Drogen und bastelte mir eine Weltanschauung, in der David Bowie einen Ehrenplatz hatte. Er war ja mit allem verbunden: mit den Hippies – der junge Bowie hatte Hippiemusik gemacht und mit 17 die Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men (»It just has to stop now!«) gegründet –, mit den Beatniks, da er seine Songtexte wie William S. Burroughs mit der Cut-up-Methode entwickelt hatte, mit Lou Reed, Velvet Underground usw.
Wie strange der echte David Bowie Mitte der 70er Jahre war, war mir damals nicht so klar gewesen. Er wog weniger als fünfzig Kilo, ernährte sich von Milch, Kokain und Zigaretten, sehnte sich nach dem Tod und war äußerst produktiv. (»I had sort of a strange psychosomatic death wish thing.«)
Wenn er Rock ’n’ Roll Suicide auf der Diamond-Dogs-Tour aufführte, wurden Fotos von Janis Joplin, Jim Morrison und Jimi Hendrix auf riesige Leinwände geworfen und mahnend Drogen als Todesursache angegeben. Er war zu dieser Zeit genauso alt, wie die großen Heroen der Rockmusik wurden, und gerade dabei, ihrem Beispiel zu folgen.
Als Teenager konnte ich mich mit dem Refrain von Quicksand (aus Hunky Dory) sehr gut identifizieren: »Don’t believe in yourself / Don’t deceive with belief / Knowledge comes with death’s release / lalalalaa, lalalalaa.«
Ziggy Stardust lernte ich bei meinem ersten Job in einer Gärtnerei kennen. In den Pausen saßen wir in der Sonne, rauchten selbstgemachtes Gras und hörten dazu das Album auf einem billigen Kassettenrecorder. Diese Tage auf dem Dorf gehören zu den Top-Ten meiner Teenagererinnerungen.
Ich färbte mein Haar mit Henna. Das Henna roch super und schimmerte in der Sonne zumindest ein bisschen orange. In dieser Zeit lebten wir zu Hause meist zu dritt nebeneinander her. Meine Mutter litt an Depressionen und war oft in Kliniken. Mein Vater war auf Arbeit und redete sowieso nicht viel, mit meinem kleinen Bruder hatte ich wenig zu tun und meine große Schwester, mit der ich verbündet gewesen war, war schon ausgezogen.
Ich fühlte mich oft einsam und außenseiterisch, blieb einmal sitzen, verliebte mich gern unglücklich, gehörte aber gleichzeitig zu den Stars der Raucherecke.
Anfangs gab es Schallplatten nur im Poster, im Plattenkeller eines Schreibwarengeschäftes. Erst Mitte der 70er gab es Popmusik auch an anderen Orten; in einem zugigen Schnellbau am ZOB und dann auch in der Kaufhalle, einer Art Karstadt für Arme, wo ich nach langem Zögern – mir gefiel das Cover nicht – eine Niedrigpreisversion von Diamond Dogs kaufte.
Später besorgte man sich in Hamburger Freakläden nicht nur Klassiker der anarchistischen Theorie, sondern auch Bowie-Bootlegs von der großartigen Station-to-Station-Tour oder von seinem berühmten Abschiedskonzert als Ziggy Stardust im Hammersmith Odeon am 3. Juli 1973. Live war Bowie noch eine Klasse besser als auf Platte.
Morgens vor der Schule saß ich immer übermüdet und aufgedreht für eine Zigarette und einen Kaffee am Schreibtisch, schrieb und hörte Stücke von The Man Who Sold The World und Space Oddity. Nachmittags trampte ich zu einer Freundin aufs Dorf, und wir hörten die Station-To-Station-Platte. Abends saßen wir in halbdunklen Zimmern, tranken Tee, kifften zu Bowies Live-Album Stage. Die Wände hatte ich mit grüner Tusche gestrichen. An der Decke hing eine Glühbirne, um die eine lila Windel gewickelt war. Auf LSD sah das gruslig aus. Die meisten Trips waren eher unangenehm, aber man fühlte sich doch irgendwie auch klasse fertig danach. Und dazu dann die Seite mit den Stücken von Low: Warszawa, Art Decade und Breaking Glass mit dem Refrain: »You’re such a wonderful person / but you got problems / I’ll never touch you.«
Das war schon gegen Ende der Schulzeit. Nachdem sich ein Freund, mit dem ich fast jeden Tag zusammen war, das Leben genommen hatte, änderte sich Vieles. Ein halbes Jahr später wurde die Freundin eines anderen guten Freundes erschossen. Ein bisschen später, als ich schon in Kiel Zivildienst machte, ertrank der Hippie, mit dem ich mit sechzehn meinen ersten Gras-Joint auf dem Klo der kleinstädtischen Haschkneipe geraucht hatte. Er galt als erster Drogentoter in Bad Segeberg.
Ich fuhr damals nur noch selten in meine Heimatstadt. Meine Lieblingsplatten waren Low, »Heroes« (bis auf den Titelsong), die drei Iggy Pop-Platten The Idiot, Lust for Life und TV Eye Live und alte Platten von Velvet Underground. Aber oft waren mir auch die ganz frühen Bowie-Songs fast am nächsten. Gerade, wenn ich mich am fertigsten gefühlt hatte, hatten mich diese wehmütig-verträumten, andererseits auch wieder präzise, wenn auch nicht erfolgreich, auf Erfolg arrangierten Lieder, getröstet.
»There is a happy land, where only children live … and adults aren’t allowed there …« Little Bombardier, In the Heat of the Morning, The London Boys.
An eine Bowie-Geschichte erinnere ich mich gut: Ein junges Mädchen erzählte sie stolz beim Abendessen, bei einem Freund in Kiel, der uns in Segeberg mit dem Frühwerk von David Bowie bekannt gemacht hatte, das er als Austauschschüler in den USA kennen gelernt hatte. Er hatte also Verdienste mit der Verbreitung von David Bowie in Bad Segeberg und Umgebung errungen, und später wurde er dann Computernerd. Das Mädchen erzählte also, wie sie mit irgendwelchen coolen Leuten unterwegs gewesen war in Südfrankreich; wie sie Nachts am Strand am Lagerfeuer gesessen hätten, und plötzlich wäre also David Bowie vorbei gekommen, der ab 1981 glaube ich – vielleicht weil er mit Queen gerade einen Nummer-Eins-Hit (Under Pressure) gehabt hatte –, irgendwie gedisst wurde. Von Leuten, die eher keine Platten kauften, aber feste Meinungen nicht nur über die damals gängigen Popstars, sondern über alles hatten. »David Bowie« hätte also gefragt, ob er sich dazu setzen dürfte und sie hätten nein gesagt.
Ich hatte dieses schöne arrogante linke Mädchen sofort angefangen zu beschimpfen, ich hatte sie gehasst und war dann immer wütender, weil die anderen meine Wut amüsant oder kindisch fanden, wieder nach Hause gerannt. Ich hatte gekocht vor Wut. Und den Freund dann auch nicht mehr so oft besucht.
Dann kam Let’s Dance heraus. Man war ein bisschen irritiert über das neue Sunnyboy-Outfit, fand die Platte aber doch toll. Auch weil sie so gegenwärtig war. Der verpeilte, leidende Bowie war passé; Let’s Dance war komplett positiv. Aus dem Star, der in der Provinz Geheimwissen und Außenseiterkult gewesen war, wurde ein Superstar. Plötzlich waren wir Weltmeister. 2,6 Millionen Zuschauer sahen die Serious-Moonlight-Tour.
In dieser Zeit war ich mit einem Mädchen aus Franken zusammen. Sie hatte zwölf Geschwister. Wir hatten uns beim Trampen, auf einer Ausfahrt in München, kennengelernt. Sie war die erste, die meinen Namen gut fand, weil der Freund von Christiane F. in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo genauso hieß. Dass die glühendsten Bowie-Fans Ende der 70er drogensüchtig waren und auf den Strich gingen, geht etwas unter in der allgemeinen Erinnerungseuphorie. Wir schauten zwei Konzerte in Bad Segeberg und eins in Berlin, sangen alle Lieder mit, waren glücklich und zogen wenig später nach Berlin.
Andächtig saß man dort im Anderen Ufer, im Kopf die Melodie von A New Career in a New Town. Der Typ, der in der Punkkneipe KOB am Tresen stand, gab mir ein Tape mit einem Bowie-Bootleg aus Bowies Frühzeit. Ich studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und fand schnell ein paar Freunde, die Bowie auch toll fanden. Leute, die AVL oder Philosophie studierten und Bowie gut fanden, waren selten. Einer von ihnen, der mittlerweile Professor ist, gab mir alle Bowie-Texte und gab vor einigen Jahren auch ein Bowie-Seminar, was mir immer noch ein bisschen absurd vorkommt.
Der neue Bowie war gesund, oft als Schauspieler unterwegs und finanziell erfolgreich. Es erfüllte mich mit kindlicher Freude, dass er viel reicher war als Franz Beckenbauer. Als er noch drogensüchtig war, hatte er aber besser und auch jünger ausgesehen.
1983 wurden drei Bowie-Filme in Cannes aufgeführt: Ôshimas Merry Christmas Mr. Lawrence, Tony Scotts Vampirfilm The Hunger mit Catherine Deneuve und die großartige D. A. Pennebaker-Dokumentation des legendären Konzerts im Hammersmith Odeon, auf dem sich Bowie von seiner Rolle als Ziggy Stardust verabschiedet hatte. Leider fehlen die Lieder, bei denen Jeff Beck als Gaststar mitspielte. Das Wichtigste war The Jean Genie (mit der Zeile »loves to be loved«), das dann in Love Me Do übergeht. Andererseits war es natürlich super und ein Distinktionsgewinn, ein Bootleg des Konzerts zu besitzen, auf dem das alles drauf war.
Die 80er waren ambivalent: This Is Not America, die Single mit der Pat Metheny Group, und Absolute Beginners waren tolle Lieder, zwei Alben eher schlimm, und als er mit Mick Jagger Dancing in the Street aufnahm, empfand man das als Verrat. Dass Bowie mit Jagger befreundet war: ein Schlag ins Gesicht. Marc Almond, der auch sehr durch Bowie geprägt war, war mir ohnehin viel sympathischer.
Am 6. Juni 87 spielte Bowie am Brandenburger Tor. Ich besuchte das Konzert distanziert; wie ein Ex-Freund. Auf der Ostseite der Mauer drängten Volkspolizisten die Fans weg. Die Show war überladen. Ein bisschen versöhnte zumindest, dass er Sons of the Silent Age, eins meiner Lieblingsstücke von »Heroes«, spielte.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Neue FreundInnen mussten sich zwar immer noch erstmal meine tollen Bowie-Platten und die dazugehörigen Überlegungen anhören, doch als Fan war ich eher passiv geworden. Auch wenn ich es schön fand, dass er 1992 in Twin Peaks: Fire Walk with Me mitspielte, dass 1997 I’m Deranged der Soundtrack zu David Lynchs Lost Highway war, dass auf der letzten Party im Tresor in der Leipziger Straße »Heroes« gespielt wurde.
Ganz entspannt erinnerte er sich im Juli 2002 bei Harald Schmidt daran, wie er in der »Hauptstraße 155 in Charlottenburg« gewohnt hatte.
Spätestens seit 2002, dem 30. Jahrestag der Veröffentlichung von The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, der in England groß gefeiert worden war, war David Bowie wieder sehr präsent. In Folge erschienen 30th Anniversary-Editionen seiner großen 70er-Jahre-Alben, remastered und mit Bonustracks. Das Album Heathen war ein sowohl künstlerisch als auch kommerziell erfolgreiches Comeback, die Single Everyone Says ›Hi‹ lief oft in jenem heißen Sommer in London im BBC-Radio und Sohn Duncan Zowie, (der viele Jahre als Joey durch die Gegend lief, um dann doch wieder auf seinen Geburtsnamen zurückzukommen), moderierte die Präsentation der per Volksabstimmung ermittelten größten Bowie-Songs. In einer BBC-Serie über die hundert größten Briten wurde Bowie auf Platz 29 gewählt. In der BBC-Liste der größten lebenden Ikonen steht er sogar auf Rang 4. 2003 sollte er außerdem zum Ritter des britischen Empires geschlagen werden, was er aber ablehnte, ging noch einmal auf Welttournee, die er bekanntlich wegen einer akuten Arterienverstopfung im Herzen nach einem Konzert in Scheeßel, im Juni 2004, abbrach. Das war seltsam, weil ich 1977 in Scheeßel auf meinem ersten Rockfestival gewesen war. Es war ziemlich eindrucksvoll: weil viele der angekündigten Bands nicht gekommen waren, war die Bühne abgebrannt worden.
Längst war Bowie zum Elder Statesman des Pop geworden, dem Musiker aller Genres ihre Referenz erwiesen: 2004 hatte er Changes zusammen mit Butterfly Boucher für den Soundtrack von Shrek 2 gesungen. Im gleichen Jahr sang Seu Jorge alte Bowie-Songs auf Portugiesisch in Wes Andersons wunderbarer Jacques-Cousteau-Parodie The Life Aquatic with Steve Zissou. 2006 coverte Marc Almond The London Boys, einen schönen Song aus dem Frühwerk Bowies. Franz Ferdinand coverte Sound and Vision, Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, sang zusammen mit Apokalyptica die tausendste Version von »Heroes«, ein Titel, mit dem auch Ellen Alliens Compilation The Other Side – Berlin neulich begann.
Die Berliner Technoqueen und Labelchefin Ellen Allien erzählte, sie hätte durch das Übersetzen von Bowie-Songs Englisch gelernt. Die französische Sound-Designerin Béatrice Ardisson brachte 2007, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu Bowies 60stem, den Sampler Bowiemania mit 15 Evergreens heraus. Es erschien die Bowie-Cover-CD Life Beyond Mars, auf der Leute v.a. aus der elektronischen Musik sehr stilbewusst auch in der Auswahl zwölf Bowie-Titel interpretieren. Schöne, seltsame Bowie-Covers gibt es auch vom The Ukulele Orchestra of Great Britain. Und die irritierend androgyne Technopunkmusikerin Pilocka Krach schminkt sich das Gesicht wie Bowie auf dem Cover von Aladdin Sane. Und singt »David Bowie will never die«.
2006 koproduzierte und finanzierte Bowie den Dokumentarfilm 30 Century Man über Scott Walker und hatte vor allem einen kleinen, entspannt-souveränen Gastauftritt in der tollen britischen TV-Serie Extras, in der er den lustig-boshaften Song Little Fat Man sang, der an den Humor seiner ganz frühen Lieder anknüpfte. Im gleichen Jahr war sein vielleicht größter Song Titelgeber für die großartige britische Krimiserie Life on Mars. (Die Serie handelte von einem Polizisten aus der Jetztzeit, den es in die 70er Jahre verschlagen hat. Es ist unklar, ob er im Koma liegt oder ob das, was er erlebt, real ist.) Harald Fricke, den ich 1985 über Bowie kennen gelernt hatte, hatte über Life on Mars? seinen letzten, eleganten, schönen und traurigen Text geschrieben.
In dieser Zeit, Mitte der Nullerjahre, hatten wir begonnen, jedes Jahr zum Geburtstag einer Freundin Bowie-Lieder in einer Karaokebar zu singen. Under Pressure ist anfangs ganz schön schwierig, und Drive-In Saturday, mein Lieblingslied, macht am meisten Spaß.
In Bleckede besuchte ich eine Freundin, die dort ein Stipendium hatte, und lernte ihren Stipendiatskollegen, den damals 27jährigen chinesischen Künstler Taocheng Wang kennen. Tao ist ein großartiger Zeichner und macht viel Gendercrossing-Sachen. Es machte viel Spaß, ihm auf YouTube David Bowie vorzustellen, und ihm machte es viel Spaß, David Bowie kennenzulernen. Nachdem wir eine Stunde lang Bowie-Lieder geguckt hatten, sagte er: »I feel like I’ve been kissed.«
2012, bei der Abschlussfeier der Olympiade in London, wurden einige Bowie-Klassiker gespielt. Leute in Ziggy-Stardust-Kostümen waren auch dabei.
Die Beziehung zu Bowie war wie die zu einem potentiell besten Freund? älteren Bruder?, Onkel? – »every alien’s favourite cousin« nannte ihn Tilda Swinton in ihrer großartigen Rede zur Eröffnung der Bowie-Ausstellung in London, den man erst total verehrte und mit dem man sich dann ständig stritt, um sich dann, aus einer anderen Distanz, wieder mit ihm anzufreunden.
In seinen letzten Jahren hatte er viele sympathische Momente. The Next Day war eigentlich ein schönes Abschiedsgeschenk. Das Video zu The Stars (Are Out Tonight) ist großartig. Vor allem die Passage am Anfang, wenn Tilda Swinton zu Bowie sagt: »We have a nice life.«
PS:
»Some people are marching together
And some on their own
Quite alone
Others are running
The smaller ones crawl
But some sit in silence
They’re just older children
That’s all
After all« (After All)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Am Samstag waren wir noch im Neuen Ufer gewesen, hatten mit dem Bowie-Fanclub seinen 69ten Geburtstag nachgefeiert, ein paar Lieder gesungen, über die neue Platte gesprochen. Eine gute Freundin und ihr Freund aus London. Am Montagmorgen dann die Nachricht von seinem Tod, der einen ähnlich schockierte wie der Tod von John Lennon. Doch damals gab es noch kein Internet. Etwas ist zu Ende. Man guckt sich das supertraurige Lazarus-Video noch einmal an und versucht herauszufinden, ob auf den Blättern, die er am Ende des Videos so manisch beschreibt, tatsächlich »Help me!« steht, man bastelt an Texten, liest, hört die ganzen Sachen noch einmal. Gespräche. Erinnerungen.
Auf YouTube die Aufnahmen vom Konzert am 10. April 1976 in der Deutschlandhalle; das müsste das Konzert sein, von dem Christiane F. in Die Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt. Am Ende von Stay (ab 4:45) bittet er die Fans Backstage, »if you want too«.
Wie war das noch mal? Erst war Hermann Hesse mein Held, dann Jack Kerouac und dann David Bowie, der in einem Interview erzählt, wie enttäuscht er war, als Kerouac in Interviews über die Jugend von heute, über seine Fans also, schimpfte.
Endlos weiter erzählen, ergänzen, ausbauen. Wie Bowie-Fans so waren, die meisten hatten ja auch einen Knacks, manche waren ja auch total anstrengend, aber toll, oder dass man sich oft vorgestellt hatte, After All würde auf der eigenen Beerdigung laufen.
Bowies erste Frau Angie bekam die Todesnachricht mit einem Tag Verspätung, als sie im Big-Brother-Haus war – wichtige Information.
»We think Bowie knows something« schrieb der Science-Fiction-Schriftsteller Philip K. Dick in sein Tagebuch, schrieb Dietmar Dath in der FAZ. (Ganz wichtig.)
Man will sich nicht trennen. Man wird wieder Bowie-Lieder singen, aber es wird nicht mehr das Gleiche sein.