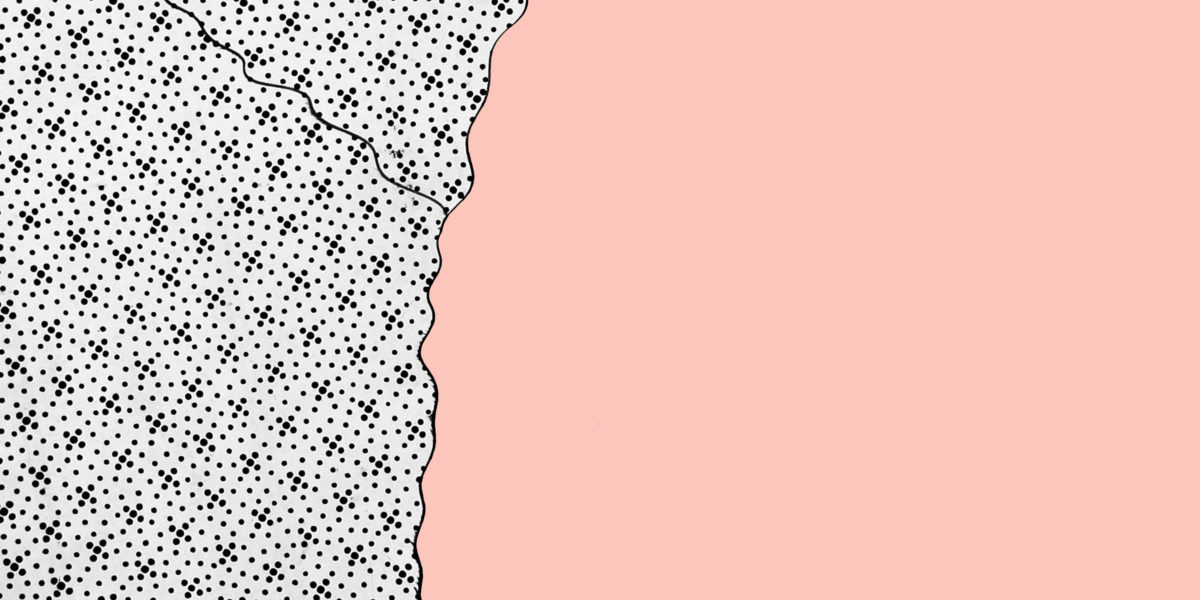Zum 30. Mauerfall-Jubiläum am 9. November 2019 versammeln wir im Logbuch Suhrkamp Beiträge zu diesem Themenschwerpunkt. Eröffnet wird die Reihe mit Fotografien von Andreas Rost, die vor allem im Frühjahr 1990 in Berlin, Leipzig und Dresden entstanden sind. Es folgen ein Text von Emma Braslavsky und ein Langgedicht von Angela Krauß. Steffen Mau blickt anschließend auf seine Lektüre von Lutz Seilers Kruso zurück, Bodo Mrozek führt mit Ilko-Sascha Kowalczuk ein Gespräch über den »Sound der Wende«, und mit den Beiträgen von Deniz Utlu und Wolfram Höll beschließen wir die Serie.
Gedanken über Insel- und Wendekinder
I Die absenten Verse
José González sagt, who cares in a hundred years from now?
John Maynard Keynes sagt, auf lange Sicht sind wir alle tot.
Selma Meerbaum-Eisinger sagt, es weint mein Mund.
Ich weiß nicht, was davon zutreffen wird in zwanzig Jahren, wenn die Republik – vermutlich besteht sie dann noch – das fünfzigste Jahr nach dem Mauerfall feiert. Am 9. November 2039 werde ich wahrscheinlich, wie auch schon am 9. November 2014, das Bild der jungen Selma Meerbaum-Eisinger betrachten und an all die Verse denken, die sie noch geschrieben hätte und die mich niemals erreichen werden. Ich werde nach Worten für die Absenz dieser Verse suchen, und genau an diesem Tag wird in meinem Gedenken kein Platz für den Mauerfall sein. Vergessen wir nicht, was der Gründung dieser Republik, dieser beiden Republiken, von denen es eine nicht mehr gibt, vorangegangen ist.
Erinnern ist keine Frage der Moral. Sondern Teil eines Versuchs zu begreifen, aber es ist unbegreiflich, und wir ahnen, dass das der Grund ist, warum wir so umständlich sprechen, warum wir so kryptisch werden, wenn wir über Vergangenheit reden. Dieser Blick in die Vergangenheit mag wenig konstruktiv erscheinen, wenn nach der Zukunft gefragt wird – geht es doch immer darum, wie wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Wenn ich nicht konstruktiv bin, dann, weil mir diese Konstruktion von Zukunft gleich Vergangenheit in Abhängigkeit vom Lernen zu funktional erscheint. Und weil es mir nicht allein darum geht, was ich lernen kann. Konstruktiv sein als Bedingung der Kritik aufzustellen, heißt, wie Adorno einmal gesagt hat, die Abschaffung der Kritik. Ich stelle mir vor, wie ich in der Zukunft über die Vergangenheit nachdenke, und ich tue das aus meinem Jetzt heraus, weil ich Prognosen lieber den Meteorologen überlasse.
II Herr der Fliegen
Ist nicht jeder Gedanke über ein kollektives Gedächtnis bereits nationalistisch – im Sinne einer europäischen Tradition des Nationalstaates? Und ist die Suche nach einem nationalen Narrativ nicht immer auch kaschierte Suche nach einem neuen Nationalismus, zum Beispiel die Erzählung einer vorbildhaften »Vergangenheitsbewältigung« oder eine Erzählung über die Aufhebung von Grenzen, ein Volk vereint im Namen der Freiheit und der Würde des Menschen.
Aber im Leben jedes Individuums gibt es eine Zeit davor, als es noch kein oder nur ein geringes Bewusstsein für das gibt, was wir Nation nennen oder kollektives Gedächtnis. In seinem Roman Lord of the Flies hat sich William Golding 1954 an das Gedankenexperiment gewagt, zu betrachten, wie Kinder ohne Eltern die Verhältnisse der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, reproduzieren: Eine Gruppe von britischen Kindern wird aufgrund eines Atomkrieges evakuiert. Das Flugzeug stürzt ab, die Kinder überleben und sind auf einer Insel sich selbst überlassen. – Der Roman wurde oft dahingehend interpretiert, dass sich bei den Kindern die angeborene Gewaltbereitschaft gegenüber den zivilisatorisch anerzogenen Verhaltensmustern durchsetzt. Diese Lesart interessiert mich nicht. Ich kann mir auch eine Deutung vorstellen, in der sich die gelebten gesellschaftlichen Werte gegenüber den behaupteten mit der Brutalität einer kindlichen Ehrlichkeit durchsetzen. Hier würde es dann nicht mehr um ein Spannungsverhältnis von menschlicher »Natur« und »Zivilisation« gehen, sondern um ein Spannungsverhältnis von Narrativ und Praxis, etwa die Erzählung einer freiheitlichen Ordnung gegenüber einer tödlichen Flüchtlingspolitik oder die Erzählung von Nächstenliebe gegenüber gelebten Ressentiments. Ich stelle mir diesen Roman als Wenderoman vor, und die Inselbewohner sind nicht englische Eliteschüler, sondern Kinder westdeutscher, ostdeutscher und migrantischer (aus Ost und West) Familien. Wie würden diese Kinder sich zueinander verhalten? Würden sich Gruppen bilden wie bei Lord of the Flies? Und wenn ja, was wären die Kriterien für die Gruppenbildung? Welche Elemente unserer Gesellschaft würden die Kinder auf dieser Insel offenlegen? Würden sich die westdeutschen Sechs- bis Zwölfjährigen den ostdeutschen überlegen fühlen? Gäbe es diese beiden Gruppen? Welcher würden sich die Westberliner zuordnen? Welcher die Migrantenkinder? Oder wäre in ihrer kleinen Inselgesellschaft nichts irrelevanter als diese Fragen?
III Schulstorys
Als Student fuhr ich 2007 gemeinsam mit einem Kurs zwar nicht auf eine Insel, aber aufs Land, weil unser Blockseminar an einem Wochenende in Brandenburg abgehalten werden sollte. Ich erinnere mich an fast nichts mehr von diesem Seminar, noch nicht einmal an Titel oder Thema. Nur ein einziger Abend ist mir in Erinnerung geblieben: Es muss die erste Nacht gewesen sein, wir waren euphorisch – eine »Landheimfahrt« mit Anfang zwanzig –, das Bier wurde in Maßkrügen gehoben, die Gespräche waren laut, die Möbel Relikte aus der DDR. Am Ende des Abends, in den Gläsern nur noch Restschaum, saß ich an einem Tisch mit Jasmin und einem Kommilitonen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, nennen wir ihn Markus. Markus war westdeutsch, angeheitert und hatte Augen nur für Jasmin, Jasmin war angeheitert und ganz in ihrem Element. Markus wies auf den Raum, die mittlerweile müden Gestalten an den Tischen, die DDR-Möbel, und er meinte wohl auch die Radiomusik, deutsche Schnulzen, als er sagte: »Ein bisschen wie in einer Ossi-Disko damals, oder?« Ich weiß wirklich nicht, ob das witzig sein sollte oder, schlimmer noch, romantisch, ob er vielleicht zeigen wollte, dass er sich mit Ostdeutschland auskennt, dass ihn das interessiert.
Jasmin lächelte ihn jedenfalls an, und er errötete ein wenig, als hätte er selber nicht daran geglaubt, mit so etwas bei ihr zu landen. Sie kicherte und sagte: »Süß.« Markus wurde noch röter und grinste breit, er fragte: »Was meinst du?« Sie kicherte weiter. »Was meinst du?«, wiederholte er. »Was ist süß?« »Dein Versuch«, sagte Jasmin. Das Lächeln in Markus’ Gesicht löste sich auf wie Dunst, den jemand aufs Fensterglas gehaucht hatte. »Was meinst du?«, fragte er wieder, sein Vokabular schien nur noch aus diesen drei Wörtern zu bestehen. »Na, dass du echt nichts anderes hast, um mit einer Frau ins Gespräch zu kommen. Soll ich mir für dich ein Pionierhalstuch umbinden?«
Markus war betreten, Jasmin kicherte, und ich staunte. Diese vernichtende Schlagfertigkeit kannte ich, wenn ich ganz ehrlich war, bis zu dem Zeitpunkt nur von migrantischen oder schwarzen Frauen, wenn sie bei einer Avance exotisiert wurden und dann heftig austeilten. Als Jasmin fertig war mit dem Typen, tat er mir fast leid. Eine Weile wusste er nichts zu sagen, dann fragte er nach der Uhrzeit und verabschiedete sich.
Ab jenem Abend fühlte ich mich Jasmin auf eine Art verbunden, und wenn wir in den darauffolgenden Wochen zusammen in einer größeren Gruppe Studierender in der Mensa aßen oder auf der Wiese vor dem Institut lagen und Jasmin auf Ossi-Späße reagierte oder ich in ein Wortgefecht über Migration in Deutschland geriet, stolperten die anderen über unsere spitzen Antworten, aber wir beide lachten viel – wir sprachen dieselbe Sprache.
Im Alter von sechs bis zwölf wusste ich nicht, was ein »Ossi« ist. Mir war bekannt, dass es zwei deutsche Republiken gegeben hatte, aber ich konnte mit dieser Information nicht viel anfangen. Erst später begriff ich, dass Mitschülerinnen mit Namen wie Danny, Rebecca, Mandy und Enriko aus Ostdeutschland kamen. Wenn ich heute an diese Mitschüler zurückdenke, kommen sie mir fehl am Platz vor. Kinder, die nicht dorthin, auf diese Schule in Hannover, gehörten, aber aufgrund von Umständen, für die sie nichts konnten, eben dorthin geraten waren. Wo sie herkamen, trug man Kleidung, die anders geschnitten war und für die Stoffe mit anderen Farben benutzt wurden, die Brillengestelle der Kinder waren drahtige Erwachsenenmodelle, die Mädchen trugen Röcke, die bis zu den Knöcheln reichten. Mandy wohnte im Haus nebenan, sie besaß eine Bundeswehrjacke mit der Flagge der Bundesrepublik auf der Schulter, wir hatten denselben Schulweg und redeten oft noch lange vor unseren Haustüren, bevor wir die Schlüssel aus unseren Ranzen kramten. Es gab keine wirklichen Gesprächsthemen, in unseren Unterhaltungen ging es hauptsächlich darum, wer die besseren Sprüche klopfte und wer schlagfertiger konterte. Und bei keinem dieser Sprüche ging es je um »Ossis« oder »Türken«.
Ich weiß nicht, ob wir uns in einer Gruppe zusammengetan hätten, wenn wir auf einer Insel uns selbst überlassen worden wären. Es ist möglich, dass ich Enriko aufgesucht hätte, weil wir gleich stark im Armdrücken waren. Höchstwahrscheinlich hätte ich versucht, in die Gruppe des Mädchens zu kommen, in das ich damals unsterblich verliebt war.
Ich hatte also ostdeutsche Freunde, ich wusste nur nicht, dass sie ostdeutsch waren, das begriff ich erst während des Studiums in Berlin. Und erst in Berlin entstand so etwas wie Solidarität zwischen mir und Jasmin, aber das war eben nur die Solidarität zwischen ihr und mir und nicht zwischen irgendwelchen Gruppen und ganz sicher nicht zwischen Türken und Ostdeutschen. Ich bin mir nie sicher, ob Diskurse sich nicht einfach auf unsere Beziehungen setzen und anfangen, diese von außen zu bestimmen, und eine ehrliche Begegnung miteinander, eine innige letztlich, erschweren. Solidarität heißt dann manchmal, der Macht des Diskurses zu widerstehen, um uns füreinander zu öffnen.
IV A hundred years from now
Wen kümmert das alles noch in hundert Jahren? Ich kann nur sagen, es gibt Menschen, die kümmern sich seit fünfhundert Jahren. Spätestens seit Kolumbus und seiner Reise. Ich meine nicht Historiker, sondern Menschen, die bis heute die Folgen des Kolonialismus bekämpfen oder die bis heute an den Folgen des Kolonialismus leiden – und ich kann die Wende nicht außerhalb einer größeren Geschichte lesen: etwa von einem schwarzen Mann namens Oury Jalloh, der sich in einer Gefängniszelle in Dessau Verbrennungen zuzieht, an denen er verstirbt, etwa von Afrodeutschen, die verlangen, dass die »Mohrenstraße« in Berlin-Mitte umbenannt wird, etwa von Menschen, die fassungslos (nicht überrascht!) angesichts der NSU-Morde sind und darüber nachdenken, wann das Phänomen Rassismus entstanden ist, wie es sich transformiert hat und wie es heute noch so tief in unsere Gesellschaft hineinragen kann.
Die ersten Arbeiterinnen, die gehen mussten nach dem Aufkauf und Abbau ostdeutscher Industrie, waren die ausländischen. Sie mussten nicht nur ihre Arbeitsplätze räumen, sie mussten das Land verlassen. Die Bilder vietnamesischer Arbeiter beim Check-in zu ihrer Abschiebung bleiben unvergessen. Die Ermordung des angolanischen Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde. Die Hetze gegen Migrantinnen Anfang der Neunziger. Brennende Flüchtlingsunterkünfte und türkische Familien. Eine Stadt mit 90 000 Einwohnern in Sachsen, in der die Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds gemütlich abtauchen konnten. Montagsdemonstrationen in Dresden mit spitzenzeitlich bis zu 25 000 Teilnehmern gegen die »Islamisierung des Abendlandes«.
Was hat das alles mit mir und Mandy zu tun?
Was mit mir und Selma Meerbaum-Eisinger?
Was hat das mit der »Wiedervereinigung« zu tun?
Wenn ich darüber nachdenke, ob sich Kinder in einem Lord of the Flies-Szenario eher abschlachten oder eher helfen würden, dann hat das sehr viel damit zu tun. Ich würde gerne behaupten, dass all das auf der Insel, auf der wir bei unserer gescheiterten Evakuierung stranden, bedeutungslos werden würde. Nicht weil es nicht schrecklich wäre, sondern weil wir Kinder sind und noch niemanden umgebracht, noch keinen Mörder versteckt und keinen Flüchtling verraten hätten und weil wir noch keine Opfer von Definitionen wären.
Ich würde gerne behaupten, dass wir auf dieser Insel Feuer entzünden auf den Berggipfeln, um Schiffe und Flugzeuge auf uns aufmerksam zu machen, dass wir gemeinsam unser Überleben in fremder Umgebung organisieren, dass wir am Ende eines anstrengenden Tages auf der Suche nach Nahrung und vor Anbruch einer beängstigenden Nacht mit all diesen Geräuschen, die wir nicht zuordnen können, Arm in Arm liegen und jeder jedem verspricht, dass er keine Angst vor dem Ungeheuer haben muss. Aber ich weiß, dass wir auch mit sechs Jahren schon, selbst wenn wir die Definitionen nicht kennen, die Konzepte hinter den Definitionen spüren, dass wir bereits ein Gefühl haben für Eigentum, Hierarchie und Bewertungen von Mensch und weniger Mensch. Ich denke nicht an Thomas Hobbes, nicht an den Krieg eines jeden gegen alle anderen, ich kenne keinen »Naturzustand«, ich fürchte nur das Diktum unseres Erbes.
Übrigens, falls jemand auf die Idee kommen sollte, Goldings Lord of the Flies als Wenderoman zu adaptieren: Lasst uns nicht so tun, als wäre diese Insel der Evakuierten vor unserer Ankunft unbewohnt gewesen.
V Kausalitätspause
Der Mauerfall und dann die »Wende«, das ist kein Einschnitt, sondern eine Konsequenz, so wie historische Ereignisse immer die Konsequenz menschlichen Handelns, menschlicher Aktion oder Reaktion sind. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, weil ich nach der Zukunft gefragt werde, dann tue ich das nicht, um Kausalitäten zu rekonstruieren – von Kolumbus über Kolonialismus, Gobineau, Aufklärung, Industrialisierung, Berliner Konferenz, Namibia, Armenien, Shoah, Kalter Krieg, Mauerfall, bis zum Krieg gegen Geflüchtete, wie einige Menschenrechtsaktivisten das Vorgehen des europäischen Grenzschutzes im Mittelmeer nennen. Es geht mir nicht darum, danach zu fragen, wie die Industrialisierung hätte gestaltet werden müssen, damit Bismarck nicht die Berliner Konferenz veranstaltet hätte, auf der die europäischen Mächte Afrika unter sich aufteilten. Nein, diesmal geht es nicht um das Lernen aus der Vergangenheit, um heute anders zu handeln, um das Verstehen von Kausalitäten, die zu Katastrophen geführt haben, um sie nicht zu wiederholen. Das ist wichtig, und ich wünsche mir, dass eine Horde von Sozialwissenschaftlerinnen sich auf die Analyse dieser Zusammenhänge schmeißt, und es beruhigt mich zu wissen, dass einige Forscher und Denkerinnen seit vielen Jahren nicht müde werden, das zu tun. Ich, für meinen Teil, suche lediglich nach Verbindungen zwischen den Menschen, die nicht geheuchelt sind, die nicht aus einem allzu menschlichen Zugehörigkeitswunsch entstehen, für den wir bereit sind, über einiges zu schweigen. Ich will, dass wir endlich miteinander sprechen, anstatt nur zu behaupten, zu projizieren und nur strategische – aber eben nie menschliche – Koalitionen zu bilden.
Ich weiß nicht, ob diese menschlichen Koalitionen in zwanzig Jahren möglich sein werden. Ich weiß nur, dass es für eine solche Koalition nicht ausreicht, dass wir uns daran erinnern, dass die Grundschulen westdeutscher Städte in den 1990er-Jahren Orte waren, an denen sich Ostdeutsche wie auch Türken manchmal fehl am Platz fühlten – und wo immer sich ein Kind fehl am Platz fühlt, ist nie das Kind schuld, sondern immer nur der Platz. Auch die Unterschiedlichkeit der Gründe und Wege, die diese Kinder in diese Situationen gebracht haben, verdient Anerkennung, ein türkischer Schüler ist anders fehl am Platz als eine ostdeutsche Schülerin – eine ehrliche Suche nach Verbindungen kaschiert nicht die unterschiedliche Verteilung von Privilegien und historischer Last. So gedacht ist es völlig ausgeschlossen, dass es mit der »deutschen Einheit« auch eine Einheit der Geschichten gibt, vielleicht scheitern wir deshalb so sehr an einem nationalen Narrativ. Aber gerade auch deshalb brauchen wir es vielleicht nicht mehr.