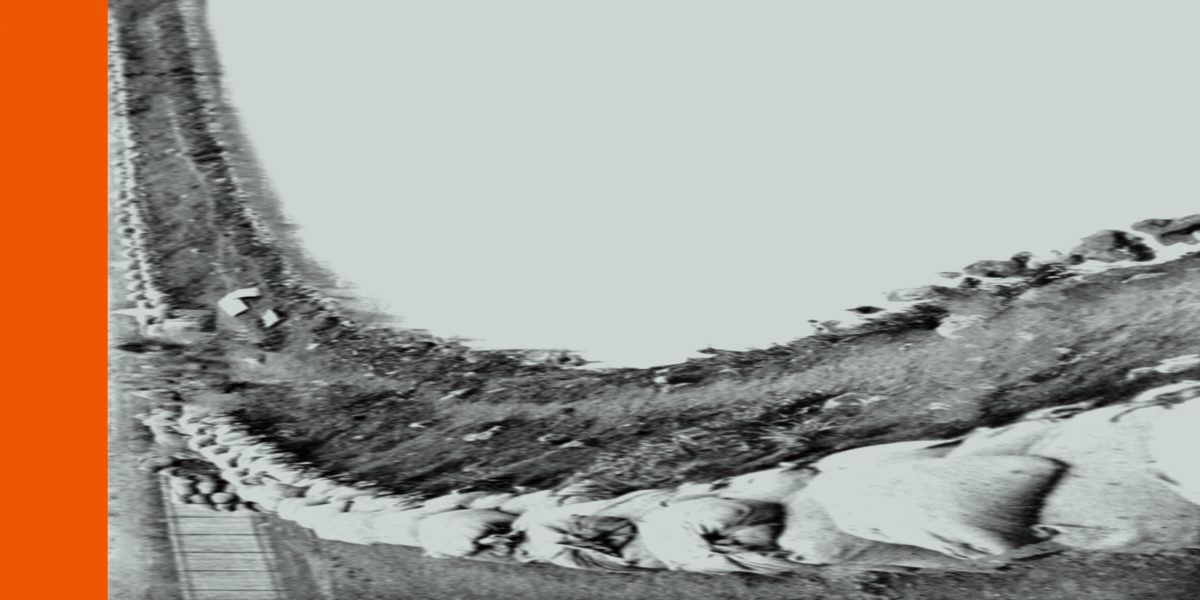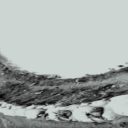Bei der Recherche zu seinem Stück Im Schatten kalter Sterne stieß Christoph Nußbaumeder auf einen Klassiker der Wirtschaftswissenschaft, The Great Transformation.
1
Seit Oktober 1945 ist das Führen von Kriegen durch die UN-Charta verboten.
Man beabsichtigte, Kriege als »eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln« (Carl von Clausewitz) nicht nur moralisch zu ächten, sondern auch gesetzlich zu unterbinden. Die Vereinten Nationen erlauben jedoch im Kapitel VII ihres Regelwerks die Nutzung militärischer Mittel gegen Feinde des internationalen Friedens. Damit sind alle Kriege, sofern sie legal sein wollen, zu bloßen Polizeiaktionen der internationalen Staatengemeinschaft umdefiniert. Im eigentlich juristischen Sinne gibt es somit keine Kriege mehr, sondern nur noch Einsätze der Staatengemeinschaft gegen aggressive Mächte und andere »Bedrohungen des Friedens«. Aufgrund dessen ist heute bei Kriegseinsätzen oft von militärischen Interventionen, von Aufstandsbekämpfungen, gelegentlich auch von Friedenserzwingungen die Rede. Die Euphemismen variieren.
Trotzdem änderte das Verbot nichts daran, dass das organisierte Morden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unverdrossen weitergegangen ist, insgesamt schätzt man die Anzahl der Todesopfer auf über 40 Millionen.
Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) vermeldet unter der Überschrift Krisen und Kriege 2017 aktuell »402 Konflikte, von denen 225 unter Gewalteinsatz ausgetragen wurden«.
Es gibt Kriege, die eine lange Konfliktgeschichte aufweisen und das Ergebnis weitreichender Planungen sind. Manchmal braucht es aber nur einen marginalen Anlass, um zügellose Gewalt auszulösen. Daher ist es ein Irrtum, anzunehmen, Kriege würden stets den zielgerichteten Absichten entschlossener Akteure entspringen.
Dennoch hat jeder Krieg strukturelle Ursachen. Und selbst wenn man von Kriegen nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen wird, so machen sie sich mittels Gesetzgebung auf klandestine Art bemerkbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der internationalen Völkergemeinschaft eine Übereinkunft, die besagte, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Herkunft und Religionszugehörigkeit die gleichen unveräußerlichen Menschenrechte besäßen. Der von der US-Regierung kurz nach dem 11. September erklärte »global war on terror« setzte diese Garantien jedoch kurzerhand außer Kraft. Bürgerliche Freiheitsrechte wurden auf breiter Ebene beschnitten. »Letztlich geht es darum, den Sicherheitsbehörden und gegebenenfalls dem Militär im globalen Anti-Terror-Krieg freie Hand zu lassen. Zum Instrumentenkasten gehören Geheimhaltung staatlicher Aktivitäten, gezielte Desinformation und Zensur, ebenso Demonstrationsverbote und umfassende Überwachung«, so Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit.
2
Krieg trägt der Tatsache Rechnung, dass Menschen andere Menschen umbringen, obwohl sie sich nicht kennen, obwohl sie persönlich nie etwas miteinander zu tun hatten. Ganz gleich, ob dies nun im Gefecht auf offenem Feld, als Guerillakrieg mit Duellcharakter oder als Kampfeinsatz im Zeitalter der »Joystick-Kriegsführung« geschieht.
Wie der Großteil der Weltbevölkerung lehne ich Krieg entschieden ab, er stellt die schlechteste aller politischen Entscheidungen dar, denn er löst keine Probleme, er vermehrt sie nur. Er gleicht einer Chimäre aus Exzess und Unterwerfung, an der auch die Nachkommen noch auf vielfältige Art zu leiden haben. Krieg verseucht die Menschheit, indem er Menschlichkeit verneint. Begibt man sich nun auf die Suche nach Kriegsursachen, so lohnt es sich nicht, auf die Narration der Massenmedien einzugehen, die bekanntlich nicht ausschließlich für das Wohl der Welt zuständig sind. Zu Erklärungszwecken kreieren sie meist simple Feindbilder und buchstabieren die Geschichte vom skrupellosen Diktator oder vom Schurkenstaat mustergültig durch. Ihr Fazit: Man muss sich unbedingt gegen den Schlächter oder gegen das XY-Regime verteidigen, bevor diese Unmenschen unsere Freiheit zerstören.
Die Problemverschlingungen sind allerdings wesentlich komplexer. Und jeder, der das Gestrüpp aus Kriegspropaganda inklusive Dämonisierung beiseiteschiebt, wird feststellen, dass sich globale Kriege meist um Rohstoffsicherung oder geostrategische Interessen drehen, was aber auch nicht neu ist, es ist vielmehr eine Binse. Selbst ethnische Konflikte haben im Kern meist andere Ursachen als Kultur- oder Religionsunterschiede, wie Christoph Antweiler, Ethnologe und Mitglied der Academia Europaea, erläutert: »Die meisten sogenannten ethnischen Konflikte haben andere Ursachen, etwa Benachteiligung oder Ressourcenknappheit. Typisch sind die Bürgerkriege in Ruanda oder Exjugoslawien. Sie hatten sozioökonomische Ursachen, die nachträglich kulturell eingefärbt wurden (…).« Analog zu dieser Einschätzung haben Studien ergeben, dass der westliche Rassismus – verkürzt gesagt – nicht die Voraussetzung, sondern das Produkt von Sklaverei war.
Krieg war aber auch schon immer ein einträgliches Geschäft. Wo man in feudalen Zeiten Beutezüge unternehmen musste, kann heutzutage jeder Marktteilnehmer ganz bequem mit ein paar Mausklicks Rüstungsaktien kaufen. Die neuzeitliche Grundlage aus Profitmaximierung durch Kriegsinvestition beschreibt David Graeber in seinem hervorragendem Buch Schulden – Die ersten 5000 Jahre folgendermaßen: »Das moderne Geld hat seinen Ursprung in Staatsschulden, denn Staaten leihen sich Geld, um Kriege zu finanzieren. Das gilt heute genauso wie im 16. Jahrhundert (…). Mit der Gründung der Zentralbanken wurde die Verschmelzung der Interessen von Kriegsherren und Geldgebern (…) dauerhaft institutionalisiert. Diese ›Interessensgemeinschaft‹ schuf die Grundlage für den Finanzkapitalismus.«
Dabei heißt es seit dem 19. Jahrhundert verheißungsvoll, dass der Welthandel Weltfrieden garantieren würde. In gewisser Weise ist da etwas dran, denn der Kapitalismus braucht intakte Märkte, samt potenzieller Konsumenten. Somit sind Handelsunternehmer und Hochfinanz grundsätzlich an funktionierenden Absatzmärkten interessiert und nicht an der Verwüstung selbiger. Deshalb hatten Banken keinen unwesentlichen Anteil daran, dass es zwischen 1815 und 1914 zu einem fast hundertjährigen Frieden kam. Abgesehen vom Krimkrieg waren England, Frankreich, Preußen, Österreich, Italien und Russland nur insgesamt achtzehn Monate lang in Kriege verwickelt. Aber wie sieht es heute aus, welche Strukturen sind es, die Kriege trotz UN-Verbot und etlicher Freihandelsabkommen in verlässlicher Regelmäßigkeit ausbrechen lassen?
3
Ich hatte mich für ein Theaterstück dem Thema »autonome Waffentechnik« zugewandt. Der junge Held arbeitet als Programmierer für eine Rüstungsfirma, bekommt ein schlechtes Gewissen und muss seine Glücksansprüche abwägen.
Im Zuge dessen hatte ich mich mit Regime Changes, False-Flag-Aktionen und anderen politischen Abschattierungen beschäftigt, alles sehr spannend, mitunter erschreckend, aber ich wollte den von Graeber beschriebenen Umstand genauer aufgedröselt wissen. Mit der bloßen Behauptung, die »Märkte« oder das »System« seien schuld an der Misere, mochte ich mich nicht abfinden. Ich wollte mich mit einer profunden volkswirtschaftlichen Analyse beschäftigen, die mir die Zusammenhänge von Kapitalismus und Krieg erklären würde (ob eine profunde Analyse ausreicht, ist natürlich anzuzweifeln, ob die wesentlichen Antworten in der Volkswirtschaftlehre zu finden sind, eine grundsätzlichere Frage). Jedenfalls bin ich über Umwege auf The Great Transformation von Karl Polanyi gestoßen. Das Buch mit dem Untertitel Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen stammt aus dem Jahr 1944, aber laut der Washington Post ist es nach wie vor, »a classic of 20th century political economy«. Zwei Wochen lang habe ich mich durch das Werk gegraben wie ein Bergarbeiter durch einen verdammt hart zu schürfenden Stollen. Ich muss zugeben, dass mir in mancher Hinsicht Vorbildung und Sachkenntnis fehlten, um alles nachvollziehen zu können, gleichwohl könnte das Buch besser strukturiert sein. Nicht selten springt der Autor unvermittelt zwischen mehreren Themen hin und her. Wo er ausführlicher sein dürfte, hält er sich bisweilen zurück, und wo er sich kurzfassen könnte, ufert er aus und verliert sich in Detailausschmückungen. Dennoch hat mir die Lektüre wertvolle Denkanstöße verschafft, denn Polanyi öffnete mir einen viel weiteren Diskursraum, als ich angenommen hatte. Aber der Reihe nach. Zunächst unternimmt er einen Streifzug durch die Geschichte des Handels und der Märkte. Dabei widerspricht Polanyi der berühmten These von Adam Smith, die besagt, Arbeitsteilung beruhe »auf der Neigung des Menschen zum Tausch, zum Handel und zum Umtausch einer Sache gegen eine andere«. Diese Annahme, wie sie Smith in The Wealth of Nations (1776) verbreitet hat, sei grundfalsch. Nach Polanyis Forschungen entsteht Arbeitsteilung vornehmlich aus der natürlichen Verschiedenheit der Geschlechter, aus der geografischen Lage und aus individuellen Fähigkeiten. Die Neigung »des Naturmenschen zu gewinnbringenden Betätigungen« sei ein Vorurteil, der Mensch als geborener Homo oeconomicus eine Legende.
»Die neue historische und anthropologische Forschung brachte die große Erkenntnis«, so Polanyi, »dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen in der Regel in seine Sozialbeziehungen eingebettet ist. Sein Tun gilt nicht der Sicherung seines individuellen Interesses an materiellem Besitz, sondern der Sicherung seines gesellschaftlichen Rangs, seiner gesellschaftlichen Ansprüche und seiner gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Er schätzt materielle Güter nur insoweit, als sie diesem Zweck dienen.« Ausgehend nun von diesem Menschenbild erläutert Polanyi die kapitalistische Entwicklung im Viktorianischen England und markiert für den Beginn des Industriekapitalismus das Jahr 1834. In jenem Jahr wurde die Armenrechtsreform eingeleitet und in Folge der sogenannte freie Markt endgültig etabliert. Polanyi beschreibt, wie führende Denker der Marktwirtschaft »den Rang einer weltlichen Religion« beimaßen. Sie haben die Politik dazu bewogen, Arbeit, Geld und Natur, die nicht für den Verkauf produziert werden und deshalb keine Güter an sich sind, in Waren zu verwandeln und dafür entsprechende Märkte künstlich aufzubauen. Die Vermarktung des Menschen unter dem Namen »Arbeitskraft« und die der Natur unter dem Begriffspaar »Grund und Boden« nahmen damals ihren Anfang. Doch Arbeit, so Polanyi, ist in soziale Bindungen integriert, die Natur ist von der Evolution ererbt und das Geld ist im Grunde genommen als Zeichensystem überliefert. Polanyi nennt den Vorgang die »Entbettung« des Marktes aus der Gesellschaft.
Die wirtschaftsliberale Utopie meinte stattdessen, dass die Arbeit, die Natur und das Geld zu nichts als Gütern werden sollten, ohne Rückbindung an die Lebenswelt, ohne Rücksicht auf Ökosysteme. Diese Kommodifizierung des Lebens und der Natur hatte für die Mehrzahl der Menschen verheerende Konsequenzen, während ein paar wenige enormen Reichtum generieren konnten. Daraus schloss Polanyi, dass die Idee eines selbstregulierten Marktes eine krasse Utopie bedeute. »Eine solche Institution (…) hätte den Menschen physisch zerstört und seine Umwelt in eine Wildnis verwandelt.« Um nun dieser sich abzeichnenden Zerstörung vorzubeugen, sah sich die Politik gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen: Arbeiterschutz, Versicherungen, Zölle, Naturschutz, Zentralbanken sowie Kreditkontrolle waren die Reaktionen, um die Gesellschaft vor dem Markt zu schützen. Polanyi wusste, dass diese »Doppelbewegung« nicht von Dauer sein konnte, zu widersprüchlich waren die Mechanismen des Marktes und die Hilfestellungen der Politik. Im 20. Jahrhundert, vor allem nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, führten diese nur zu einer Desorganisation der industriellen Entwicklung. Als letztendlich der Goldstandard zugunsten von Wechselkursen aufgelöst wurde, entfesselten sich die aufgestauten sozialen Spannungen vollends. »Kurz gesagt, die Spannungen kamen aus dem Bereich des Marktes, von dort erfassten sie den politischen Bereich und damit die Gesellschaft als Ganzes.«
Immer wieder rückt Polanyi die Bedeutung der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Ihre Aushöhlung durch das Marktsystem verleitete die Menschen, Schutz und Behausung in heilsversprechenden Bewegungen wie dem Faschismus oder dem Bolschewismus zu suchen. Erst die kulturelle und soziale Verwahrlosung, hervorgebracht durch einen institutionalisierten Materialismus, vermochte es, Menschenmassen in die Katastrophe zu manövrieren.
Im Hauptteil beschreibt Polanyi etwas sehr Hellsichtiges: »Nicht die wirtschaftliche Ausbeutung ist in diesem Fall die Ursache des Niedergangs, wie dies oft angenommen wird, sondern der Zerfall des kulturellen Ambiente der Opfer. Die ökonomische Entwicklung kann natürlich das Vehikel der Zerstörung sein, (…) aber die eigentliche Ursache eines Niedergangs ist deshalb nicht ökonomischer Natur, sondern vielmehr die tödliche Schädigung der Institutionen, in die sein gesellschaftliches Sein eingebettet ist. Das Ergebnis ist der Verlust der Selbstachtung und der Maßstäbe, ob es sich nun um ein Volk oder eine Klasse handelt (…).«
Gut 70 Jahre später finden derlei Menschen ihre Entsprechung in den sogenannten »Modernisierungsverlierern«. Menschen, die wirtschaftlich betrachtet nicht unbedingt arm sind, sich aber gesellschaftlich abgehängt fühlen. Diese haben sich entweder vom Meinungsbildungsprozess entfernt oder laufen europaweit in Scharen rechtsnationalen Parteien zu. Der Harvard-Professor Dani Rodrik kommt in seiner Studie Populism and the Economics of Globalisation vom August 2017 zu dem Ergebnis, dass die politische Rechte vor allem dort erfolgreich sei, wo die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung in den Vordergrund rücken und die Rechten Identitätspolitik betreiben. Ihre Entrüstung findet gegenwärtig Ausdruck im greifbaren Protest gegen die Aufnahme von Flüchtlingsströmen aus Kriegsgebieten oder Hilfesuchenden aus ökonomisch verwahrlosten Regionen, nicht wenige davon etikettiert man als »Klimaflüchtlinge«, Greenpeace-Hochrechnungen zufolge 200 Millionen in den kommenden drei Jahrzehnten.
Knapp 200 Jahre ressourcenaufzehrende Marktwirtschaft haben ausgereicht, den Planeten in eine Mülldeponie zu transformieren und sturmreif zu schießen. Robert Kurz nannte diese Dynamik einmal den »Todestrieb des Kapitals«.
»Die eigentliche Kritik an der Marktgesellschaft«, schreibt Polanyi gegen Ende, im Ton einer Grabrede, »besteht nicht darin, dass sie auf ökonomischen Prinzipien beruhte – in gewissem Sinne muss jegliche Gesellschaft darauf beruhen –, sondern darin, dass ihre Wirtschaft auf dem Eigeninteresse beruhte. Eine solche Organisation des Wirtschaftslebens ist unnatürlich und im rein empirischen Sinn außergewöhnlich.«
4
Nach der Finanzkrise, die kaum ein Wirtschaftswissenschaftler vorhergesehen hatte, war die Empörung groß. »Das ganze intellektuelle Gedankengebäude ist mit der Krise in sich zusammengestürzt«, musste selbst Alan Greenspan, damaliger US-Notenbank-Chef, einräumen. Ökonomiestudenten auf der ganzen Welt protestierten und forderten eine Neuausrichtung. In dieser Zeit gab es eine Polanyi-Renaissance. Fast zehn Jahre nach der großen Krise aber – die sich in der Folge zu einer mächtigen Staatsschuldenkrise auswuchs, worunter Südeuropa mit einer bis zu 50-prozentigen Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor zu leiden hat – kann man von einem Rollback der neoklassischen Ökonomie an den Unis sprechen. Eine Untersuchung des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW) kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland nur drei bis vier Prozent aller Ökonomiedozenten einen Ansatz vertreten, der radikal vom neoklassischen Mainstream abweicht. Die Mehrheit doziert hingegen die Selbstheilungskräfte der Märkte, die draußen in der Welt Anwendung finden, während alternative Denkansätze, wie sie etwa Karl Polanyi oder gegenwärtig Christian Kreiß oder Niko Peach in Deutschland vertreten, von der herrschenden Lehre abgelehnt werden. Nicht umsetzbar, heißt es kategorisch. Dabei sind Märkte nur Regelmechanismen. Sie haben weder Intelligenz noch Interessen. Es sind immer noch konkrete Menschen, die Geld anlegen und eine Rendite erwarten.
Eines der Grundprobleme unserer Ökonomie ist das immens hohe leistungslose Einkommen der obersten Schichten. In diesem Punkt war sich Polanyi mit Adam Smith einig, der forderte, dass ein freier Markt frei sein müsse von Rentiers, das heißt: frei von Leuten, die erhebliche Einkommen beziehen, ohne dafür zu arbeiten. Je eher man diese und ein paar andere fatale Entwicklungen des Kapitalismus eindämmt, desto größer wäre die Chance, ohne Crash oder Krieg auszukommen. Eine Änderung, so fürchte ich, wird sich jedoch nicht gewaltlos vollziehen. Und das ist das Dilemma: Entweder der »Todestrieb des Kapitals« hält an bis zum Kollaps (»Erst wenn der letzte Baum gefällt und der letzte Fisch gefangen ist, wird der weiße Mann verstehen, dass man Geld nicht essen kann«, wie eine indianische Prophezeiung besagt), oder es kommt vorher zu schweren Verteilungskämpfen, die sich aber nicht minder verheerend ausnehmen würden.
5
Bei etwa 6000 bis 7000 Kulturen weltweit hat man herausgefunden, dass alle Ethnien trotz unzähliger Unterschiede erstaunlich viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Sexuelle Tabus, Vetternwirtschaft oder Emotionen wie Freude, Ärger und Trauer. Es sind keine Banalitäten, sondern es handelt sich um die Feststellung, dass fast alle Kulturen etwas auf eine Art und Weise machen, obwohl es anders möglich wäre.
Evolutionsgeschichtlich überragt zudem die Kooperation im menschlichen Zusammenleben den Konkurrenzgedanken. Michael Tomasello, der als Direktor des Leipziger Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie wichtige empirische Studien unternahm, konnte eins sicher belegen: Die Menschen sind auf dieser Welt nicht die bestimmende Gattung geworden, weil sie als triebgesteuerte Einzelkämpfer gegeneinander ihr Glück gesucht hätten, sondern weil ihr kooperativer Wesenskern überwogen hat.
Vielleicht ist diese Rückbesinnung auf die eigentliche Stärke der Spezies ein Grund, nicht völlig desillusioniert in die Zukunft blicken zu müssen.
Karl Polanyi (1886–1964) hatte ein bewegtes Leben, von Budapest, wo er Jura und Philosophie studiert hat, zog er in das »Rote Wien« der 1920er-Jahre, wo ihn die Projekte der sozialistischen Stadtverwaltung begeisterten, 1935 sah er sich gezwungen, wegen des aufkommenden Faschismus nach London auszuwandern. Dort organisierte er Arbeiterbildung aus dem Geist des christlichen Sozialismus. Schließlich zog er weiter nach Nordamerika, wo er The Great Transformation fertigstellte. Im Wissenschaftsbetrieb war Polanyi ein Außenseiter. Er und seine Familie lebten zeitweise unter ärmlichen Verhältnissen, nicht zuletzt, weil er beträchtliche Summen an Flüchtlinge verschenkt hat. Er galt als ein optimistischer, dem Leben zugewandter Mensch.
Auch The Great Transformation ist in der Quintessenz zuversichtlich. Es schließt damit, dass Polanyi dem Menschen zutraut, »alle Ungerechtigkeit und Unfreiheit, die sich beseitigen lassen, zu beseitigen.« Selbst aus »der letzten Resignation«, schreibt er, sprieße neues Leben. Es bleibt zu hoffen, dass er damit recht behalten möge.