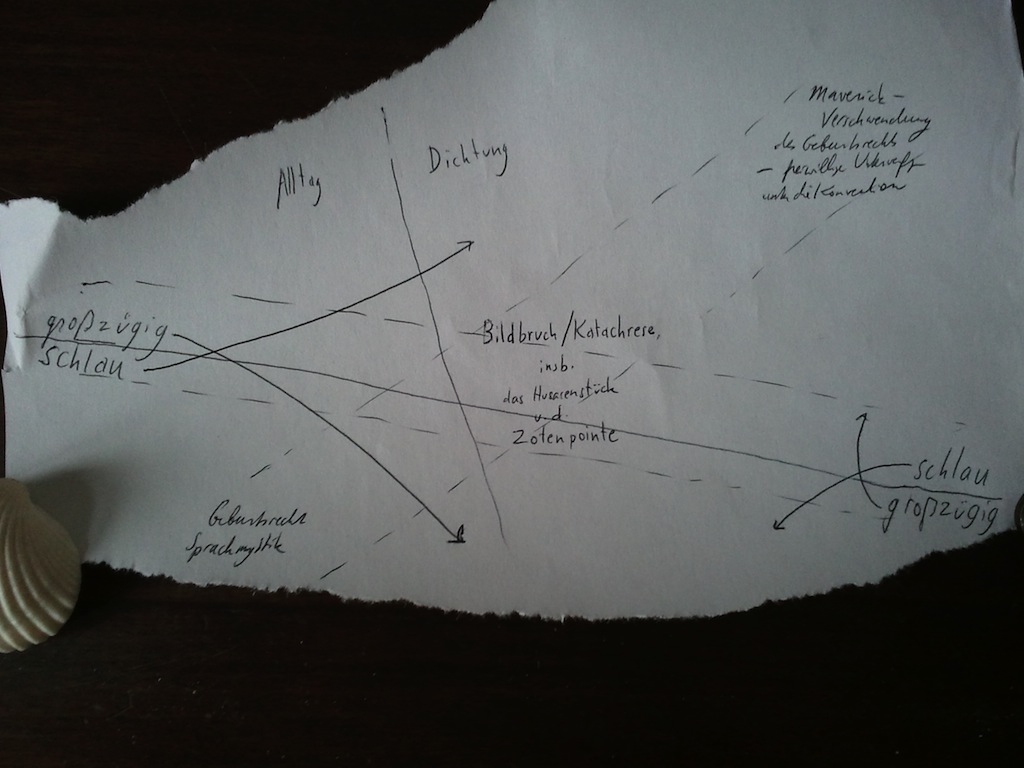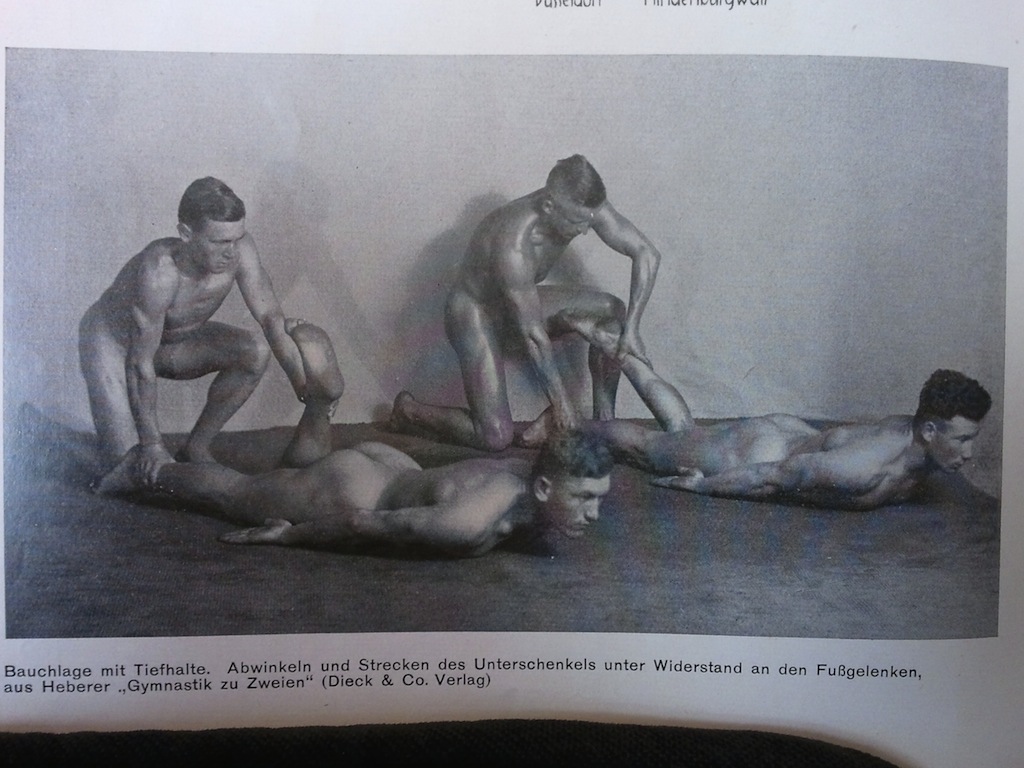In J. Holzhausens neuem Film über das Kunsthistorische Museum in Wien (einem ästhetisch angelegten Werk, das ein technisches Interesse nicht befriedigt, aber gewissermaßen schön ist) sieht man einmal den Weg, den ein Archivar mit einem Roller zurücklegt, um einen Ordner zu holen. Über etwa 180 Sekunden rattert er mit dem lächerlichen Gefährt über das Parkett, verfolgt von der Steadycam des begeisterten Dokumentarfilmers. Mein Freund meinte zwar, aufgrund des Films werde es wohl einige Personalentscheidungen geben (es schauen oft bei Ereignissen wie der Anhebung der Vitrine der Kaiserkrone bis zu zehn Leute zu, deren Funktion ganz unklar ist), aber für mich war das Bild dieser Rollerfahrt ein Schnörkel der Ordentlichkeit, an dem ich mich festhalten kann, wenn ich versuche, die Lebensformen der Ordnung in meinem Leben nachzubilden.
Bei geistigen Tätigkeiten ist nämlich das Prinzip der Frankfurter Küche ganz verkehrt. Man braucht möglichst lange Wege, damit sich das eben Gelesene setzen kann, bevor man das Nächste draufschüttet. Und zu diesen Wegen soll man sich nicht extra entscheiden müssen, sondern sie müssen notwendig sein und stattfinden ganz im Lichte des Begehrens des nächsten Schrittes im Arbeitsprozess. Sonst ziehts mich gleich in andere Angelegenheiten hinein, mich ablenkbaren Fratz. Deshalb nutze ich gerne unterschiedliche Bibliotheken in allen Stadtteilen, halte die Bücher, die bei mir sind, in einem vom Schreibtisch gesonderten Raum, den man nicht immer betreten kann, und sorge dafür, dass aktuell wichtige Bücher sich in einer anderen Stadt befinden als ich.
Am besten fände ich es, wenn man für jedes Buch, das man lesen möchte, bei Bibliothekarinnen vorsprechen müsste, um gute Gründe vorzutragen, warum man es lesen dürfen soll. Es wäre elektrifizierend, heimlich Exzerpte davon abzuschreiben und in dunklen Trinklokalen unter dem Tisch weiterzureichen. Vor jedem Fehler müsste man sich hüten, da es unwahrscheinlich wäre, dass er je korrigiert werden könnte. Man müsste sehr aufmerksam sein und sich alles merken. Überheblichkeit und Unlust wären undenkbar. Ebenso absurd wäre so ein Konzept wie Pflicht und Erfüllung. Die Muskeln des Geistes würden dadurch wie von selbst menschenwürdig ausgebildet.
Wie von selbst? Ja, das ist der große Traum der Trägen. Abnehmen im Schlaf, Japanisch ohne Mühe, mit drei Klicks zum Millionär, Reisen im Zimmer. In den vorangegangenen Absatz habe ich mich hineingesteigert, habe gemäß meiner selbstgebastelten Ausbildung, so wie ich es immer mache, hastig den Riss einer Ideologie skizziert, die meine Einbildungen, Eitelkeiten und Illusionen so anordnet, dass ich ungefähr auf einer Bahn bleibe, die ich für wünschenswert halte. Im Entwurf machte ich weiter und fantasierte im nächsten Absatz: »Wenn ich einmal zu Geld in großem Stil käme, würde ich mir eine Anlage bauen lassen, wie sie die Geparden im Zoo haben, ein im Kreis gespanntes Drahtseil, an dem ein Buch oder ein Mikrofiche befestigt ist und herumgeschleudert wird, um meine Lektüre zu beleben und so meine Annhaftigkeit nicht zu verlieren.« Dieses Bild ärgert mit seinem mangelnden Realismus, kommt man doch mit Fahrrad und zu Fuß auf der Straße schon an die äußersten Grenzen der Kunst des bewegten Lesens, die Bewegung beim Lesen lässt sich aus technischen Gründen nicht steigern, das ist ein Irrweg im Denken. Also verließ ich das Bild fluchtartig und machte schnell weiter, autobiographo-apologetisch mich auf die gestellte Aufgabe besinnend: »Wie man seine Bibliothek ordnet«: »Inzwischen versuche ich das sozusagen innerlich zu machen und nicht im Denken die kürzesten Wege zu bevorzugen, sondern die, wo ich schöne, gerade Strecken zu laufen habe, denn auf diesem Substrat können sich die Gedanken in ihrer vollen Länge ausstrecken, und später gähnen sie umso behaglicher, rollen sich in einer Ecke des Gehirns ein und lassen sich streicheln oder denken nach und schnappen warnend nach der Hand, die sich ihnen nähert, wenn sie gerade Ruhe brauchen.« Abgesehen von der etwas zu breit ausgemalten Tierschilderung bleibt die Idee »Ein Gedanke ist eher eine Gangart als ein Gegenstand, braucht Platz, um überhaupt in Erscheinung zu treten« für mich weiterhin reizvoll. »Ich stelle sie erst einmal ins Regal zu den anderen Artefakten und freue mich über mich selbst jedes Mal, wenn ich sie ansehe.« Doch bin ich wirklich nicht sicher, ob diese Vorgehensweise meinen gerade vorgetragenen Forderungen Folge leistet.
Zugleich stört mich noch etwas: Ich habe einige Verdachte gegen diesen geradezu kokett konstruierten geistigen Vitalismus, der dem dämlichen Kausalismus, man solle es den Autoren schlechter gehen lassen, damit sich die Literatur verbessere, nicht fern genug steht. (Den Autoren! Als teilten sie alle Förderung schwesterlich untereinander, zu dem Zweck, sich in ihren Nestern wie in Reihenhäusern zu langweilen! Als würde nicht der Markt gerade die langweiligsten Autoren begünstigen, während denen, die wirklich aufregende Literatur schreiben (ich sage nur: Ulrich Schlotmann, Brigitta Falkner, Petra Coronato!), materielle Existenzschwierigkeiten natürlich tatsächlich massiv die Arbeit behindern. Was denn sonst? Gibt es je eine Mehrheit mit Geschmack? Aber damit Armut das Leben schlichter machte und konzentrationsfördernd wirkte, wie schon in der Antike landgutgesegnete Philosophen zu schwärmen liebten, müsste sich erst ändern, dass in unserer Gesellschaft jeder augenscheinlich Nicht-Erfolgreiche wie ein Schreckensemblem gemieden wird, man gibt ihnen ungern, was man Reicheren kavalierhaft schenkt, wahrscheinlich in der unklaren Annahme, man bekäme irgendwas zurück, was unwahrscheinlich ist, woher kommt der Reichtum wohl, etwa von einer Ethik des Zurückgebens? Aber Quatsch: deswegen sind ja traditionell die Schichten segregiert, nach unten gibt man nichts her, und oben herrscht eine streng bürgerliche Verbrecherehre.)
Alle schwärmen ja auch zum Beispiel davon, wie die Mimesis von Erich Auerbach im Exil quasi aus dem Gedächtnis geschrieben wurde. Da wird, weil es sonst bös riechen würde, meist gleich klargestellt, dass man deswegen nicht zum Schluss kommen darf, Holocauste seien empfehlenswert, um die Produktion lesbarerer Werke zu befördern. Der kürzeste Denkweg abstrahiert die Situation, in der Mimesis entstand, und führt sie zusammen mit den Resultaten der Erkenntnis des Werts der Lesbarkeit eines Werks, dessen Autor sich gerade nicht in der Liebe zur Pluralität seiner Fakten und dessen Forderungen im Namen der Präzision verliert, und dieser kontrahierende, sich gewissermaßen selbst rationalisierende, also immer stromlinienförmiger gestaltende Denkweg kommt, wenn man ihn lässt, schließlich auf den Syllogismus: »Mehr Verbrechen gegen die Humanität, und das Publikum wird dort abgeholt, wo es ist.«
Ich bin so ausführlich, um zu demonstrieren, dass, was kompliziert klingt, nicht unbedingt kompliziert ist, das Einfache aber weder notwendig ursprünglich noch lapidar – was immer das heißen möchte, steinartig – , sondern die annähernde Unlesbarkeit steht in einem vollkommen kontingenten Verhältnis zur Qualität der in ihr ausgedrückten oder angedeuteten Gedanken. Überhaupt bestehen die Verhältnisse auf der Welt zu 99,999…% aus Kontingenz, es genügt sozusagen ein winziger Tropfen Kausalverknüpfung, um ein gedankliches oder reales Ereignis herbeizuführen, diese Kausalverknüpfung kann wieder durch einen winzigen Tropfen entgegengesetzte Argumentation oder Ereignis umgekehrt oder verhindert werden. Wir haben es also mit extremen, extremen Verdünnungen zu tun, die man nicht mit der bloßen Hand und ich glaube auch nicht mit dem »bloßen«, direkt anpackenden Gehirn behandeln kann. Die Bearbeitung von Gedanken ähnelt in diesem Punkt der Mikrobiologie, wo man auch nicht mit der Pinzette auf die Molekülverbindungen und DNA-Stränge zugreift, sondern diese mit einem ganzen Apparat an Wissen indirekt durch thermische, motorische und chemische Prozesse, Zustände, Vermischungen, Verdünnungen etc. beobachtet, manipuliert und überprüft. Die Kontrolle, die die wissenschaftlichen Versuche erfordern, muss sich abwechseln mit einem Sein-Lassen, Wachsen-Lassen, in sehr präzise bestimmten Zeitmaßen.
Die langen physischen Wege, die ich oben vorschlage, haben also nicht nur den Zweck, uns, also mir, diese 99,999…% ins Bewusstsein zu rufen, sondern sollen vor allem der Mikromaschinerie meines Gehirns ermöglichen, ungestört von der groben Hand bewusster Überlegung ihre Arbeit zu verrichten, also das Gelesene zu verarbeiten. Das heißt zum Beispiel, das soeben Gelesene mit allem, was ich schon weiß und im Gehirn bereits milliardenfach verknüpft habe, gegenseitig bekannt zu machen – oder was auch immer an Geistesarbeit zu tun ist.1
Ich warne also vor den kürzesten Wegen, weil ich als ungeduldiger Mensch zu ihnen neige und mich selbst andauernd vor ihnen hüten muss – aber was ist darunter genau zu verstehen? Ich könnte vielleicht präzisieren: Ich warne davor, sich das Denken einzurichten wie eine bequeme Wohnung und sich darauf zu verlassen, dass die Sachen wirklich da sind, wo man sie sich einbildet. Wie oft ertappt man sich nicht dabei, eine zur zweiten Haut gewordene Lobrede auf einen famosen Text zu halten, in den man zuletzt vor zwanzig Jahren hineinsah! Wie oft hört man doch ältere Herren und Damen wie Klaus Reichert, Hubert Winkels oder Hans Thill auf Podien, in Essays und Gedichten völlig falsche Fakten aus dem Gedächtnis daherplaudern! Es schockierte mich zunächst nicht wenig, dass sich Leute, die als Koryphäen eingeladen wurden, um zum Beispiel als Moderatoren würdige, informierte Arbeitsumgebungen zu gestalten, so verhielten. Schaute nach, wofür sie eigentlich geschätzt wurden, und kam auf eine Art Erklärung: Wahrscheinlich waren es einmal große Individualisten und leidenschaftliche Menschen, sie sind dafür berühmt geworden, und davongetragen haben sie aus dieser Phase inprimis – für die unparteiische Erstbeobachterin – ein allzu seliges Grundvertrauen in ihre Wahrnehmung und ihr Gedächtnis. Durch diese lebenden Entwicklungsromane wurde ich jedenfalls misstrauisch gegen den von mir ursprünglich auch vertretenen hemmungslosen Empfindungsindividualismus. Durch die Gefangenschaft in langjährigen Gesellschaftsevents, mithin Gefangenschaft im Erfolg, wird aus dem empfindenden Selbst, wie es scheint, eine ranzige, ekelhafte Vorliebe fürs Anekdotische.
Exkurs: Wie funktioniert das genau?
Zum Beispiel führt die Annahme, eine gewisse Ansicht F alleine aus dem Sud des eigenen genialischen Inneren gezogen zu haben (also eine subjektivistische Sicht auf die Vorgänge, die einen in der Ideologie des Individualismus gut dastehen lässt), leicht dazu, diese Ansicht F niemals mit dem bereits bestehenden Wissen der Menschheit abzugleichen: ob jemand schon vorher auf diese Idee gekommen ist oder sie gar differenziert oder problematisiert hat. Also zu Willkür und Ignoranz.
Man erkennt sich selbst ja nicht im Licht einer allgemein gefassten Theorie (die kennt man ja nur als Gewand seiner selbst, sie bot kein anderes Interesse), sondern nur am Geruch. Wird man eines Fehlers überführt, nimmt man daran nicht den Fortschritt wahr, die Gelegenheit, einen Fehler hinter sich zu lassen (indem man etwa behauptet, jetzt anders zu sein, und schnell dafür die Tatsachen schafft), sondern empfindet nur die Kränkung: die Unbequemlichkeit, bei etwas ertappt worden zu sein, was man für sich selbst längst begraben hatte, um ein Eigenheim darüber aufzubauen. Und alles nur, weil man sich mit allem, was man so dachte, fühlte und tat, so naiv identifizierte.
Das Anekdotische ist quasi die Mcdonaldisierung des Wissens, aber auch der Sprache. Grammatik muss ja trainiert werden, sonst passiert, was man in der US-amerikanischen Jugendsprache beobachten kann: Der sprachliche Bewegungsspielraum schrumpft massiv. (Der sprachliche – denn viele Aufgaben, die wir schreibtischorientierten Berufe der Sprache abfordern, werden in Küche, Straße, Meer, Kneipe und Iglu eher von Musik und Tanz, Stimmlage, Mimik, Bewegungen im Raum übernommen, während ja gerade bundesdeutsche Intellektuelle oft stehen und starr schauen wie Pappfiguren, während die berühmten hochkomplexen Sätze aus ihren Mündern rattern. Da sind auch landläufige Österreicher schmähstad, ich hab am Anfang im Umkreis deutscher Unis einfach nichts verstanden aus Mangel an Melodik.)
Indessen ist an der Anekdote das Problem nicht so sehr die Kürze als vielmehr das Apodiktische. Das ist keines, das ein einzelner Sprecher für sich lösen kann, es ist ein Problem der Gesprächsverläufe, deren Muster sich viral und zum Großteil unbemerkt oder zu spät bemerkt in den Gesellschaften fortpflanzt. Die meisten Veranstaltungen der Sphären, wie ich sie gelegentlich kennenlernen durfte, wo das Erfolgreiche als Wert hoch im Kurs steht, sind perfekt dazu designed, wirklichen Gedanken keine Angriffsfläche, keinen Landeplatz – um es als Taubenabwehrsystem zu formulieren –, keinen Aufenthaltsraum in der Zeit zu gewähren. Und was ist Erfolg? Im Kulturbetrieb: unwidersprochen zu bleiben.2 Die Hackordnungen des Betriebs und der Literaturhäuser zeigen sich bis ins Minutiöse darin, wer den schreiendsten Unsinn am öftesten vor dem größten und schönsten Publikum verbraten darf. Wer keinen Spaß empfindet, dabei zuzusehen, bleibt diesen Literaturveranstaltungen fern. Das Wasserglas ist also durchaus nicht das Problem an der mangelnden Anziehungskraft von Literaturlesungen, auch nicht das Alter des Stils, sondern es ist hauptsächlich ein Inhaltsproblem.
Inhalt ist übrigens nicht mit »Thema« oder »Plot« identisch. Ich verwende es hier als Leerwort, um nicht etwa die schlammgeborene »Tiefe« zu verwenden oder das irreführende Wort »Potential«. Die Leerformel, weil es um einen Mangel geht. Ich kann ja selbst nicht unbedingt bezeichnen, was mir in all diesen Literaturhäusern fehlt: Seele, Lebenshauch, Hoffnung? – pathetisch, pathetisch. Ja, es geht wohl auch um Partizipation, eine Idee, die im Moment von dieser Schweinegrippe der Kulturveranstaltungen, dem Slam, komplett abgedeckt wird, wie die Politik von Wahlkämpfen. Es wird jedenfalls nicht genügen, Spielchen anzubieten und noch grellere Farben für die serifenlosen Logos zu verwenden. Es geht darum, ob da etwas geht. Oder ob nichts geht.
Als ich in Japan auf Englisch unterrichtete, musste ich mir beibringen, simple English zu verwenden. Die Herausforderung war, deswegen das Niveau der Subtilität des Inhalts nicht zu senken. Es war eine erleichternde Erleuchtung für mich, dass das tatsächlich möglich war – ich hatte den abgekürzten Denkweg, dass Komplexität und Genauigkeit direkt proportional zueinander anstiegen, noch fest im Kopf. Und alles musste natürlich in einen Satz gepackt werden, wahrscheinlich um Atem zu sparen. Jetzt weiß ich wenigstens theoretisch, dass das nur bedeutet, dass man nicht genau weiß, zu wem man spricht, und zur Sicherheit alles gesagt haben will. Allerdings sei mir zugestanden, dass ich in meiner Jugend (ach, ich Idiot!) wirklich nur fürs All schrieb, dem ich mithilfe aller Winkelzüge der Grammatik das volle Gewebe meines Gehirns ausbreiten wollte.
Also, ich wollte nur sagen, dass ich, wie vielleicht nicht wenige, ein hitzköpfiges, fehleranfälliges Gedächtnis habe und daher unbedingt Ordnungssysteme verwenden muss, die geeignet sind, meine fehlerhaften Tendenzen zu korrigieren. Das System »Geliebte als geistige Provokateure« wird dadurch, dass ich imstande werde, solche Systeme zu entwickeln und wirklich zu verwenden, langsam abgelöst durch Fußnoten, Materialsammlungen, Denkpausen und öffentliche Bibliotheken (gedankt sei für sie Gott. Nein, der historischen internationalen Arbeiterbewegung).
Das Einfache ist kein Wert für sich, und es kann nicht von außen verlangt werden; es ist Leuten wie mir, denen manchmal gerade die Präzisionswut den Blick auf die Gedanken als Bewegungen verstellt, halt anzuempfehlen als Aufgabe, es dürstet mich auch danach. Die von Natur aus mit Einfachheit Begabten brauchen aber wieder andere Scherze und Ruten, um sie aus den fauligen Furchen der Identität zu heben.
Wenn jemand also die Schlichtheit lobt, so frage nach, ob das aus Liebe zum Eigengeruch oder aus einem utopischen Sehnsuchtsgedanken heraus geschieht – oder ob sich das vielleicht auf eine Weise mischt, die, wenn man es ungestört fermentieren lässt, in ein paar Jahren eine üble Jauche verheißt. Und so weiter. Prinzipiell aber ist jedem, dessen Augen sich an die Umgebung gewöhnen, sodass diese schon zum geordneten Bild zusammenschmilzt, dringend zu raten, weiterzuziehen, bevor er in ein Steinbunny verwandelt wird.
1 Ich möchte hier meine Ansicht zu Fuß- und Endnoten kundtun, da es vielleicht jemand lesen könnte, die oder der auf diese Kultur einen Einfluss hat. Endnoten sind nämlich ein großes Ärgernis. Am allerschlimmsten sind die, die hinten im Buch auch noch nach Kapiteln oder Aufsätzen geordnet sind, sodass man bis zu einer halben Stunde lang suchen muss, um möglicherweise festzustellen, dass es einen nicht interessierte. Die Endnotenideologie kann nur von der Fraktion der absolut stumpfen Leute ohne die geringste Wissbegier herstammen, die aus irgendeinem Grund sich ausrechnen, dass man mit seinen eigenen Vorurteilen über Annotationen so zufrieden ist, dass man nicht nachzusehen braucht, ob es einen interessiert oder nicht. Sobald man sie verwendet, sind Endnoten Fußnoten unendlich unterlegen, da man entweder mit dem Daumen im Buch lesen muss oder einem zweiten Lesezeichen, nach dem man fummeln muss, oder überhaupt bei jeder Note noch einmal von hinten nachblättern, was einen niemals nicht aus dem Fluss bringt. Fußnoten sind hingegen eine Form der moderaten Mehrsträngigkeit, die dem Menschen zumutbar ist. Unter ihnen finden sich die allerschönsten bei Roman Jakobson.
Dies scheint vielleicht im Widerspruch zu meinen bisher gelüfteten Ansichten über physische Umwege zu stehen. Da muss ich präzisieren, dass wohl nicht jede physische Störung gut fürs Denken ist. Um aus Endnoten eine produktive Unterbrechung zu machen, müsste ich jedes Nachblättern mit Kniebeugen oder Wasserholen in Verbindung bringen und die Wiederannäherung an den Text danach zur Rekapitulation seines Inhalts und des relativen Gewichts seiner Thesen (bzw. der Thesen seiner einzelnen Sätze) zum Grund, warum ich ihn lese, nutzen – und das ist höchstens alle zwanzig Minuten sinnvoll. In Wirklichkeit machen mein Ärger und meine Ungeduld jeden pädagogischen Effekt zunichte.
2 Da hat man wieder einmal ein Prinzip aus dem Wissenschaftsbetrieb unüberprüft herüberkopiert: Eine These bleibt dort gemäß der Übereinkunft solange im Raum, solange nicht bewiesen ist, dass sie falsch ist. Diese (wiederum wohl aus der Unschuldsvermutung der juristischen Tradition entlehnte) Regelung erfordert aber eine sehr streng organisierte Community, die sich gegenseitig liest, die mutwillige Äußerung von komplettem Blödsinn irgendwie suggestiv oder durch Präventivkontrollen verhindert und vor allem gemeinsame Kriterien zur Beurteilung dieser Frage besitzt, was man dem geisteswissenschaftlichen Bereich nicht wirklich wünschen kann. Wir reden aufgrund der »Soft«-heit unserer Inhalte und der Virtuosität ihrer sprachlichen Vielfalt mit Leichtigkeit andauernd schlüpfrig aneinander vorbei. Wir brauchen also Korrektive, die mit dieser »Schlüpfrigkeit« umgehen können, und ich kenne da nur den Geschmack. Ich fürchte, Snobismus lässt sich nicht systematisieren, sodass vom System her keine Gerechtigkeit zu erwarten ist und die Protagonisten selbst zwischen mildem Herzen und strengem ästhetischen Blick unterscheiden müssen. Dieser soll nicht zur Begründung von Hartherzigkeit missbraucht werden (Leute, die alles auf Regelungen überwälzen wollen, schöben hier ein zweites Hilfsverb »dürfen« ein, über welche Wendung LeserInnen von Cottens Fußnoten nun Anlass haben zu lachen, wann immer es einem in der FAZ auffällt); überhaupt sollten moralische und ästhetische Kriterien nicht verwechselt werden.
Die Umwege des Handelns oder die kleinste Gebärde von Fernand Deligny kommt in der Übersetzung von Ronald Voullie 2015 bei Peter Engstler heraus, wo schon zwei seiner Bücher auf Deutsch erschienen. Unter anderem ist der Ethologe Deligny ein genauer Beobachter von Bewegungs- und Handlungsabläufen und deren feinsinniger, ideologiefreier Interpret; berühmt ist er in der Kunstwelt insbesondere für seine Skizzen.