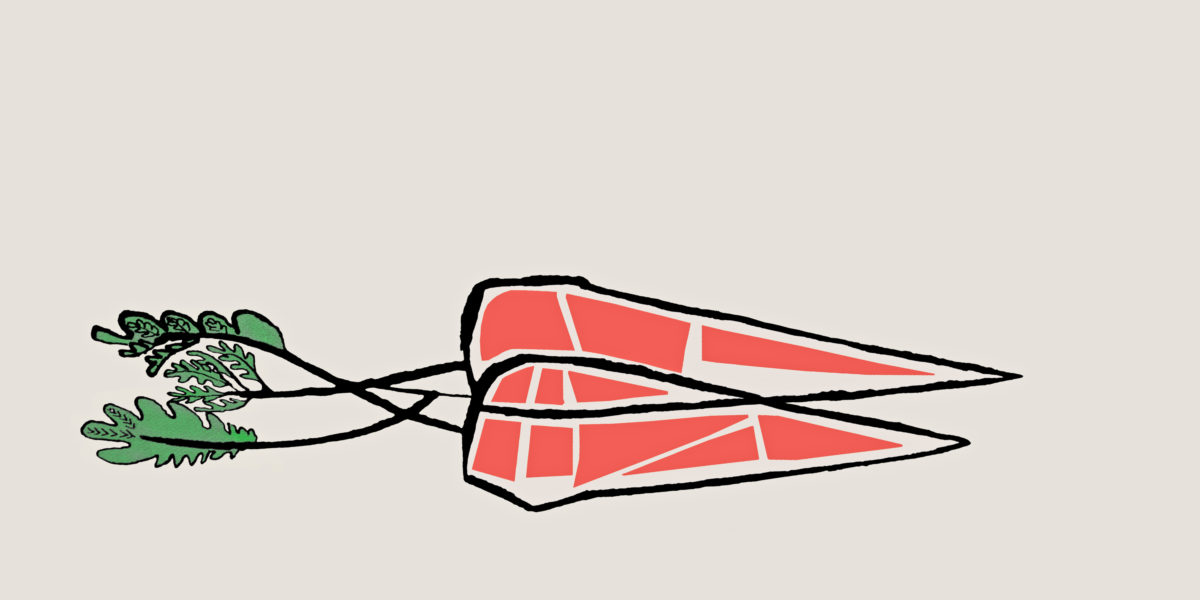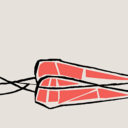Wir befinden uns in einer Propeller-Maschine der Austrian Airlines. Sie schlingert, ruckelt, vibriert und wird in alle Richtungen verschoben. Ich weiß jetzt, dass es in einem Flugzeug durchaus möglich ist, abrupt nach vorne gerissen zu werden, ganz so, als hätte jemand auf eine Bremse gedrückt. Zwei Dinge, die mir auffallen: In dieser rund neunzig Passagiere fassenden Maschine befinden sich überdurchschnittlich viele Zeitungsleser*innen. Ich sehe die New York Times International Edition, NZZ, ZEIT, Theater Heute. Mir fällt auch auf, dass es sich um Vielflieger*innen handeln muss, denn niemand blickt auf. Niemand außer uns versucht im Gesicht der Flugbegleiterin abzulesen, ob dieses Schlingern normal ist. Wir, das sind drei der neun Stipendiat*innen des Klagenfurter Literaturkurses, dieses im Halbschatten liegenden Nebenschauplatzes der Tage der deutschsprachigen Literatur, für den es auch einen zweiten, noch uncooleren Namen gibt: Häschenkurs.
Möglich, dass wir schon von der Vorhut des sogenannten Literaturbetriebs umgeben sind. Möglich, dass hier schon die ersten Verleger*innen und Lektor*innen sitzen, die ersten Agent*innen und Literaturkritiker*innen, ich weiß es nicht. Der Literaturbetrieb ist mir beinahe so unbekannt wie ich ihm. Ich erahne die Existenz von Excel-Tabellen, in denen Namen gesammelt und herumgeschoben werden, ich ahne, dass emsige Literaturscouts Blattschneideameisen gleich ausschwärmen werden, um seine Ränder abzutasten.
Wie sonst sollte ich es mir erklären, dass ausgerechnet ich für Logbuch Suhrkamp schreiben soll. Irgendjemand mag sich gedacht haben: Der ist jetzt im Häschenkurs, der hat doch mal, da war doch irgendwo, why not … Durch einen Lautsprecher scheppert die Stimme der Flugbegleiterin: Ladies and gentlemen, as we start our descent to Klagenfurt, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Meine Tasche liegt, den Anweisungen entsprechend, rutschfest verstaut unter dem Vordersitz. Ich reise mit leichtem Gepäck. Zwei Hosen, zwei Oberteile, ein Text, der mir wichtig ist. In drei Tagen beginnt der Wettbewerb, bis dahin sind für uns Stipentiat*innen Tutorien angesetzt. Am 3. Tag, kurz vor der Eröffnung, lesen wir im Musilhaus.
Ich scrolle durch E-Mails und verschaffe mir einen Überblick. Frau Planegger vom Musilhaus informiert uns über das Angebot an mietbaren Fortbewegungsmitteln. Ich fühle mich umsorgt. Frau Planeggers persönliche Präferenz ist der E-Scooter, sie schreibt: PS: Ich habe selbst einen E-Scooter. Man kommt sehr schnell von A nach B. Ich kann ihn empfehlen. Es lohnt sich und macht auch Spaß. Jedoch bitte Vorsicht im Straßenverkehr.
Es ist heiß in Klagenfurt. So heiß, dass der Asphalt flimmert und sich um jedes Glas kühler Getränke Lachen bilden. In den nächsten drei Tagen vertreibe ich mir die Zeit, indem ich zum See gehe, mir in meinem Hotelzimmer Instant-Noodle-Suppen koche, Skurrilitäten sammle. In der Kirche auf dem Kreuzbergl lese ich: Durch den Einsatz von LUMEX-Qualitätsopferkerzen mit reinem Flüssigwachs helfen Sie mit, Decken und Wände, wertvolle Fresken, Gemälde und Statuen vor unnötiger Rußverschmutzung zu schützen.
Tag 3, der Literaturbetrieb ist unübersehbar eingetroffen. Die Hotels sind ausgebucht, sämtliche Mieträder sind verliehen, überall Menschen mit der gleichen grauen, allen Akteuren ausgehändigten Umhängetasche mit dem Konterfei Ingeborg Bachmanns darauf.
Im Musilhaus hat das Publikum Platz genommen: Agent*innen, Lektor*innen und Menschen, die wegen des Büfetts zu so was gehen. Und jetzt sehe ich tatsächlich eine Liste, nicht als Excel-Datei, sondern in den Händen der Frau, die im Casual-Business-Dress in der ersten Reihe sitzt. Ganz konkret, haptisch, auf weißem Papier, darauf Namen, unsere Namen, die Namen der neun Stipendiat*innen.
In der Pause nach dem ersten Leseblock werfe ich unauffällig einen zweiten Blick darauf: Jetzt ist ein Name durchgestrichen, neben einem anderen prangt ein Stern. Nach der zweiten Pause: drei Namen durchgestrichen, unverändert ein Stern. Nach dem letzten Block: vier Namen durchgestrichen, hinter zwei Namen jeweils ein Stern.
Es folgt das Herumstehen und Konversieren. Warten/hoffen/ fürchten, dass man angesprochen wird. Eine Mitstipendiatin ist noch immer nicht von der Toilette zurückgekehrt, ein anderer bricht im Gespräch mit einer Agentin mitten im Satz ab. Er sagt: Ich hab so einen Druck auf dem Ohr. Er legt den Zeigefinger an sein Ohr, er drückt, er schluckt mehrmals, er spannt den Mund auf, er wiederholt: Ich hab so einen Druck auf dem Ohr, und entfernt sich einige Schritte. Er kehrt der Agentin den Rücken, die Agentin wartet, trinkt einen Schluck Wasser, wartet, trinkt noch einen Schluck.
Aus unseren Mündern die immergleichen, verlegenen Sätze: Ja, denk schon, ja, also eigentlich schon an einem Roman, nein, noch nicht so weit, danke, schön, gerne, wenn ich dann soweit bin, ah cool, stecke ich gleich ein, nice, die ist ja sogar gestanzt.
Später erfahren wir, dass es ein Verteilungssystem gibt. Die Texte, mit denen wir uns beworben haben, wurden ausgedruckt. Sie liegen für die Akteure des Betriebs in ihren Hotels aus. Ich denke an die tausend Stellen, die sich in meinem Text verändert haben, seit ich ihn im Februar eingereicht habe. Ich denke an die Sätze, die mir inzwischen peinlich sind. Ich denke an Excel-Tabellen.
In den nächsten Tagen lerne ich: dass das Wort »vielleicht« ein literarisches Unwort sein soll – überhaupt, dass es literarische Unworte gibt –, dass über Texte abseits der Kameras ganz anders gesprochen wird. Dass es auch zarte Momente gibt: die Jurorin, die einem Autor, dessen Text verrissen wurde, am Abend über den Rücken streicht und ehrlich besorgt um ihn ist, ohne dabei herablassend rüberzukommen. Die jungen Agent*innen, die fast ebenso scheu wirken wie wir und die nur im Pulk unterwegs sind, sich offenbar gegenseitig mögen, obwohl sie Konkurrent*innen sind. Sie sprechen Autor*innen gemeinsam an und stecken ihnen gemeinsam, eine nach dem anderen, ihre Karten zu.
Ich lerne auch, dass der Literaturbetrieb selbst ein Geschichtengenerator ist. Um einen der Lesenden ranken sich Legenden. Er ist der jüngste, nie ist er auf einer Liste aufgetaucht, kein Scout ist an den ausfransenden Rändern je auf seinen Namen gestoßen. Dann auch noch schön und gut gekleidet und langes Haar und eine Aura der Unnahbarkeit.
Umso stärker wird er nun in den Fokus gerückt. Jedes Ungleichgewicht verlangt seine Aufhebung. Jeder Mythos seine Entzauberung. Es wird geraunt und geflüstert. Man sagt, sein Verleger schirme ihn sorgsam ab. Manchmal sehe man die beiden rauchend auf der Hotelterrasse sitzen. Der Verleger sorge für die Hydrierung seines Schützlings. Der Verleger massiere ihn, wie ein Trainer sein vielversprechendstes Nachwuchstalent massiert. Dass er ihm einschärfe: Langsam lesen, ganz langsam von Wort, zu Wort, zu Wort.
Eine Mitstipendiatin hat einen Literaturpodcast gefunden, in dem zwei ebenso am Anfang, vielleicht aber auch am Ende Stehende unsere Lesung kommentieren. Wir finden ihn schlecht recherchiert und dilettantisch, wir kommen schlecht weg. Meine Mitstipendiatin sagt: Wir müssen die finden. Sie holt Hinweise der anderen ein, einer meint: Den einen sehe ich jeden Tag im ORF-Garten rumsitzen. Wir steigern uns ein bisschen hinein und mögen es irgendwie.
Es ist jetzt Tag 4, oder ist es schon Tag 5, ich weiß es nicht, ich habe den Überblick verloren, ich sitze im ORF-Garten, ich stehe an einer Haltestelle, ich sitze in einem Shuttlebus, ich fächere mir Luft mit einer Einladung zu, ich stehe auf einer professionell gepflegten Rasenfläche vor einem Schloss, umgeben von weiß verhüllten Tischen und Menschen in Abendkleidern und weißen Hemden, die ich nicht kenne. Doch: Da ist Clemens Setz, aber der kennt ja mich nicht. Da ist auch Hubert Winkels, und dort steht eine Autorin, deren Name mir gerade nicht einfällt, und wo sind eigentlich Leander und Charlotte schon wieder, und was ist das bitte, Orangensaft? Und das da Apfelschorle? Und ist in dem da Alkohol drin? Danke, dann das.
Am Ende des letzten Lesetages einige letzte Bilder. Die Kameras im ORF-Garten, über die Schutzhüllen gestülpt wurden, die Scheinwerfer, die abgebaut werden, die Bildschirme im Zelt: schwarz. Auf dem Gras zwischen leeren Stühlen und Liegen verstreut die Texte des heutigen Lesetages. Der Wind, der sie durchblättert und verschiebt.